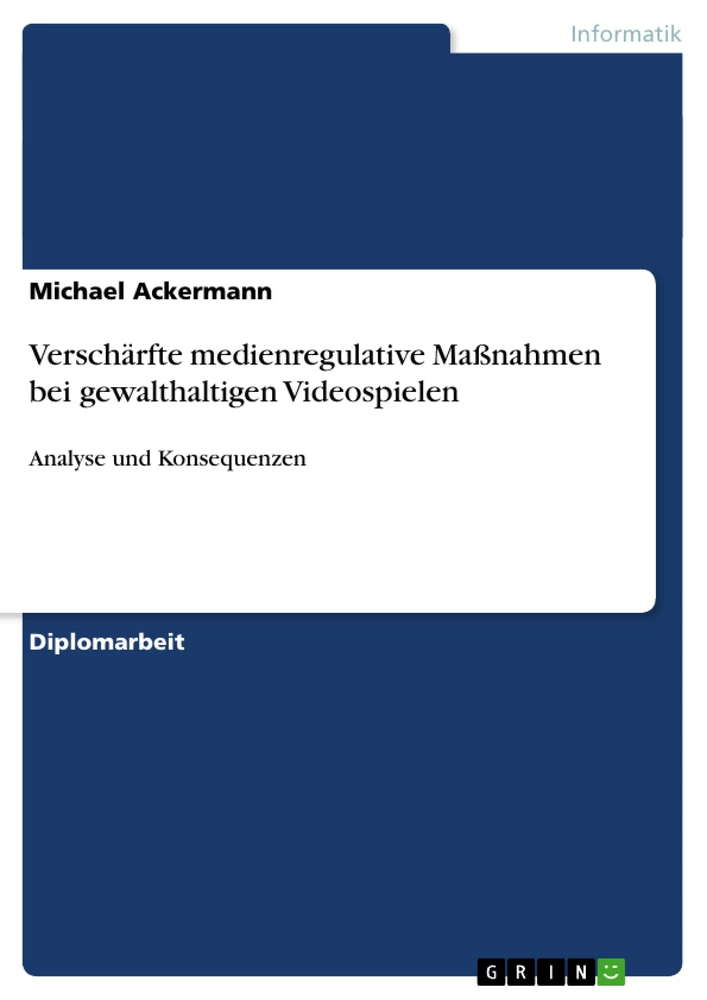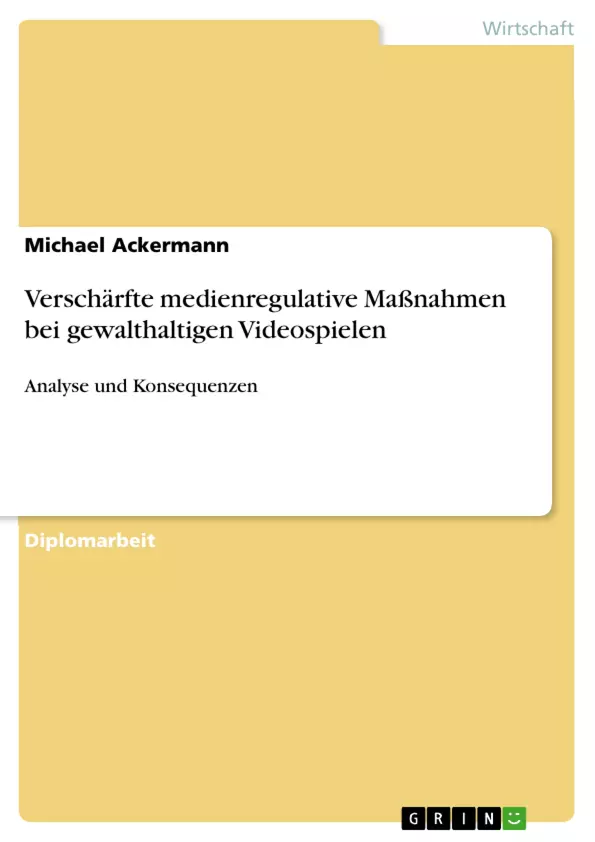Die globale Computer- und Videospielindustrie hat sich über die letzten 35 Jahre hinweg zu einer der umsatzstärksten Medienbranchen entwickelt. Über 25 Millionen Bundesbürger sitzen heute mehr oder weniger regelmäßig vor dem Fernseher und zertrampeln Schildkröten in der Welt von „Super Mario“, erforschen abenteuerliche Tempel mit „Lara Croft“ oder treten in der virtuellen Königsklasse des Weltfußballs gegeneinander an. Im Zuge fortschreitender Konvergenz verwischen außerdem zunehmend die Grenzen moderner Spiele mit interaktiven Unterhaltungsangeboten aus Film und Fernsehen.
Bevor Videospiele auf dem freien Markt verkauft werden dürfen, müssen sie sich heute in vielen Ländern speziellen Kontrollen durch Alterseinstufungssysteme unterziehen. Doch nur wenige Staaten unterziehen die angebotene Unterhaltungssoftware ähnlich strengen Kontrollen wie es die Bundesrepublik Deutschland tut. Nicht zuletzt verheerende Gewalttaten an verschiedenen Schulen haben Gesellschaft und Politik hierzulande dahingehend sensibilisiert, speziell gewalttätige Inhalte moderner Videospiele mit besonderem Argwohn zu betrachten. Die Diskussion, ob Videospiele mit Gewaltdarstellungen tatsächlich einen negativen Einfluss auf die persönliche Entwicklung von Jugendlichen nehmen, wird seit Jahren immer wieder auf ein Neues angefacht und ist im Verlauf der Zeit Gegenstand unzähliger wissenschaftlicher Untersuchungen und Studien geworden.
In der Politik haben sich jugendgefährdende Medien in den letzten Jahren zu einem zentralen Diskussionsthema entwickelt. In den vergangenen zehn Jahren wurden unterschiedliche Gesetzesanpassungen und Regulierungsversuche im Bereich der Distribution von Unterhaltungssoftware unternommen - mit durchaus unterschiedlichem Erfolg.
Aus Branchenkreisen werden Forderungen nach einer Abkehr vom derzeitigen Einstufungssystem immer lauter. Die strengen Auflagen der Prüfgremien bergen für die Unterhaltungssoftware-Industrie einen großen Mehraufwand oder gar ein Verlustrisiko, weshalb einige Unternehmen bereits mit der Abwanderung aus dem deutschen Markt drohen, sollten die Restriktionen in Bezug jugendgefährdende Inhalte noch weiter verschärft werden.
Diese wissenschaftliche Ausarbeitung beschäftigt sich mit möglichen Konsequenzen solcher verstärkter medienregulativer Maßnahmen, wobei wirtschaftliche, wie auch gesellschaftliche Gesichtspunkte gleichermaßen Berücksichtigung finden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Motivation und Ziele
- 1.3 Methodik
- 2 Einführung und Hintergründe
- 2.1 Entstehung der Diskussion um gewalthaltige Videospiele
- 2.1.1 Definition des Begriffs „Killerspiel“
- 2.1.2 Medienumbrüche: Ein Generationenkonflikt
- 2.1.3 Evolution gewalthaltiger Videospiele
- 2.1.4 Gewalthaltige Videospiele im Fokus der Medien
- 2.2 Die Wissenschaft zur Wirkung gewalthaltiger Videospiele
- 2.2.1 Erklärungsmodelle zu kurzfristigen Auswirkungen
- 2.2.2 Erklärungsmodelle zu langfristigen Auswirkungen
- 2.2.3 Empirische Studien zur Wirkung von Mediengewalt
- 2.3 Bedeutung der Videospielbranche in Deutschland
- 2.3.1 Kulturelle Bedeutung von Videospielen
- 2.3.2 Wirtschaftliche Bedeutung der Videospielindustrie
- 2.4 Überblick und Zwischenfazit
- 3 Die regulierte Selbstregulierung in Deutschland
- 3.1 Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle
- 3.2 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
- 3.3 Pan European Game Information
- 3.4 Möglichkeit zur Beschlagnahmung nach § 131 StGB
- 3.5 Kritiker der regulierten Selbstregulierung
- 3.5.1 Landesregierungen unter Führung der Union
- 3.5.2 Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen
- 3.5.3 Hans-Bredow-Institut für Medienforschung
- 3.6 Überblick und Zwischenfazit
- 4 Die Politik in der Diskussion um gewalthaltige Videospiele
- 4.1 Standpunkte und Forderungen deutscher Parteien
- 4.2 Politische Regulierungsbestrebungen seit Erfurt 2002
- 4.2.1 Novelle des Jugendschutzgesetzes
- 4.2.2 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Jugendschutzes
- 4.2.3 Erstes Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgesetzes
- 4.3 Überblick und Zwischenfazit
- 5 Konsequenzen verschärfter medienregulativer Maßnahmen
- 5.1 Wirtschaftliche Konsequenzen
- 5.1.1 Entwickler und Publisher
- 5.1.2 Einzelhandel
- 5.1.3 Dienstleister
- 5.2 Gesellschaftliche Konsequenzen
- 5.2.1 Vernachlässigung tiefergehender Ursachen von Gewalttaten
- 5.2.2 Popularisierung verbotener Videospiele
- 5.2.3 Kriminalisierung und Bevormundung erwachsener Spieler
- 5.2.4 Vernachlässigung anderer negativer Auswirkungen
- 5.3 Überblick und Zwischenfazit
- 6 Fazit und Handlungsempfehlungen
- 6.1 Förderung der allgemeinen Medienkompetenz
- 6.2 Konsequenter Einsatz von Regulierungsmöglichkeiten
- 6.3 Erhöhung der Transparenz bei Kontrollmechanismen
- 6.4 Maßnahmen zur Prävention von Sucht und Gewalt
- 6.5 Zusammenfassung und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die verschärften medienregulativen Maßnahmen bei gewalthaltigen Videospielen in Deutschland und untersucht deren Konsequenzen für die Gesellschaft, Wirtschaft und die Videospielbranche selbst.
- Die Entwicklung der Debatte um gewalthaltige Videospiele und deren Regulierung
- Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirkung von Videospielgewalt auf den Menschen
- Die Rolle der Selbstregulierung und der Politik im Bereich des Jugendschutzes
- Die Auswirkungen von verschärften medienregulativen Maßnahmen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft
- Handlungsempfehlungen für eine effektive und ausgewogene Regulierung der Videospielbranche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation und die Ziele der Arbeit erläutert. Anschließend werden die Entstehung der Debatte um gewalthaltige Videospiele, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirkung von Videospielgewalt, die Bedeutung der Videospielbranche in Deutschland sowie die regulierte Selbstregulierung in Deutschland vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich der Rolle der Politik in der Diskussion um gewalthaltige Videospiele und beschreibt politische Regulierungsbestrebungen seit Erfurt 2002. Das vierte Kapitel untersucht die Konsequenzen verschärfter medienregulativer Maßnahmen für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Abschließend werden im fünften Kapitel Handlungsempfehlungen für eine effektive und ausgewogene Regulierung der Videospielbranche gegeben.
Schlüsselwörter
Gewalthaltige Videospiele, Medienregulierung, Jugendschutz, Selbstregulierung, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Konsequenzen, Handlungsempfehlungen.
- Citar trabajo
- Michael Ackermann (Autor), 2010, Verschärfte medienregulative Maßnahmen bei gewalthaltigen Videospielen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159943