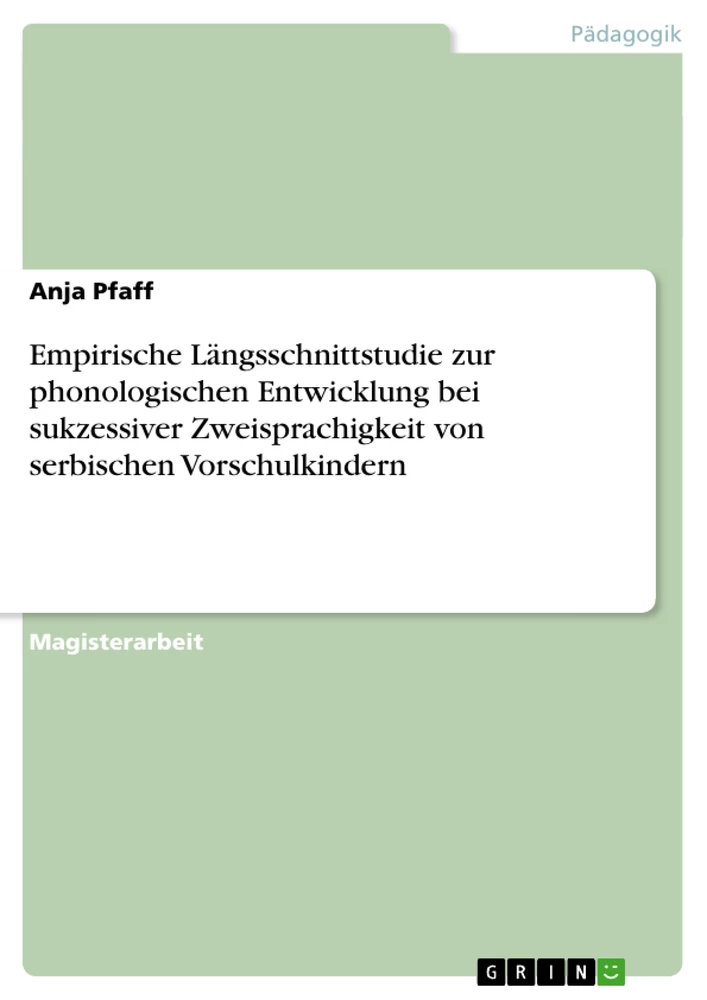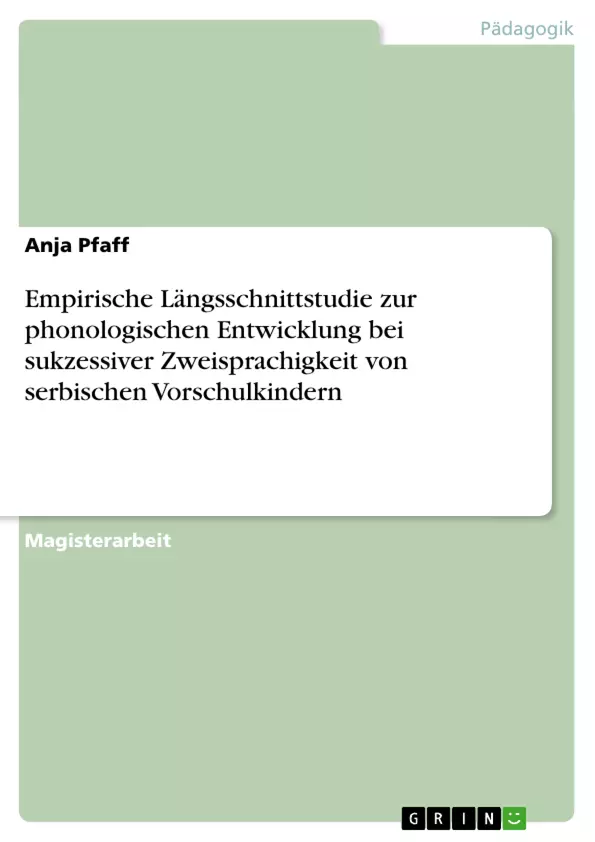Im Gebiet des Erwerbs von Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit kann bereits auf einige Jahrzehnte intensiver wissenschaftlicher Auseinandersetzung zurückgegriffen werden. Die Literatur reicht von ersten Arbeiten Mitte der 30er Jahre bis zu zahlreichen Veröffentlichungen in der jetzigen Zeit, die ein zunehmendes Interesse an diesem Forschungsbereich erkennen lassen. In Deutschland etablierte sich die Forschungsrichtung zur mehrsprachigen Sprachentwicklung aufgrund der wachsenden Zahl von Gastarbeitern, deren sprachliche Problematik eine bildungspolitische, pädagogische und soziale Herausforderung darstellte.
Heutzutage ist die Auseinandersetzung mit dem Thema der Zweisprachigkeit von Kindern, wie es auch in dieser Arbeit der Fall ist, hauptsächlich durch den Aspekt der wachsenden Immigration nach Deutschland geprägt. Äußerst deutlich wird dieser Wandel in den institutionalisierten Einrichtungen, d.h. in Kindergarten, Vorschule und Schule, deren Klientel längst nicht nur deutsche, sondern Kinder unterschiedlichster Nationalitäten umfasst. Meist sprechen die Kinder kaum Deutsch, bevor sie in eine dieser Einrichtungen eintreten, wodurch die Erzieher und Lehrer vor eine außergewöhnliche Aufgabe gestellt werden, sofern es sich nicht zufällig um muttersprachliche Pädagogen handelt. Mittlerweile treffen wir nicht nur in den Regelkindergärten und –schulen auf ausländische Kinder, sondern auch vermehrt in Schulen für Behinderte (u.a. an Sprachheilschulen) und sprachheilpädagogischen Praxen.
Diese besonderen Anforderungen, denen Pädagogen, Therapeuten und Eltern gegenüberstehen, verlangen von der professionellen Seite, somit auch von der Sprachheilpädagogik, eine fundierte Grundlagenforschung auf dem Gebiet der kindlichen Zweisprachigkeit und dessen Erwerbsmechanismen, da sie für eine Rechtfertigung didaktischer bzw. therapeutischer Konzepte und Modelle unabdingbar ist.
Mit Hilfe von teils selbsterstellten Diagnostikmaterialien wurde in einem Forschungsprojekt die phonetisch-phonologische Entwicklung von serbischen Kindern, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, untersucht. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zur Erhellung von Zweitspracherwerbsprozessen und deren Entwicklung, insbesondere beim Erwerb des Lautsystems, zu leisten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN
- Was ist Zweisprachigkeit?
- Terminologie und Begriffsbestimmung
- Die Begriffsvielfalt
- Definitionsansätze
- Typologien der Zweisprachigkeit nach verschiedenen Kriterien
- Bedingungen beim Spracherwerb
- Linguistische Kriterien
- Psycho- bzw. soziolinguistische Kriterien
- Theorien zum Erwerb von Zweisprachigkeit
- Die Kontrastivhypothese
- Die Identitätshypothese
- Die Interlanguage-Hypothese
- Die Interdependenz-Hypothese
- Aktuelle Diskussion zum Zweitspracherwerb
- Der Erwerb des Lautsystems innerhalb der Sprachentwicklung
- Unterscheidung Phonetik / Phonologie
- Die Phonologische Entwicklung
- Theorien und Ansätze
- Die Phonologische Entwicklung im Erstspracherwerb
- Die Phonologische Entwicklung im Zweitspracherwerb
- Kontrastive Analyse des serbischen und deutschen Phonemsystems
- Das serbische Konsonantensystem
- Das deutsche Konsonantensystem
- Kontrastive Analyse beider Konsonantensysteme
- EMPIRISCHE LÄNGSSCHNITTSTUDIE
- Entwicklung der Fragestellungen
- Fragestellungen zur quantitativen Analyse
- Hypothese 1
- Hypothese 2
- Fragestellungen zur qualitativen Analyse
- Fragestellung 1
- Fragestellung 2
- Fragestellung 3
- Methodische Vorgehensweise
- Beschreibung der Stichprobe
- Alter und Geschlecht
- Nationalität der Eltern
- Geburtsland und Sprachgebrauch in der häuslichen Umgebung
- Dauer des Kindergartenaufenthalts
- Form der Zweisprachigkeit
- Vorstellung des Untersuchungsmaterials
- Screening-Verfahren zur Ausspracheuntersuchung (SVA)
- Konstruktion einer serbischen Variante des SVA
- Durchführung der Untersuchung
- Auswertung
- Darstellung der Ergebnisse
- Ergebnisse der quantitativen Analyse
- Voraussetzungen
- Überprüfung der Hypothese 1
- Überprüfung der Hypothese 2
- Ergebnisse der qualitativen Analyse
- Ergebnisse zu Fragestellung 1
- Ergebnisse zu Fragestellung 2
- Ergebnisse zu Fragestellung 3
- Diskussion der Ergebnisse
- Die Beziehung zwischen Erst- und Zweitsprache
- Die Phonologischen Prozesse
- Die phonologische Entwicklung in der Zweitsprache Deutsch
- Bezug zu den Ergebnissen der phonetischen Entwicklung
- Methodenkritik
- Ausblick
- Phonologische Entwicklung von serbischen Vorschulkindern im Deutsch-Erwerb
- Interdependenz zwischen Erst- und Zweitsprache
- Einfluss des serbischen Phonemsystems auf den Deutsch-Erwerb
- Kontrastive Analyse der phonologischen Systeme
- Qualitative und quantitative Analyse der phonologischen Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der phonologischen Entwicklung von serbischen Vorschulkindern, die sukzessiv Deutsch als Zweitsprache erlernen. Ziel ist es, die phonologische Entwicklung in der Zweitsprache Deutsch zu untersuchen und die Interdependenz zwischen Erst- und Zweitsprache zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der phonologischen Entwicklung bei sukzessiver Zweisprachigkeit ein. Kapitel 1 beleuchtet den Begriff der Zweisprachigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven und stellt verschiedene Typologien vor. Kapitel 2 diskutiert Theorien zum Erwerb von Zweisprachigkeit, wobei verschiedene Hypothesen und aktuelle Debatten beleuchtet werden. Kapitel 3 widmet sich der Erwerbsentwicklung des Lautsystems innerhalb der Sprachentwicklung und stellt verschiedene Theorien und Ansätze vor. In Kapitel 4 erfolgt eine kontrastive Analyse des serbischen und deutschen Phonemsystems, wobei die Unterschiede im Konsonantensystem im Fokus stehen. Kapitel 5 formuliert die Fragestellungen der empirischen Längsschnittstudie, die sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte der phonologischen Entwicklung beleuchten. Kapitel 6 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Untersuchung, einschließlich der Stichprobenbeschreibung, des Untersuchungsmaterials und der Auswertungsmethode. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Studie, sowohl aus quantitativer als auch qualitativer Perspektive. Die Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 8 fokussiert auf die Beziehung zwischen Erst- und Zweitsprache, die phonologischen Prozesse im Deutsch-Erwerb und die phonologische Entwicklung in der Zweitsprache Deutsch. Kapitel 9 befasst sich mit der Methodenkritik der Studie und Kapitel 10 gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Zweisprachigkeit, phonologische Entwicklung, sukzessiver Spracherwerb, Deutsch als Zweitsprache, serbische Vorschulkinder, kontrastive Analyse, Phonemsystem, quantitative Analyse, qualitative Analyse, Längsschnittstudie, Interdependenz, phonologische Prozesse.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickeln serbische Kinder das deutsche Lautsystem?
Die Arbeit untersucht die phonologisch-phonetische Entwicklung serbischer Vorschulkinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, unter Berücksichtigung von Einflüssen ihrer Erstsprache.
Was besagt die Interdependenz-Hypothese beim Spracherwerb?
Sie geht davon aus, dass die Entwicklung der Zweitsprache (L2) von der Kompetenz und dem Entwicklungsstand in der Erstsprache (L1) abhängt.
Welche Unterschiede gibt es zwischen dem serbischen und deutschen Konsonantensystem?
Die Arbeit bietet eine kontrastive Analyse beider Systeme, um typische Fehlerquellen und Erwerbsmechanismen beim Erlernen des deutschen Lautsystems zu identifizieren.
Welche Diagnostikmaterialien wurden in der Studie verwendet?
Es wurde ein Screening-Verfahren zur Ausspracheuntersuchung (SVA) sowie eine eigens erstellte serbische Variante dieses Verfahrens eingesetzt.
Was ist das Ziel dieser Längsschnittstudie?
Ziel ist es, Grundlagenforschung für die Sprachheilpädagogik zu leisten, um fundierte didaktische und therapeutische Konzepte für zweisprachige Kinder zu rechtfertigen.
- Quote paper
- Anja Pfaff (Author), 2003, Empirische Längsschnittstudie zur phonologischen Entwicklung bei sukzessiver Zweisprachigkeit von serbischen Vorschulkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16004