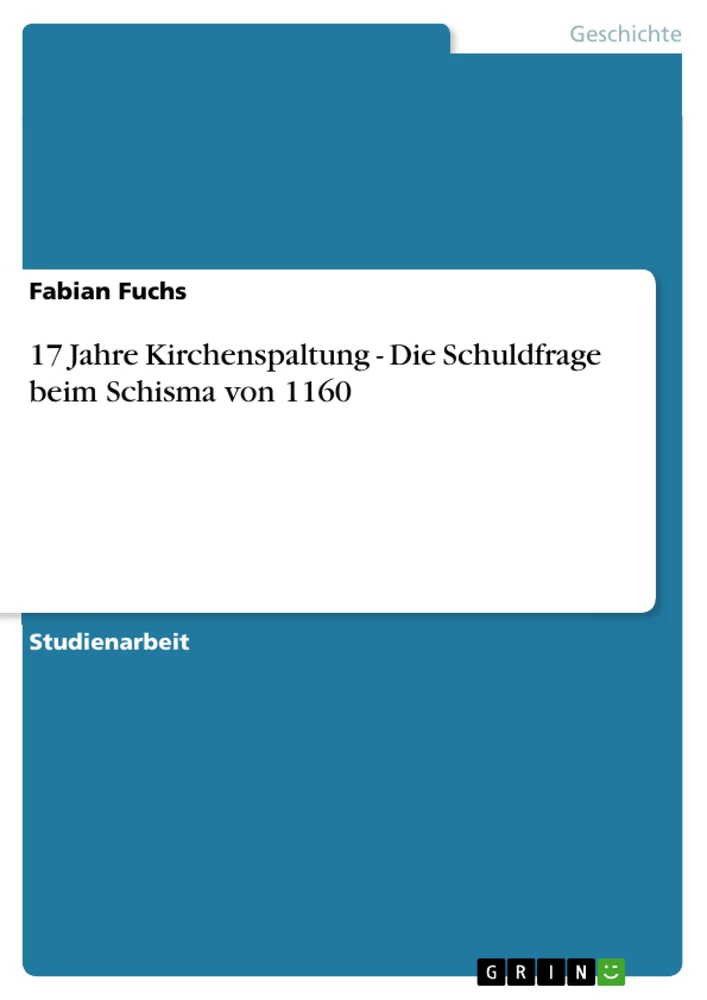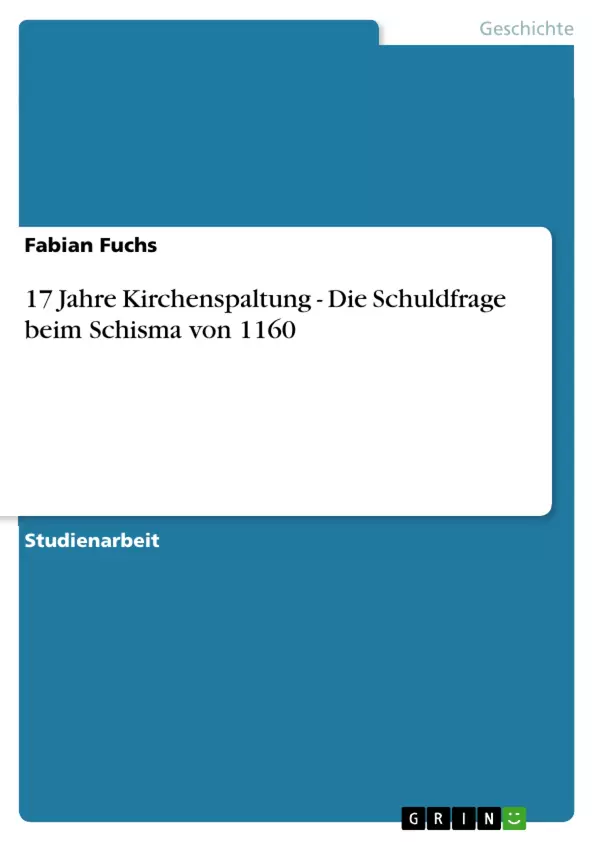Die vorliegende Hausarbeit soll klären, ob dem Kaisertum, in Gestalt von Kaiser Friedrich I. Barbarossa, oder der Kurie, in Person von Papst Hadrian IV., die überwiegende Schuld am Schisma von 1160 zuzurechnen ist. Die Kirchenspaltung, die ein gesamteuropäisches
Phänomen darstellte und das Abendland 17 Jahre lang, bis zum Frieden von Venedig 1177, prägte, hat ihren Ausbruch durch die zwiespältige Papstwahl des Jahres 1159 erfahren, die Wurzeln für das Schisma reichen jedoch tiefer in die Vergangenheit zurück.
Auf Basis des Konstanzer Vertrages von 1153, der die Beziehungen von Papsttum und Kaisertum definierte, wird in chronologischer Reihenfolge die Ausführung (oder Nichtausführung) der jeweiligen Vertragspunkte seitens der Heiligen Stuhls und des Kaisers aufgezeigt. Weiterhin werden dann Konfliktsituationen zwischen Friedrich Barbarossa und der Kurie bis zur Doppelwahl von 1159 und der Synode von Pavia 1160, mit der die Kirchenspaltung ihren Anfang nimmt, aufgezeigt und kritisch betrachtet.
In der Schlussfolgerung wird schließlich aus den beleuchteten Ereignissen zusammengefasst,
welcher Partei die Hauptschuld am Schisma zuzusprechen ist (oder ob es überhaupt auf eine Partei vollständig abgewälzt werden kann).
Als Hauptquelle wurde die Gesta Friderici des Otto von Freising, der Chronist Friedrich Barbarossas, herangezogen. Da Friedrich der Neffe Ottos war und er ihm diverse Passagen diktiert hat, ist die Authenzität und Neutralität der Quelle nicht immer gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Vertrag von Konstanz
- Friedrichs erster Italienzug
- Die Kaiserkrönung
- Der Normannenfeldzug
- Der Vertrag von Benevent
- Ereignisse bis zur Doppelwahl 1159
- Der Eklat von Besancon
- Weitere Ereignisse
- Die Doppelwahl und das Konzil von Pavia
- Schlussbetrachtung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Schuldfrage am Schisma von 1160, welches Kaiser Friedrich I. Barbarossa und Papst Hadrian IV. in einen Konflikt brachte. Sie analysiert die Ereignisse, die zur Kirchenspaltung führten, und hinterfragt, ob dem Kaisertum oder der Kurie die Hauptverantwortung zuzuschreiben ist. Die Arbeit beleuchtet den Konstanzer Vertrag von 1153 als Ausgangspunkt und verfolgt die Entwicklung der Beziehungen zwischen Papsttum und Kaisertum in chronologischer Reihenfolge.
- Der Konstanzer Vertrag und seine Implementierung
- Die Rolle von Friedrich Barbarossa und Papst Hadrian IV. in der Entstehung des Schismas
- Konfliktsituationen zwischen Kaisertum und Kurie bis zur Doppelwahl von 1159
- Die Synode von Pavia und der Beginn der Kirchenspaltung
- Die Frage der Schuldverteilung am Schisma
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor und erläutert den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen der Untersuchung. Das zweite Kapitel widmet sich dem Konstanzer Vertrag von 1153, welcher die Beziehungen von Kaisertum und Papsttum regelte. Kapitel 3 analysiert den ersten Italienzug Friedrichs Barbarossas, inklusive der Kaiserkrönung und des Normannenfeldzugs. Der Vertrag von Benevent wird in Kapitel 4 beleuchtet. Kapitel 5 behandelt die Ereignisse, die bis zur Doppelwahl von 1159 führten, darunter der Eklat von Besancon und weitere Konfliktsituationen. Kapitel 6 beschreibt die Doppelwahl und das Konzil von Pavia, welches die Kirchenspaltung einleitete.
Schlüsselwörter
Schisma von 1160, Friedrich I. Barbarossa, Papst Hadrian IV., Konstanzer Vertrag, Kaiserkrönung, Normannenfeldzug, Doppelwahl, Synode von Pavia, Kirchenspaltung, Beziehungen von Papsttum und Kaisertum, politische Orientierung.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Schisma von 1160?
Eine 17 Jahre dauernde Kirchenspaltung, ausgelöst durch eine Doppelwahl zweier Päpste (Alexander III. und Viktor IV.) im Jahr 1159.
Welche Rolle spielte Friedrich Barbarossa?
Kaiser Friedrich I. Barbarossa unterstützte den kaisertreuen Gegenpapst Viktor IV., um seinen Einfluss auf die Kirche und Italien zu sichern.
Was war der Vertrag von Konstanz (1153)?
Ein Abkommen zwischen Kaiser und Papst, das gegenseitige Unterstützung gegen Feinde (wie die Normannen) zusicherte, aber später zum Streitpunkt wurde.
Was geschah beim Eklat von Besançon?
Ein diplomatischer Streit, bei dem der päpstliche Legat andeutete, das Kaisertum sei ein päpstliches Lehen (beneficium), was den Kaiser erzürnte.
Wie endete die Kirchenspaltung?
Das Schisma endete 1177 mit dem Frieden von Venedig, in dem Barbarossa Alexander III. als rechtmäßigen Papst anerkannte.
- Quote paper
- Fabian Fuchs (Author), 2008, 17 Jahre Kirchenspaltung - Die Schuldfrage beim Schisma von 1160, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160040