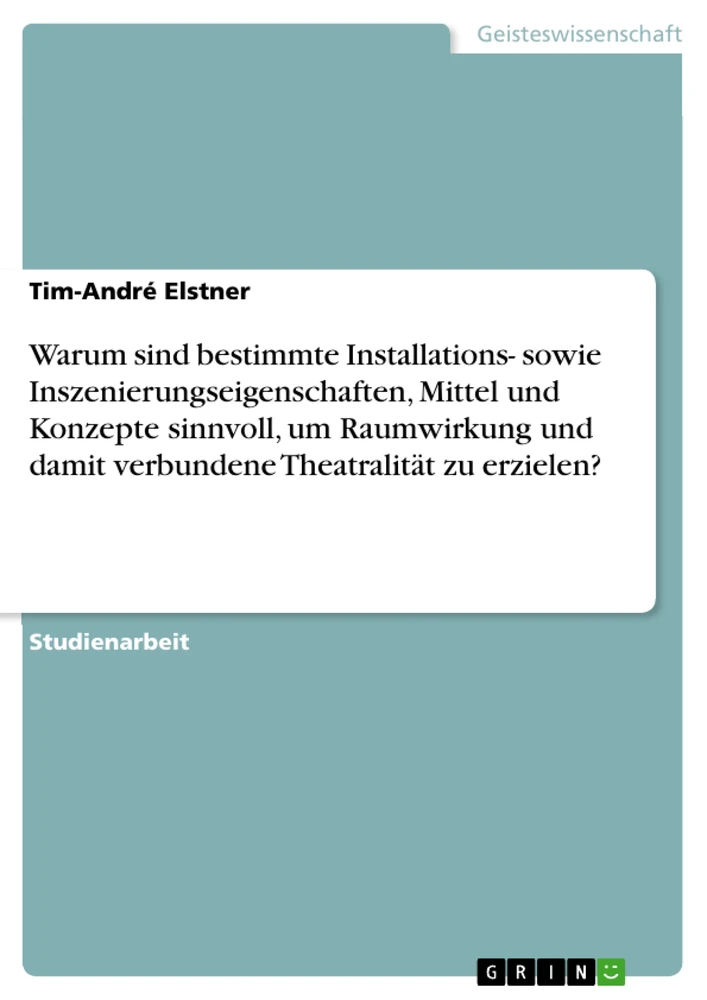[...] Überraschungen und Unvorhergesehenes geschehen nicht installiert, inszeniert und mit weiser Voraussicht oder Absicht. Der gemeine Alltag ist zwar häufig durchstrukturiert, normiert und regelmäßig, doch obliegt er dennoch auch und genauso dem Schicksal, Zufall und kleinen Wunder der magischen und mystischen kleinen wie großen Vorkommnissen an Augenblicken der Gegenwart, die sich (noch) jeder wissenschaftlichen Erklärung entziehen. Hieran ansetzend, finden sich parallelisiert Theater, Film und auch Aktionen eines Joseph Beuys wieder. Jene Macher, Drehbuchautoren, Regisseure und Performer sind es, die wieder aufmerksam machen auf Träume und Alpträume des Alltags. Zeigen Besonderheiten des Raumes bzw. sein Zusammenwirken von Objekten und Zwischenmenschlichkeiten in Räumen auf. Ohne jede Berührungsangst, aber sensitiv darauf achtend und Acht gebend, wie besonders Kleinigkeiten im sozialen Miteinander sein können, wenn es gelingt (wieder) ein Gespür dafür zu entwickeln, dass ein friedliches Miteinander nicht selbstverständlich sei und wie liebenswert und intensiv Beziehungen wachsen können, die es zu schützen und pflegen gilt, hinsichtlich einer geduldigen und langfristigen „Raumpflege“. Rauminstallationen, Bühnenräume und performative Akte aber, sind nicht auf Langfristigkeit ausgelegt. Sie bauen auf den kurzfristigen aber sich langwierig ausdehnenden „theatralischen und magischen“ Moment. Mit dem Effekt, auf etwas aufmerksam zu machen, was wir aus dem normalen, banalen und alltäglich-trivialen Gemeinsinn kennen, also ein allgemein bekanntes Gefühl innerhalb der Subjekte ans Tageslicht zu fördern. Einerseits um zu unterhalten und ein Gefühl der gemeinsamen Erfahrung mit der damit verbundenen erleichterten Orientierung im auf sich selbst allein gestellten Alltag hervorzurufen, aber auch um eine Wirkung der Veränderung im sensitiven Miteinander zu formen. So zeigt der banale Alltag, mit seinen Räumen wie z.B. in einem Zugabteil, in Kleinigkeiten auf, was das Theater im Großen und Essentiell vormacht. Wir können uns also darin wieder finden, wenn das Theater oder die Performance unser eigenes und menschliches Versagen widerspiegelt. Sodass wir uns mit unserer Unzulänglichkeit weniger allein fühlen, sondern regressiv erkennen, was falsch gelaufen sein könnte, um es zukünftig besser oder anders zu machen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zur Raumordnung: Beziehungen und Bedingungen von Inneren/Äußeren, Subjekten/Objekten, Veranschaulichungen/Vorstellungen als Notwendigkeiten zum Gelingen eines Raumes und dessen Nutzbarkeit
- 2. Wie wirken Räume? Installations- sowie Insenzierungseigenschaften; ihre Ästhetik, Aisthesis, Aura und interdependente Manipulation von Machern und Betrachtern hinsichtlich einer Implementierung von‚einheitlichen' Sinneserfahrungen - einer gemeinsam zu erfahrenden Illusion bzw. Seinserfahrung
- 3. Schamanistische und séancenhafte Implementierung eigener Ideen, Interpretationen und Erfahrungen, auf das teilnehmende bzw. beobachtend wahrnehmende Publikum, mittels expressiver und theatraler Performancekunst im Rahmen der Schauspielerei und Theaterbühne bzw. Oberfläche. Das Theater als geeigneter Frei- und Kunstraum, zur absoluten Extrovertierung.
- [Idee, Beuysscher' Performance, Selbstinszenierungs-/ und installationskunst: Theatrale Aktionen unter Joseph Beuys', wie unter anderen die der ,, Titus Andronicus/ Iphigenie\", 1969; und der Aktion,,Coyote; I like America and America likes me``, 1974]
- 4. Warum aber sind bestimmte Installations- sowie Inszenierungseigenschaften, Mittel und Konzepte, resümierend, nun sinnvoll, um Raumwirkung und damit verbundene Theatralität zu erzielen? Warum sind es in aller Regel nicht Räume des öffentlichen Alltags, die theatrale Wirkung hinterlassen, obwohl sich auch hier faszinierende und erschreckende Schauspiele abspielen; wo liegen Unterschiede der beiden Dimensionen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Raumgestaltung und Inszenierungselementen im Theater, um die Erzeugung von Raumwirkung und Theatralität zu verstehen. Sie betrachtet die Zusammenhänge zwischen Innen- und Außenräumen, Subjekten und Objekten sowie Veranschaulichungen und Vorstellungen, um die Bedingungen für ein gelungenes Theatererlebnis zu analysieren.
- Die Rolle von Raumkonzepten in der Kunst im Vergleich zu Naturräumen
- Der Einfluss von Inszenierungs- und Installationselementen auf die Raumwirkung
- Die Bedeutung von Theatralität und Performancekunst für das Publikumserlebnis
- Die Unterschiede zwischen theatralen und alltäglichen Räumen
- Die Interaktion zwischen Subjekten, Objekten und Raum in der Theaterinszenierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die grundlegenden Beziehungen und Bedingungen von Raum, indem es die Unterscheidung zwischen Naturräumen und Kunsträumen sowie die Rolle von Subjekten und Objekten im Raum analysiert. Das zweite Kapitel widmet sich der Wirkung von Installationen und Inszenierungselementen auf die Wahrnehmung des Publikums und die Gestaltung von Raumillusionen. Im dritten Kapitel wird die Rolle von theatraler Performancekunst im Rahmen der Schauspielerei und Theaterbühne untersucht, wobei die besondere Bedeutung des Theaters als Raum der Extrovertierung hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Raumordnung, Theatralität, Inszenierung, Performancekunst, Raumwirkung, Installation, Subjekt, Objekt, Veranschaulichung, Vorstellung, Illusion, Aura, Interdependenz, Kunst, Natur, Theaterbühne,
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Raumwirkung in der Theaterkunst erzeugt?
Raumwirkung entsteht durch das gezielte Zusammenspiel von Installationen, Licht, Objekten und der Interaktion zwischen Subjekten im Bühnenraum.
Was unterscheidet Kunsträume von alltäglichen Räumen?
Kunsträume sind auf den kurzfristigen, "magischen" Moment der Inszenierung ausgelegt, während Alltagsräume meist funktional und langfristig strukturiert sind.
Welchen Beitrag leistete Joseph Beuys zur Performancekunst?
Beuys nutzte theatrale Aktionen (wie "Coyote"), um durch expressive Selbstinszenierung gesellschaftliche und spirituelle Themen in den Kunstraum zu bringen.
Was bedeutet "Theatralität" im Kontext der Raumgestaltung?
Theatralität bezeichnet die bewusste Inszenierung von Wirklichkeit, die beim Betrachter eine einheitliche Sinneserfahrung oder Illusion hervorruft.
Warum fühlen wir uns im Theater oft weniger allein mit Unzulänglichkeiten?
Weil das Theater menschliches Versagen widerspiegelt, was es dem Zuschauer ermöglicht, eigene Fehler regressiv zu erkennen und sich mit der gemeinsamen Erfahrung zu identifizieren.
- Quote paper
- Tim-André Elstner (Author), 2010, Warum sind bestimmte Installations- sowie Inszenierungseigenschaften, Mittel und Konzepte sinnvoll, um Raumwirkung und damit verbundene Theatralität zu erzielen? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160053