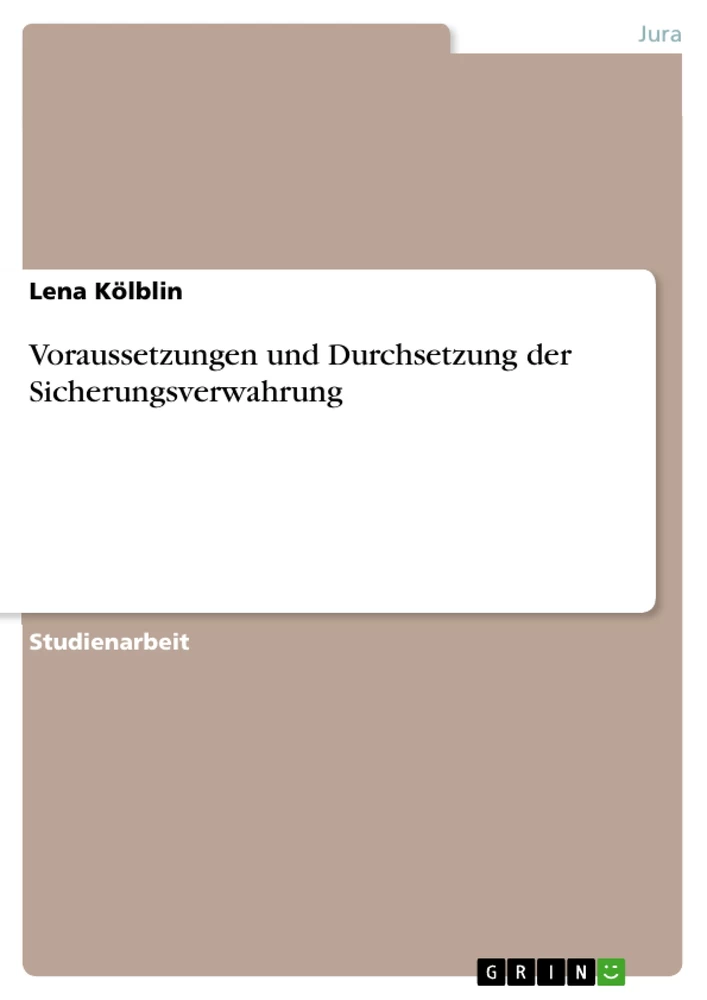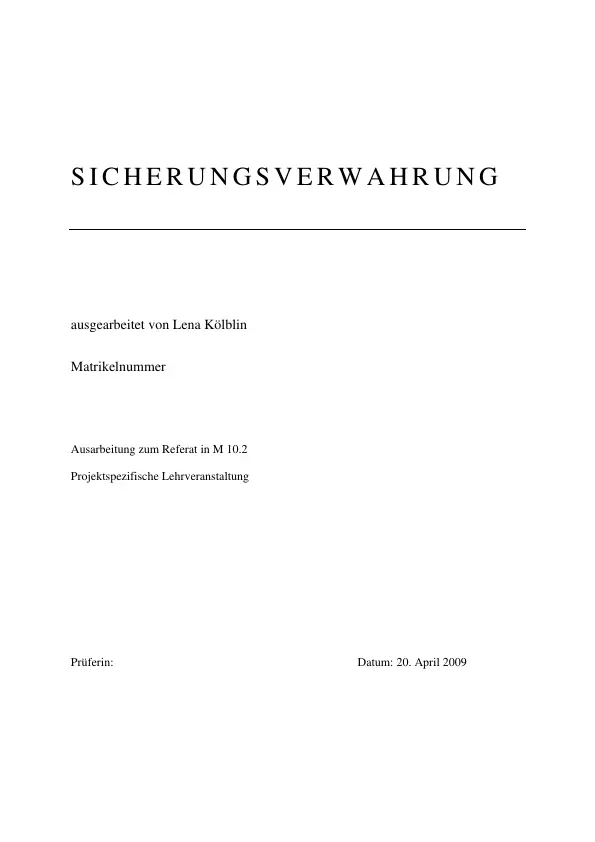§ 129 StVollzG: Ziel der Unterbringung
„Der Sicherungsverwahrte wird zum Schutz der Allgemeinheit sicher untergebracht. Ihm soll geholfen werden, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern.“
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Ziel
- Kapitel 2: Betroffener Personenkreis
- Kapitel 3: Voraussetzungen
- Kapitel 4: Vollzug
- Kapitel 5: Statistik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sicherungsverwahrung im deutschen Recht. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen, den betroffenen Personenkreis, die Voraussetzungen für die Anordnung und den Vollzug der Sicherungsverwahrung darzustellen.
- Rechtliche Grundlagen der Sicherungsverwahrung
- Betroffener Personenkreis (Erwachsene, Heranwachsende, Jugendliche)
- Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung
- Vollzug der Sicherungsverwahrung und dessen Dauer
- Statistische Daten zur Sicherungsverwahrung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Ziel: Dieses Kapitel erläutert das Ziel der Sicherungsverwahrung gemäß § 129 StVollzG. Es dient dem Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern und soll gleichzeitig deren Resozialisierung fördern. Die Sicherungsverwahrung ist somit eine Maßregel der Sicherung und Besserung, die nach Verbüßung der eigentlichen Haftstrafe angewendet wird. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen Schutz der Gesellschaft und der Möglichkeit der Wiedereingliederung des Straftäters.
Kapitel 2: Betroffener Personenkreis: Dieses Kapitel beschreibt, welche Personengruppen von der Sicherungsverwahrung betroffen sein können. Es umfasst Erwachsene ab 21 Jahren, Heranwachsende (18-21 Jahre) und Jugendliche ab 14 Jahren. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 62 StGB) wird betont, der die Beziehung zwischen der begangenen Straftat und der vom Täter ausgehenden Gefahr berücksichtigt. Auch schuldunfähige Personen können unter bestimmten Voraussetzungen nach einer psychiatrischen Unterbringung einer Sicherungsverwahrung zugeführt werden. Kinder unter 14 Jahren sind strafunmündig und von der Sicherungsverwahrung ausgeschlossen.
Kapitel 3: Voraussetzungen: Dieses Kapitel detailliert die Voraussetzungen für die Anordnung einer Sicherungsverwahrung nach §§ 66, 66a und 66b StGB. Es unterscheidet zwischen der Anordnung im Urteil (§ 66 StGB), dem Vorbehalt der Unterbringung (§ 66a StGB) und der nachträglichen Anordnung (§ 66b StGB). § 66 StGB beschreibt die Voraussetzungen, wie z.B. Verurteilung zu mindestens zwei Jahren Haft für eine Tat mit körperlicher oder seelischer Schädigung des Opfers und vorherige Verurteilungen zu Freiheitsstrafen. § 66a StGB regelt den Vorbehalt, der eine erneute Überprüfung vor Ende der Haftstrafe beinhaltet. § 66b StGB behandelt die nachträgliche Anordnung aufgrund neuer Tatsachen und einer weiterhin bestehenden Gefahr für die Allgemeinheit. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Szenarien und die strengen Kriterien für die Anordnung einer Sicherungsverwahrung.
Kapitel 4: Vollzug: In diesem Kapitel wird der Vollzug der Sicherungsverwahrung behandelt. Der Vollzug ist grundsätzlich unbefristet, jedoch sieht § 67d StGB nach zehn Jahren eine Überprüfung vor. Die Dauer der Sicherungsverwahrung hängt von der Gefährlichkeit des Straftäters ab und kann im Extremfall lebenslang sein, obwohl dies statistisch eher selten vorkommt. Der Text verweist auf die geringe Anzahl an lebenslangen Freiheitsstrafen.
Schlüsselwörter
Sicherungsverwahrung, Strafrecht, Resozialisierung, Gefährlichkeit, Schutz der Allgemeinheit, § 66 StGB, § 66a StGB, § 66b StGB, Vollzug, Jugendstrafrecht, Verhältnismäßigkeit, Sozialprognose.
Sicherungsverwahrung im deutschen Recht: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Sicherungsverwahrung im deutschen Recht. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen, den betroffenen Personenkreis, die Voraussetzungen für die Anordnung, den Vollzug und statistische Daten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Ziel), Kapitel 2 (Betroffener Personenkreis), Kapitel 3 (Voraussetzungen), Kapitel 4 (Vollzug) und Kapitel 5 (Statistik).
Was ist das Ziel der Sicherungsverwahrung?
Das Ziel der Sicherungsverwahrung (gemäß § 129 StVollzG) ist der Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern und gleichzeitig die Förderung deren Resozialisierung. Es handelt sich um eine Maßregel der Sicherung und Besserung nach Verbüßung der eigentlichen Haftstrafe.
Wer ist von der Sicherungsverwahrung betroffen?
Betroffen sein können Erwachsene ab 21 Jahren, Heranwachsende (18-21 Jahre) und Jugendliche ab 14 Jahren. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 62 StGB) spielt eine entscheidende Rolle. Schuldunfähige Personen können unter bestimmten Voraussetzungen nach psychiatrischer Unterbringung in Sicherungsverwahrung kommen. Kinder unter 14 Jahren sind ausgeschlossen.
Welche Voraussetzungen müssen für eine Anordnung der Sicherungsverwahrung erfüllt sein?
Die Voraussetzungen werden in §§ 66, 66a und 66b StGB geregelt. § 66 StGB behandelt die Anordnung im Urteil (z.B. Verurteilung zu mindestens zwei Jahren Haft für eine Tat mit körperlicher oder seelischer Schädigung und vorherige Freiheitsstrafen). § 66a StGB regelt den Vorbehalt der Unterbringung, § 66b StGB die nachträgliche Anordnung aufgrund neuer Tatsachen und anhaltender Gefahr.
Wie läuft der Vollzug der Sicherungsverwahrung ab?
Der Vollzug ist grundsätzlich unbefristet, jedoch sieht § 67d StGB nach zehn Jahren eine Überprüfung vor. Die Dauer hängt von der Gefährlichkeit des Straftäters ab und kann im Extremfall lebenslang sein, ist aber statistisch eher selten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Sicherungsverwahrung, Strafrecht, Resozialisierung, Gefährlichkeit, Schutz der Allgemeinheit, § 66 StGB, § 66a StGB, § 66b StGB, Vollzug, Jugendstrafrecht, Verhältnismäßigkeit, Sozialprognose.
Wo finde ich statistische Daten zur Sicherungsverwahrung?
Die Arbeit erwähnt, dass statistische Daten zur Sicherungsverwahrung in einem eigenen Kapitel (Kapitel 5) behandelt werden. Konkrete Quellen oder Zahlen werden im gegebenen Auszug nicht genannt.
- Quote paper
- Lena Kölblin (Author), 2009, Voraussetzungen und Durchsetzung der Sicherungsverwahrung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160060