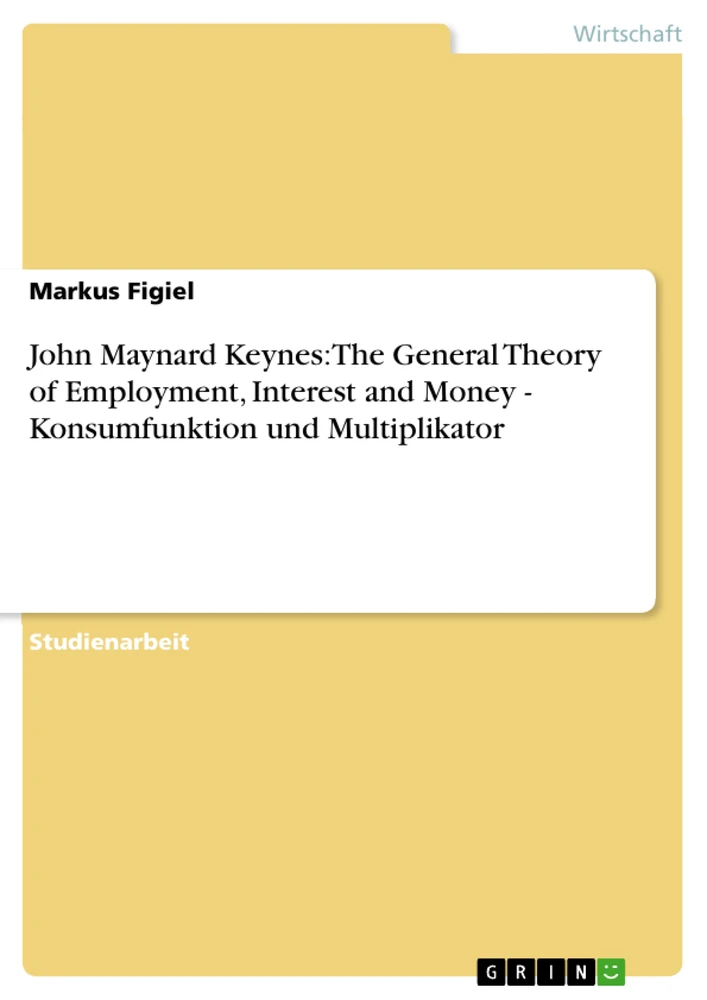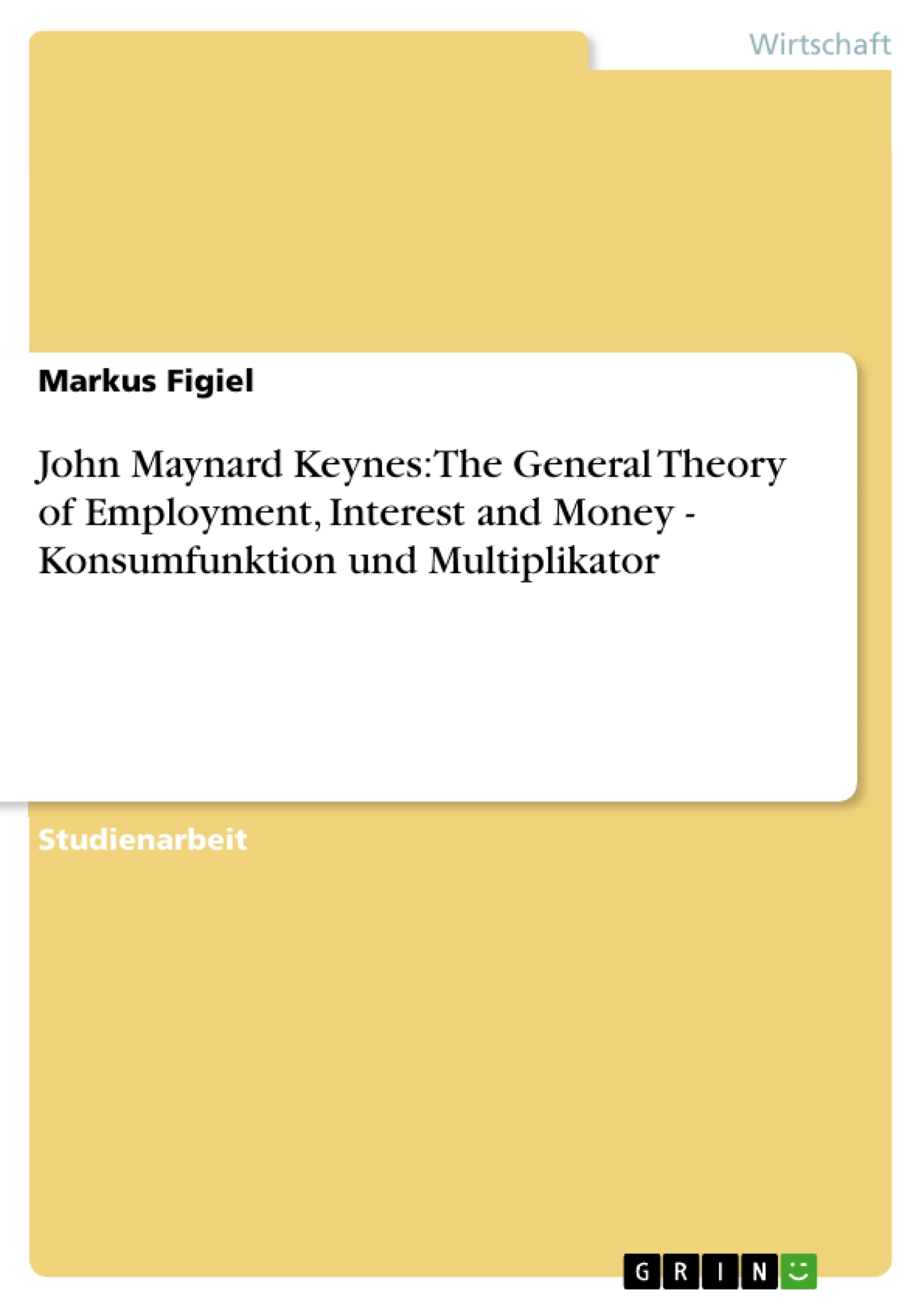Am 24. Oktober 1929, dem sogenannten "Schwarzen Freitag" brach die New Yorker Börse zusammen. Dieser folgenschwere Tag war der Beginn der "Great Depression", die den historischen Hintergrund für die "General Theory of Employment, Interest and Money" von John Maynard Keynes legte. Die Great Depression beherrschte die Jahre 1929 bis 1933, in denen die weltweite Produktion massiv einbrach und Arbeitslosigkeit ein kollektives Phänomen war. Die damals vorherrschende ökonomische Theorie der Klassiker vertraute auf die selbststabilisierenden Kräfte der Wirtschaft und propagierte Enthaltsamkeit seitens der Politik. Nach, der damals dominierenden Meinung der Klassiker, würden sinkende Löhne und Preise eine Gegentendenz auslösen, die letztendlich die Wirtschaft wieder in ihr Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung bringt. Diese Voraussetzungen waren in der Weltwirtschaftskrise erfüllt, Preise und Löhne sanken im großen Umfang, jedoch war eine Tendenz zur Rückkehr zur Vollbeschäftigung nicht erkennbar. Keynes folgerte vor diesem Hintergrund, dass sich die in einer Krise automatisch ausgelöste Tendenz zur Rückkehr zum Gleichgewicht, wenn überhaupt vorhanden, nur sehr langsam und "schmerzhaft" vollzog. Dies verlangte, laut Keynes, nach einer neuen Theorie, die die wahren Gründe der Arbeitslosigkeit beschrieb und zugleich den Weg aus der Krise aufzeigte. Keynes leitendes Interesse bestand darin eine Theorie zu entwickeln, welche die Realität der Krise abbildete und der Wirtschaftspolitik praktische Ratschläge lieferte, wie eine Krise bewältigt werden konnte. Diese Arbeit widmet sich zwei zentralen Gegenständen der "General Theory", nämlich dem Konsum und dem Multiplikator.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG.
- DIE KONSUMNEIGUNG..
- Bedeutung in Bezug auf die effektive Nachfrage und die Beschäftigung ..
- Die objektiven Einflussfaktoren.........
- Die subjektiven Einflussfaktoren
- DER MULITPLIKATOR.
- Entwicklung der Multiplikatortheorie ..
- Die marginale Konsumneigung und der Multiplikator nach Keynes......
- Probleme und Kritik im Hinblick auf die Multiplikatortheorie .
- FAZIT..
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Bedeutung des Konsums und des Multiplikators im Rahmen der "General Theory of Employment, Interest and Money" von John Maynard Keynes. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die zentralen Elemente der keynesianischen Theorie in Bezug auf Konsumverhalten und dessen Einfluss auf die effektive Nachfrage und die Beschäftigung zu beleuchten. Dabei wird auch die Kritik an der keynesianischen Konsum- und Multiplikatortheorie diskutiert.
- Die Konsumneigung und ihre Determinanten
- Die Rolle des Konsums für die effektive Nachfrage und die Beschäftigung
- Die Multiplikatortheorie und ihre Entstehung
- Die Kritik an der keynesianischen Konsum- und Multiplikatortheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 befasst sich mit der Konsumneigung und ihren Einflussfaktoren. Es wird die Bedeutung des Konsums für die effektive Nachfrage und die Beschäftigung in einer Volkswirtschaft erläutert. Hierbei werden sowohl objektive Faktoren wie die Höhe des Einkommens, das Verhältnis zwischen Nominal- und Reallohn sowie unvorhersehbare Vermögensänderungen betrachtet, als auch subjektive Faktoren, die das Konsumverhalten beeinflussen.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Multiplikatortheorie. Zunächst wird die Entstehung der Theorie beleuchtet. Es folgt eine Darstellung des Multiplikators nach Keynes, der den Zusammenhang zwischen zusätzlichen Ausgaben und der daraus resultierenden Steigerung des Gesamteinkommens beschreibt. Abschließend werden Probleme und Kritik an der keynesianischen Konsum- und Multiplikatortheorie diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Konsumneigung, effektive Nachfrage, Beschäftigung, Multiplikator, Keynesianismus, Great Depression, marginale Konsumneigung.
Häufig gestellte Fragen
Was war der historische Hintergrund von Keynes' "General Theory"?
Der Hintergrund war die "Great Depression" ab 1929, eine Phase massiver Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Einbruchs, die klassische Theorien nicht erklären konnten.
Was versteht Keynes unter der Konsumneigung?
Die Konsumneigung beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Einkommen und den Konsumausgaben einer Volkswirtschaft.
Wie funktioniert der Multiplikatoreffekt?
Der Multiplikator beschreibt, wie zusätzliche Ausgaben (z.B. durch den Staat) zu einer überproportionalen Steigerung des Gesamteinkommens führen.
Warum kritisierte Keynes die klassischen Ökonomen?
Er bestritt, dass sinkende Löhne und Preise automatisch zur Vollbeschäftigung führen, und forderte stattdessen staatliche Eingriffe zur Stärkung der Nachfrage.
Welche Faktoren beeinflussen laut dieser Arbeit den Konsum?
Es wird zwischen objektiven Faktoren (wie Einkommenshöhe) und subjektiven Faktoren (psychologische Motive) unterschieden.
- Quote paper
- Markus Figiel (Author), 2010, John Maynard Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money - Konsumfunktion und Multiplikator, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160111