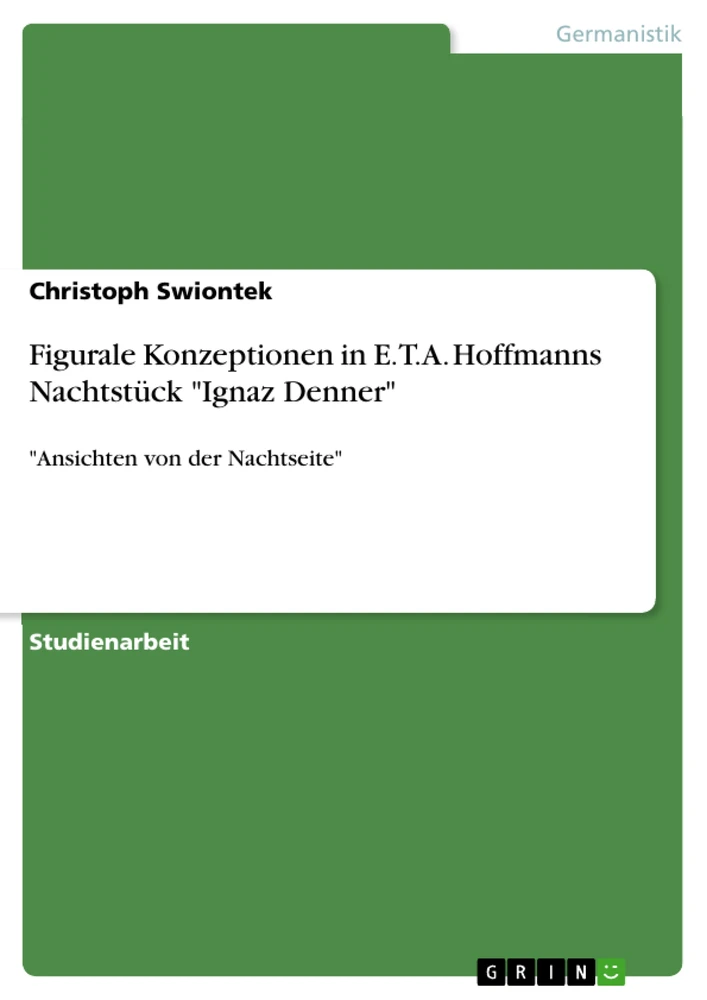Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns Nachtstücke1 werden 1816 und 1817 von der Realschulbuchhandlung in Berlin veröffentlicht. Hatte die zeitgenössische Literaturkritik Hoffmanns Fantasiestücke in Callot’s Manier noch durchaus positiv aufgenommen, ist die Reaktion auf die Nachtstücke sehr viel verhaltener. So weist der einflussreiche schottische Schriftsteller Sir Walter Scott den Sandmann, der den Erzählband eröffnet, als im Opiumrausch entstandenes Machwerk zurück, das gegen jeden guten Geschmack verstoße, und Johann Wolfgang Goethe verurteilt die Nachtstücke als „krankhafte [...] Werke“ eines „leidenden Mannes“.
Auch die literaturwissenschaftliche Forschung hat die Bedeutung der Nachtstücke spät erkannt, doch die meisten der acht Geschichten waren und sind Gegenstand zahlreicher Arbeiten. Die selten beachtete Erzählung Ignaz Denner bildet in diesem Kontext eine große Ausnahme. So verurteilt beispielsweise der Hoffmann-Biograph Eckart Klessmann dieses zweite Nachtstück als „eine der schwächsten Geschichten Hoffmanns“. Wie kommt eine solche Einschätzung zustande? Renate Böschenstein sieht einen Grund in der „Textoberfläche, deren [...] transparente Struktur vom Kampf [...] des Göttlichen und des Teuflischen [...] beherrscht ist.“ Diese scheinbare Eindeutigkeit der Erzählung lässt sie womöglich als nicht-interpretationsbedürftig erscheinen.
Diese Arbeit soll nun der Frage nachgehen, ob sich Hoffmanns Geschichte vom frommen Revierjäger Andres und dem Räuberhauptmann und Kindermörder Ignaz Denner als Studie über die Zwiegespaltenheit des Menschen interpretieren lässt. Demnach ließe sich die These formulieren, dass Denner und Andres eine Einheit darstellen, in der sowohl die gute, als auch die schlechte Seite der menschlichen Seele repräsentiert sind. Um diese These zu unterstützen werde ich in einem ersten Schritt Textstellen analysieren, um das Verhältnis zwischen Ignaz Denner und Andres zu beleuchten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier der Konstruktion der auf mehreren Ebenen wirkenden engen gegenseitigen Bindung, die beide Figuren im Laufe der Handlung in immer größere Abhängigkeit treibt. Das zweite Kapitel soll die Erkenntnisse des Arztes und Philosophen Gotthilf Heinrich Schubert, dessen Werk Hoffmann gut kannte und unter anderem in den Elixieren des Teufels literarisch verarbeitete,8 in den Interpretationsvorgang einbeziehen. Abschließend werde ich auf den Geltungsradius einer solchen Interpretation eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung und Erläuterung der Vorgehensweise
- Das Verhältnis zwischen Ignaz Denner und Andres
- Die Konstruktion der ökonomischen Abhängigkeit
- Die Bindung Denners an Andres
- Die emotionale Verbindung zwischen Andres und Denner
- Denner und Andres als polarisierte Seelenteile einer Person
- Schubert und sein Einfluss auf das Werk Hoffmanns
- Denner und Andres: Eine komplexe Figur?
- Fazit und weitergehende Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Ignaz Denner“ als Studie über die Zwiegespaltenheit des Menschen interpretiert werden kann. Die These lautet, dass Denner und Andres eine Einheit darstellen, in der sowohl die gute als auch die schlechte Seite der menschlichen Seele repräsentiert sind.
- Die Konstruktion der ökonomischen Abhängigkeit zwischen Denner und Andres
- Die Bindung Denners an Andres
- Die emotionale Verbindung zwischen Andres und Denner
- Die Rolle von Schuberts Theorien in der Interpretation von „Ignaz Denner“
- Die komplexe Figurenzeichnung von Denner und Andres
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit der Einführung in die Thematik und erläutert die Vorgehensweise. Es werden zunächst die Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann sowie die Geschichte „Ignaz Denner“ im Kontext der Hoffmann-Forschung betrachtet.
Das zweite Kapitel analysiert das Verhältnis zwischen Ignaz Denner und Andres, wobei besonderes Augenmerk auf die Konstruktion der ökonomischen Abhängigkeit und die Bindung Denners an Andres gelegt wird. Des Weiteren wird die emotionale Verbindung zwischen den beiden Figuren untersucht.
Im dritten Kapitel werden Denner und Andres als polarisierte Seelenteile einer Person betrachtet. Dabei wird der Einfluss von Schuberts Theorien auf das Werk Hoffmanns beleuchtet. Abschließend wird die Frage diskutiert, ob Denner und Andres als eine komplexe Figur angesehen werden können.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: E.T.A. Hoffmann, „Ignaz Denner“, Nachtstücke, Zwiegespaltenheit, ökonomische Abhängigkeit, emotionale Verbindung, Schubert, komplexe Figur.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentrale These verfolgt die Arbeit zur Erzählung „Ignaz Denner“?
Die Arbeit untersucht, ob Denner und Andres als eine Einheit interpretiert werden können, die die gute und schlechte Seite der menschlichen Seele repräsentiert.
Wie wird die Beziehung zwischen Ignaz Denner und Andres charakterisiert?
Es wird eine enge Bindung analysiert, die auf ökonomischer Abhängigkeit, emotionaler Verbindung und einer sich steigernden gegenseitigen Abhängigkeit basiert.
Welchen Einfluss hatte Gotthilf Heinrich Schubert auf Hoffmann?
Schuberts Erkenntnisse über die Natur- und Seelenlehre beeinflussten Hoffmann maßgeblich bei der Darstellung psychologischer Grenzzustände und der menschlichen Zwiegespaltenheit.
Warum wurde „Ignaz Denner“ in der Forschung oft vernachlässigt?
Aufgrund ihrer scheinbar transparenten Struktur des Kampfes zwischen Gut und Böse wurde die Geschichte oft als weniger komplex oder interpretatationsbedürftig eingestuft.
Was sind E.T.A. Hoffmanns „Nachtstücke“?
Es handelt sich um einen 1816/1817 veröffentlichten Erzählband, der für seine düsteren, oft schaurigen und psychologisch tiefgründigen Geschichten bekannt ist.
Wie reagierte die zeitgenössische Kritik auf Hoffmanns Werk?
Prominente Zeitgenossen wie Sir Walter Scott oder Goethe lehnten die Werke oft als „krankhaft“ oder geschmacklos ab.
- Quote paper
- Christoph Swiontek (Author), 2008, Figurale Konzeptionen in E.T.A. Hoffmanns Nachtstück "Ignaz Denner", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160159