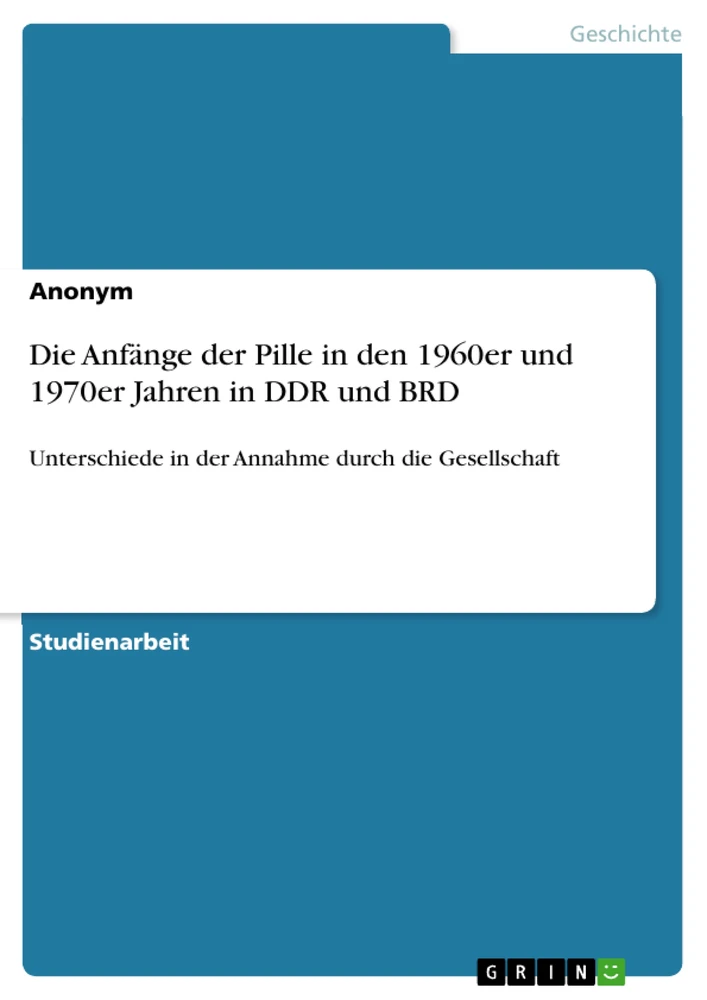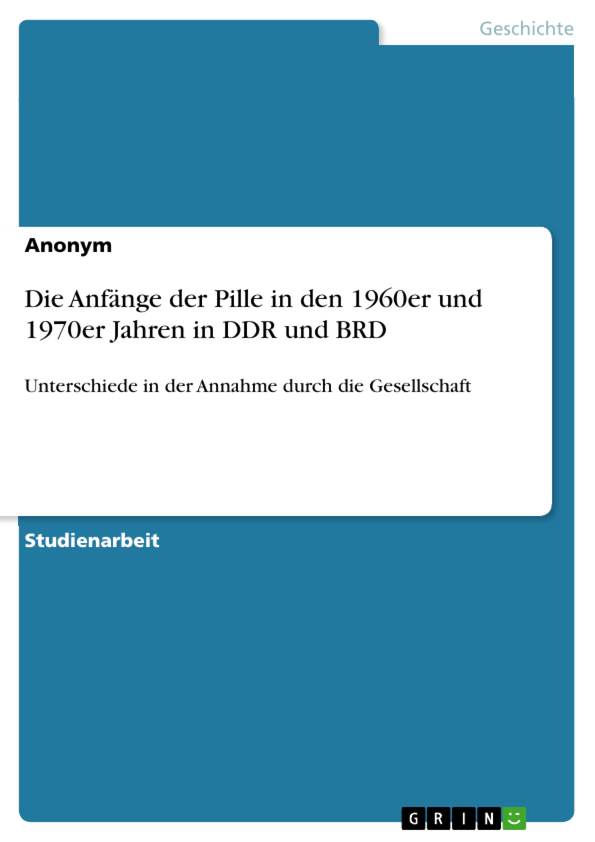Am 25. Juli 1968 veröffentlichte Papst Paul VI. seine Humanae vitae, deren Thema die Geburtenregelung war. Darin verwies er auf die Verwerflichkeit der Verhütung und bezeichnete jeglichen vorsätzlich unfruchtbar gemachten ehelichen Akt als unsittlich. Lediglich die natürlichen Mittel seien gerechtfertigt. Zu dieser Zeit war die Pille in der BRD seit sieben und in der DDR seit drei Jahren auf dem Markt. Die beiden Staaten, deren Bevölkerung, die Medien und selbst die einzelnen Pharmaunternehmen gingen unterschiedlich mit ihr um. Auch die Meinungen der ÄrztInnen unterschieden sich zum Teil erheblich. Bis die Pille zu einem der meist verwendeten Verhütungsmittel wurde, durchlief sie eine Vielzahl an Höhen und Tiefen. Doch wie sah das speziell in der BRD und der DDR aus? Die Geschichte des Präparates unterschied sich in den beiden Staaten in vielen Aspekten. Doch betrafen diese auch die Annahme durch die Gesellschaft? Dieser Frage wird im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschlechterbeziehungen und Frauenbild vor der Einführung der Pille
- BRD
- DDR
- Die Pille kommt auf den Markt
- Die Antibaby-Pille
- Die Wunschkindpille
- Reaktionen der Gesellschaft in BRD und DDR
- Quantitative Annahme der Pille
- Gründe der Ablehnung
- Faktoren der Entscheidung für die Pille
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die unterschiedliche gesellschaftliche Akzeptanz der Antibabypille in der BRD und der DDR während der 1960er und 1970er Jahre. Sie beleuchtet den Einfluss der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Kontexte auf die Verbreitung und Wahrnehmung der Pille. Die Arbeit untersucht, ob und wie sich die unterschiedlichen Wege der Einführung der Pille in den beiden deutschen Staaten auf die gesellschaftliche Akzeptanz auswirkten.
- Gesellschaftliche Akzeptanz der Pille in der BRD und DDR
- Unterschiedliche Einführungsstrategien der Pille in Ost und West
- Einfluss von Politik und Medien auf die Wahrnehmung der Pille
- Rollenbilder von Frauen in den 1960er und 1970er Jahren
- Gründe für die Akzeptanz und Ablehnung der Pille
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Unterschieden in der gesellschaftlichen Akzeptanz der Pille in der BRD und DDR in den 1960er und 70er Jahren. Sie betont die Relevanz des Themas angesichts der anhaltenden Debatte um Verhütung und skizziert den methodischen Ansatz, der sich auf die gesellschaftliche Perspektive konzentriert und die Rolle von Kirche, Politik und Medizin untergeordnet betrachtet. Die Arbeit basiert auf existierenden Forschungsarbeiten von Eva-Maria Silies, Annette Leo und Christian König, sowie Bernard Asbell, die unterschiedliche Aspekte der Pille in Ost und West beleuchten.
Geschlechterbeziehungen und Frauenbild vor der Einführung der Pille: Dieses Kapitel analysiert die Geschlechterrollen und das Frauenbild in der BRD und DDR vor der Einführung der Pille. In der BRD der 1950er und frühen 1960er Jahre dominierte ein konservatives Familienbild, das die Frau vor allem in der Rolle der Hausfrau und Mutter sah. Im Gegensatz dazu herrschte in den späten 1940er Jahren ein emanzipierteres Frauenbild, das jedoch mit dem Wiederaufbau und der Betonung der traditionellen Familie abnahm. Die mangelnde Aufklärung führte zu vielen illegalen Abtreibungen und Frühehen. Das Kapitel legt den Fokus auf den Wandel vom emanzipierten Frauenbild der Nachkriegszeit zum traditionelleren Bild der 1950er und 60er Jahre.
Die Pille kommt auf den Markt: Dieses Kapitel beschreibt die Markteinführung der Pille in beiden deutschen Staaten, wobei die unterschiedlichen Bezeichnungen „Antibaby-Pille“ (BRD) und „Wunschkindpille“ (DDR) als Ausdruck unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Strategien hervorgehoben werden. Die unterschiedlichen Bezeichnungen spiegeln die abweichenden Zielsetzungen wider: In der BRD war die Pille ein Mittel zur Selbstbestimmung der Frau, während sie in der DDR in den Kontext der staatlichen Geburtenpolitik eingebunden wurde.
Reaktionen der Gesellschaft in BRD und DDR: Der Kern der Arbeit liegt in diesem Kapitel. Es untersucht die quantitative Akzeptanz der Pille in Ost und West, analysiert die Gründe für Ablehnung und untersucht Faktoren, die die Entscheidung für oder gegen die Pille beeinflussten. Der Vergleich der Reaktionen soll die unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Kontexte aufzeigen und die Forschungsfrage beantworten. Es wird erwartet, dass hier die unterschiedlichen Strategien der Einführung der Pille und die jeweils vorherrschenden Frauenbilder deutlich werden.
Schlüsselwörter
Antibabypille, Wunschkindpille, DDR, BRD, 1960er Jahre, 1970er Jahre, Geschlechterrollen, Frauenbild, gesellschaftliche Akzeptanz, Verhütung, Geburtenkontrolle, Familienpolitik, Emanzipation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptinhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt die unterschiedliche gesellschaftliche Akzeptanz der Antibabypille in der BRD und der DDR während der 1960er und 1970er Jahre.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit untersucht die gesellschaftliche Akzeptanz der Pille in der BRD und DDR, die unterschiedlichen Einführungsstrategien der Pille in Ost und West, den Einfluss von Politik und Medien auf die Wahrnehmung der Pille, Rollenbilder von Frauen in den 1960er und 1970er Jahren sowie Gründe für die Akzeptanz und Ablehnung der Pille.
Welche Kapitel beinhaltet die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Geschlechterbeziehungen und Frauenbild vor der Einführung der Pille (mit Unterpunkten zu BRD und DDR), Die Pille kommt auf den Markt (mit Unterpunkten zur Antibaby-Pille und Wunschkindpille), Reaktionen der Gesellschaft in BRD und DDR (mit Unterpunkten zu quantitativer Annahme, Gründen der Ablehnung und Faktoren der Entscheidung für die Pille) und Fazit.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Unterschieden in der gesellschaftlichen Akzeptanz der Pille in der BRD und DDR in den 1960er und 70er Jahren vor. Sie betont die Relevanz des Themas und skizziert den methodischen Ansatz.
Wie unterschied sich das Frauenbild in BRD und DDR vor der Einführung der Pille?
In der BRD der 1950er und frühen 1960er Jahre dominierte ein konservatives Familienbild, das die Frau vor allem in der Rolle der Hausfrau und Mutter sah. In den späten 1940er Jahren herrschte in der DDR ein emanzipierteres Frauenbild, das jedoch mit dem Wiederaufbau abnahm.
Was bedeuten die unterschiedlichen Bezeichnungen "Antibaby-Pille" und "Wunschkindpille"?
Die unterschiedlichen Bezeichnungen spiegeln die abweichenden Zielsetzungen wider: In der BRD war die Pille ein Mittel zur Selbstbestimmung der Frau, während sie in der DDR in den Kontext der staatlichen Geburtenpolitik eingebunden wurde.
Welche Schlüsselwörter sind für die Hausarbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Antibabypille, Wunschkindpille, DDR, BRD, 1960er Jahre, 1970er Jahre, Geschlechterrollen, Frauenbild, gesellschaftliche Akzeptanz, Verhütung, Geburtenkontrolle, Familienpolitik, Emanzipation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Die Anfänge der Pille in den 1960er und 1970er Jahren in DDR und BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1602131