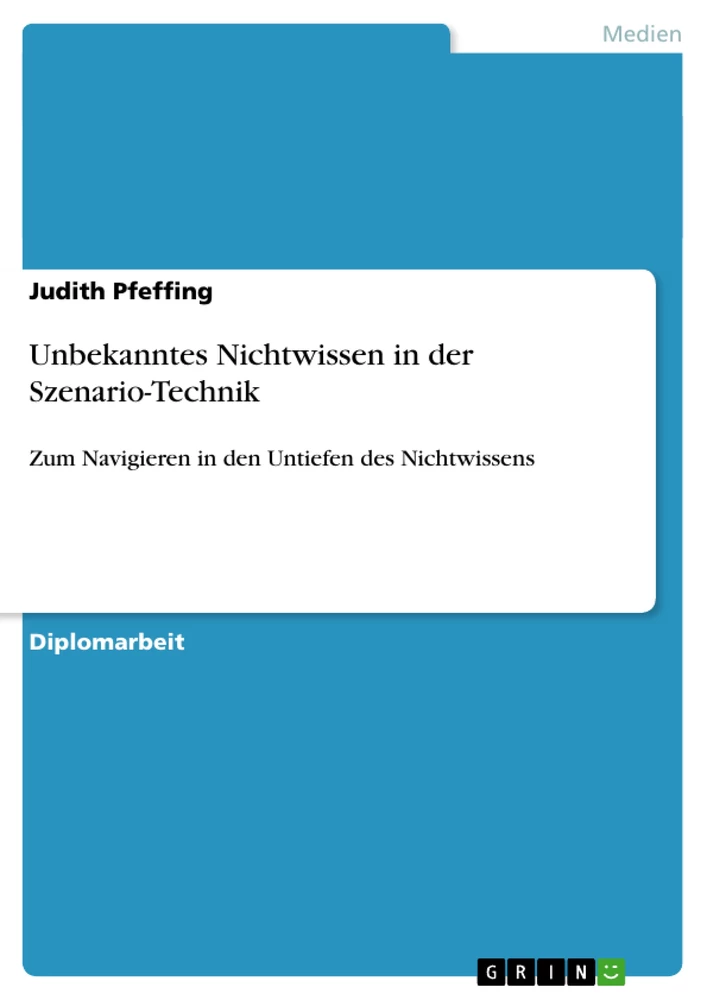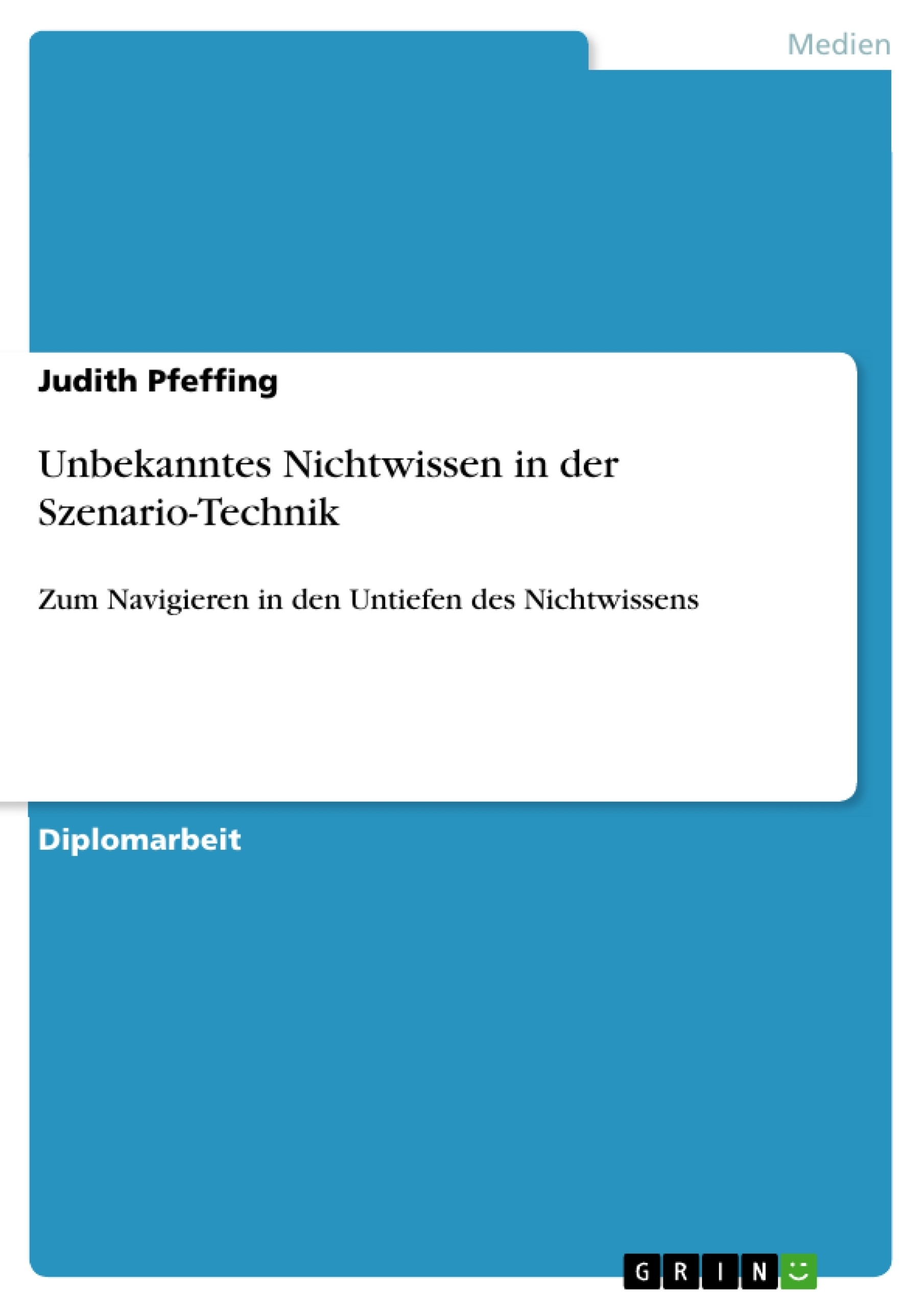Nicht zuletzt aufgrund unvorhersagbarer, Ressourcen verschlingender Umweltturbulenzen,
scheint auch mir die traditionelle Risikobetrachtung im Kontext eindeutiger Wissensproduk-
tion zunehmend unbefriedigend. Die Konsequenzen von Nichtwissen, von unbekanntem
Nichtwissen und/oder Nicht-Wissen-Wollen, in Form von Erschütterungen sind so offensicht-
lich, dass ich die Beschäftigung mit Nichtwissen für dringend notwendig halte.
Das Thema dieser Diplomarbeit ist daher Nichtwissen und unbekanntes Nichtwissen als eine
Ausprägung systemischen Nichtwissens.
Ausgehend von den beobachtbaren Erschütterungen in der Welt, wird im theoretischen Teil,
die allgemeine Präferenz von Wissen kritisch beleuchtet, um die praktischen Konsequenzen
dieser bevorzugten Perspektive darzulegen. Ziel der Arbeit ist die Gestaltung eines Reflexi-
onswerkzeugs für Entscheidungsprozesse in Unternehmen. Es sollte dynamisch, vital und
offen sein, dadurch intuitives, phantasievolles, ideenreiches Handeln erzeugen und zur
geistigen Freiheit anregen. Die beabsichtigte Erweiterung des Vorstellungshorizonts dient
dem Erkennen von Überraschungen, damit mögliche Schockwirkungen unerwarteter Ereig-
nisse milder ausfallen.
Der Mensch, als soziales Wesen, steht in meiner Ausarbeitung im Mittelpunkt.
Judith Pfeffing 52°29'42"N 13°25'22"E am 24.10.2010
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung – eine Feldskizze
- 2 Bezugsrahmen
- 2.1 Der Beobachter – eine Figur
- 2.1.1 Der „blinde Fleck“ des Beobachtenden
- 2.1.2 Die wissenschaftliche Beobachtung
- 2.1.3 Die Beobachtung des Neuen
- 2.2 Die Kybernetik – eine Erkenntnistheorie
- 2.2.1 Kybernetik zweiter Ordnung
- 2.2.2 Die Autopoiese – ein Konzept
- 2.3 Die „Laws of Form“ – ein Kalkül
- 2.1 Der Beobachter – eine Figur
- 3 Unbekanntes Nichtwissen – ein Phänomen
- 3.1 Daten – Informationen - Wissen
- 3.2 Die Organisation von Wissen und Nichtwissen
- 3.3 Wissenschaftliche Ansätze
- 3.4 Nichtwissensdimensionen
- 3.4.1 Wissen
- 3.4.2 Intentionalität
- 3.4.3 Zeitliche Stabilität
- 3.4.4 Erweiterungen
- 3.5 Nichtwissenskulturen
- 3.6 Vertrauen
- 4 Szenarien – eine qualitative Methode
- 4.1 Zukunftsforschung
- 4.2 Strategische Frühaufklärung
- 4.2.1 Qualitätskriterien
- 4.2.2 Trends und Trendforschende
- 4.2.3 Wild Cards
- 5 Kommunikation
- 5.1 Szenarien als Kommunikationsinstrument
- 5.2 Sprache
- 5.3 Kunst
- 5.4 Hypothesen
- 6 Heuristik
- 6.1 Anforderungen
- 6.2 Werkzeugaktualisierung
- 6.2.1 Irritationsvariable [ ]
- 6.2.2 Sinnübersetzung
- 6.2.3 Kommunikation
- 6.3 Anwendung
- 6.3.1 Datenbasis
- 6.3.2 Datenreflexion
- 6.3.3 Dateninspiration
- 6.3.4 Beobachtung und Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht unbekanntes Nichtwissen im Kontext systemischen Nichtwissens und zielt auf die Entwicklung eines Reflexionswerkzeugs für Entscheidungsprozesse in Unternehmen ab. Das Werkzeug soll dynamisch und offen sein, intuitives Handeln fördern und die geistige Freiheit anregen, um unerwartete Ereignisse besser zu bewältigen.
- Kritisches Hinterfragen der Wissensdominanz
- Unbekanntes Nichtwissen als systemisches Phänomen
- Szenario-Technik als Methode zur Reflexion von Nichtwissen
- Die Rolle von Kommunikation und Vertrauen
- Entwicklung eines Reflexionswerkzeugs für Entscheidungsträger
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung – eine Feldskizze: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Nichtwissen und unbekanntes Nichtwissen heraus, insbesondere in dynamischen und komplexen Umgebungen. Sie kritisiert den traditionellen Umgang mit Risiken, der auf der Unterschätzung des Unbekannten basiert, und betont die Notwendigkeit eines adäquaten Umgangs mit Nichtwissen für Unternehmen. Die Arbeit zielt auf die Gestaltung eines Reflexionswerkzeugs für Entscheidungsprozesse ab, das durch Offenheit und Dynamik intuitives und ideenreiches Handeln ermöglicht und den Vorstellungshorizont erweitert, um negative Auswirkungen unerwarteter Ereignisse abzumildern.
2 Bezugsrahmen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt die Konzepte des Beobachters, der Kybernetik zweiter Ordnung und der „Laws of Form“ von George Spencer-Brown als Beobachtungsinstrumente. Der „blinde Fleck“ des Beobachters wird thematisiert, ebenso wie die Implikationen für wissenschaftliche Beobachtung und Innovationen. Die Kybernetik zweiter Ordnung wird als geeigneter Rahmen für die Behandlung komplexer, nicht-linearer Systeme eingeführt, während die „Laws of Form“ als Hilfsmittel für den Umgang mit Widersprüchen und Selbstreferentialität dargestellt werden.
3 Unbekanntes Nichtwissen – ein Phänomen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Phänomen des unbekannten Nichtwissens. Es differenziert zwischen Daten, Informationen und Wissen, beleuchtet die Organisation von Wissen und Nichtwissen nach Nonaka und Takeuchi, und untersucht wissenschaftliche Ansätze im Umgang mit Nichtwissen. Verschiedene Dimensionen von Nichtwissen (Wissen, Intentionalität, Zeitliche Stabilität) werden diskutiert, ebenso wie Nichtwissenskulturen und die Rolle von Vertrauen als Steuermechanismus.
4 Szenarien – eine qualitative Methode: Dieses Kapitel präsentiert Szenarien als Methode der Zukunfts- und Trendforschung. Es diskutiert die Anwendung von Szenarien in der strategischen Frühaufklärung, beleuchtet Qualitätskriterien der Szenariomethode und erörtert den Umgang mit Trends und Wild Cards als Indikatoren für zukünftige Entwicklungen. Der Fokus liegt auf der Fähigkeit von Szenarien, Nichtwissen zu reflektieren und die Grenzen des Wissens aufzuzeigen.
5 Kommunikation: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Kommunikation für den Umgang mit unbekanntem Nichtwissen. Es beleuchtet die Rolle von Sprache und Kunst als Kommunikationsmedien und diskutiert Szenarien als Kommunikationsinstrumente im Kontext von Stakeholder-Kommunikation. Die Bedeutung eines offenen Dialogs und die Herausforderungen der Kommunikation von Nichtwissen werden hervorgehoben.
6 Heuristik: Dieses Kapitel schlägt ein Reflexionswerkzeug vor, um mit unbekanntem Nichtwissen umzugehen. Es beschreibt Anforderungen an das Werkzeug, aktualisierte Methoden der Trend- und Issue-Analyse und die Einführung einer Irritationsvariablen. Der Prozess der Sinnübersetzung durch Kunst und die Rolle von Kommunikation werden diskutiert. Ein empirisches Beispiel mit einer Analyse von Szenarien und der anschließenden künstlerischen Reflexion wird vorgestellt.
Schlüsselwörter
Unbekanntes Nichtwissen, Systemisches Nichtwissen, Szenario-Technik, Wissensmanagement, Risikowissen, Komplexität, Kybernetik zweiter Ordnung, Laws of Form, Kommunikation, Vertrauen, Stakeholder, Kunst, Reflexion, Innovation, Frühaufklärung, Zukunftsforschung, Qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Unbekanntes Nichtwissen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Phänomen des „unbekannten Nichtwissens“ im Kontext systemischen Nichtwissens. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung eines Reflexionswerkzeugs für Entscheidungsprozesse in Unternehmen, das den Umgang mit unerwarteten Ereignissen verbessern soll.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, insbesondere die Szenario-Technik zur Zukunfts- und Trendforschung. Sie stützt sich außerdem auf theoretische Konzepte der Kybernetik zweiter Ordnung und der „Laws of Form“ von George Spencer-Brown. Ein wichtiger Aspekt ist die Reflexion über Kommunikation und Vertrauen im Umgang mit Nichtwissen.
Was ist „unbekanntes Nichtwissen“?
„Unbekanntes Nichtwissen“ beschreibt den Bereich des Nichtwissens, von dem man nicht einmal weiß, dass man ihn nicht weiß. Im Gegensatz zu bekanntem Nichtwissen (man weiß, dass man etwas nicht weiß) stellt unbekanntes Nichtwissen eine besondere Herausforderung dar, da es nicht aktiv adressiert werden kann.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Konzepten der Kybernetik zweiter Ordnung, die komplexe Systeme und die Rolle des Beobachters in der Erkenntnisgewinnung beleuchten. Die „Laws of Form“ von George Spencer-Brown dienen als Denkmodell für den Umgang mit Widersprüchen und Selbstreferentialität. Die Arbeit bezieht sich auch auf Theorien zum Wissensmanagement und zur Organisation von Wissen und Nichtwissen (z.B. Nonaka und Takeuchi).
Wie wird das Reflexionswerkzeug aufgebaut?
Das entwickelte Reflexionswerkzeug zielt darauf ab, dynamisch und offen zu sein, intuitives Handeln zu fördern und die geistige Freiheit anzuregen. Es integriert Methoden der Trend- und Issue-Analyse, die Einführung einer „Irritationsvariablen“ und die Reflexion mittels Kunst und Kommunikation. Der Prozess umfasst die Analyse von Daten, deren Reflexion und Inspiration sowie Beobachtung und Kommunikation.
Welche Rolle spielen Kommunikation und Vertrauen?
Kommunikation und Vertrauen spielen eine zentrale Rolle im Umgang mit unbekanntem Nichtwissen. Die Arbeit untersucht die Rolle von Sprache und Kunst als Kommunikationsmedien und betont die Bedeutung eines offenen Dialogs für den Austausch von Wissen und Nichtwissen. Vertrauen wird als Steuermechanismus betrachtet, der den Umgang mit Unsicherheit und Risiko beeinflusst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Bezugsrahmen (inkl. Beobachter, Kybernetik zweiter Ordnung und „Laws of Form“), Unbekanntes Nichtwissen als Phänomen, Szenarien als Methode, Kommunikation und Heuristik (Entwicklung und Anwendung des Reflexionswerkzeugs).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unbekanntes Nichtwissen, Systemisches Nichtwissen, Szenario-Technik, Wissensmanagement, Risikowissen, Komplexität, Kybernetik zweiter Ordnung, Laws of Form, Kommunikation, Vertrauen, Stakeholder, Kunst, Reflexion, Innovation, Frühaufklärung, Zukunftsforschung, Qualitative Forschung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf die Entwicklung eines praxisorientierten Reflexionswerkzeugs für Entscheidungsträger in Unternehmen ab. Dieses Werkzeug soll helfen, mit unbekanntem Nichtwissen umzugehen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber unerwarteten Ereignissen zu stärken. Die Arbeit kritisiert die Wissensdominanz und plädiert für einen bewussteren Umgang mit Nichtwissen.
- Quote paper
- Dipl. Kommunikationswirtin Judith Pfeffing (Author), 2009, Unbekanntes Nichtwissen in der Szenario-Technik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160471