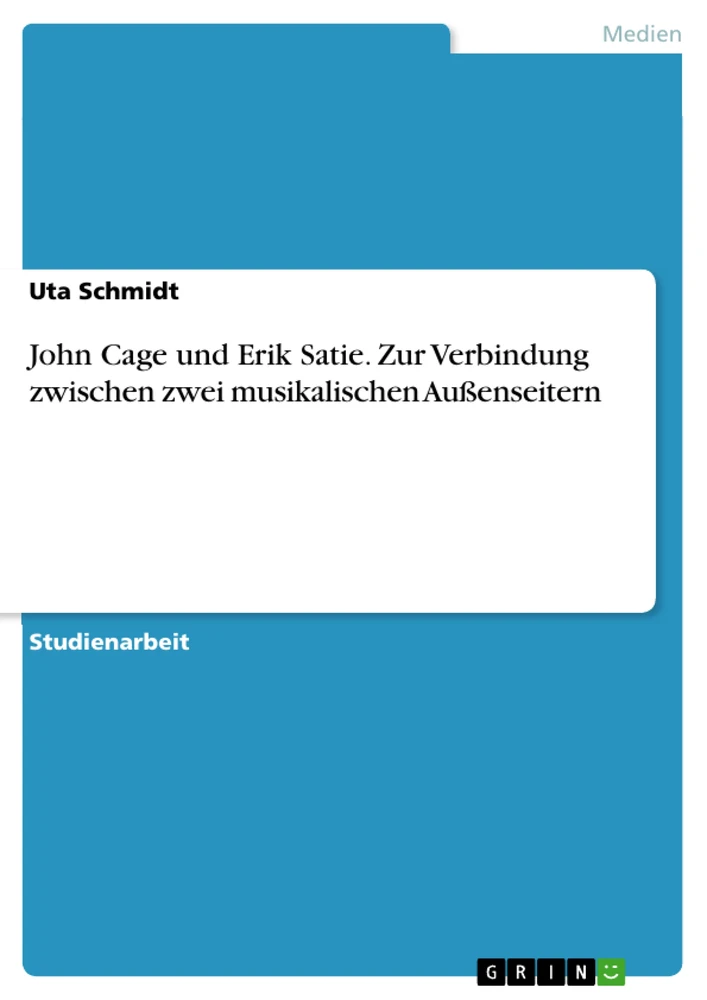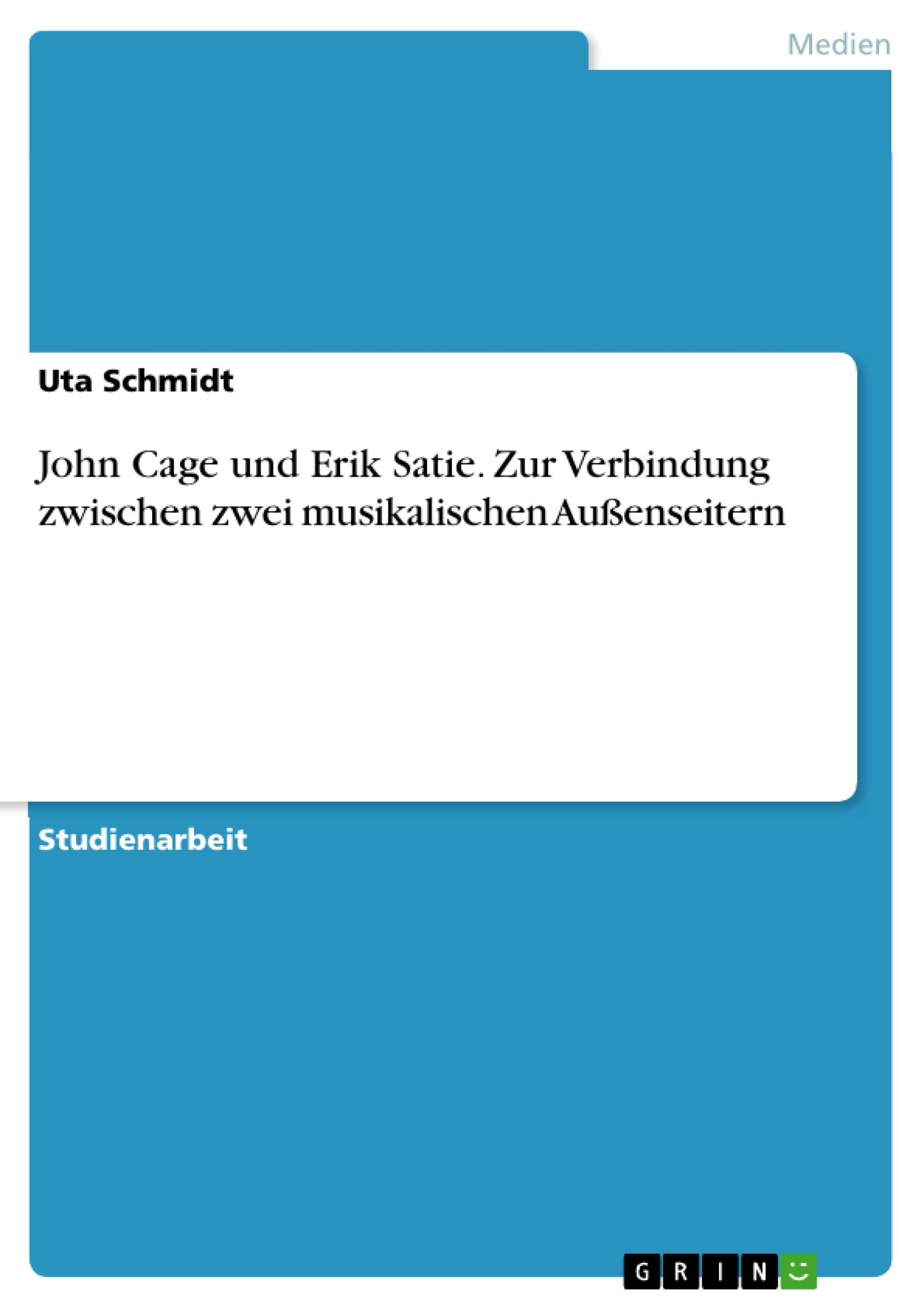Wie bei vielen anderen Komponisten gibt es auch im Fall von Cage besonders einen, auf den im Zusammenhang mit ihm immer wieder verwiesen wird. Das Kuriose dabei ist jedoch, dass dieser Komponist, mit Namen Erik Satie, keineswegs einer seiner Zeitgenossen war – als Satie 1925 starb, war Cage erst 13 Jahre alt. Darüber hinaus ist erwähnenswert, dass beide nicht nur in verschiedenen, sondern in geradezu entgegengesetzten Epochen gelebt beziehungsweise komponiert haben: Satie zur Zeit des ausgehenden Impressionismus bzw. im noch spätromantisch geprägten Anfang des 20. Jahrhunderts, Cage in der avantgardistischen Moderne. Aus diesem Grund scheint es paradox, dass dennoch gelegentlich der Eindruck entsteht, als wären Satie und Cage nicht nur Zeitgenossen, sondern auch Freunde gewesen.
Ein näherer Blick auf das Bild, das Satie der Öffentlichkeit von sich preisgab, veranschaulicht jedoch bereits ansatzweise, warum beide Komponisten so oft unter ähnlichen Aspekten behandelt werden. Hinsichtlich mancher Details liefert es regelrecht eine Schablone dessen, was auch über Cage gesagt wird: Als Charakteristika von Satie gelten, ähnlich wie bei Cage, sein exzentrisches, provokatives Verhalten, seine skurrilen Einfälle sowohl musikalischer als auch sprachlicher Natur, und sein spezieller Humor, d.h. seine Vorliebe für Ironie und Absurdität, die nicht selten für Ratlosigkeit unter den Zuhörern sorgte. Die Tatsache, dass beide Komponisten ein Leben führten, das nicht von Erfolg und Reichtum geprägt war, weist ebenfalls deutlich auf eine andere Kunstauffassung hin als jene, die derzeit aktuell war.
Trotz dieser Gemeinsamkeiten ist es nicht abzustreiten, dass Satie und Cage kompositorisch völlig verschiedene Wege eingeschlagen haben, so dass von allen Aspekten, unter denen die beiden miteinander verglichen werden, die Musik selbst an letzter Stelle steht. Wie aber kann es sein, dass zwei Komponisten möglicherweise die gleiche – oder zumindest eine ähnliche – Musikauffassung besitzen und doch vollkommen unterschiedlich komponieren?
Ausgehend von der Position Cages beginnt die Betrachtung mit einer ersten Bestandsaufnahme, inwiefern er sich in seinem Leben überhaupt mit Satie beschäftigt hat. Im Anschluss daran sollen konkrete Analysen einzelner – sowohl musikalischer als auch literarischer – Werke beider Komponisten schließlich zu einer Antwort auf die Ausgangsfrage führen, wie sich die viel zitierte Verbindung zwischen Satie und Cage tatsächlich charakterisieren lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Die Rolle Saties in Cages Lebenslauf
- Analytischer Teil: Cage und Satie...
- als Komponisten.
- 2.1. Satie: Vexations
- 2.2. Satie: Musique d'ameublement
- 2.3. Cage: 4'33
- 2.4. Zusammenfassung
- ... und als Schriftsteller
- 3.1. Satie: Die musikalischen Kinder
- 3.2. Cage: Lecture on nothing
- 3.3. Zusammenfassung.
- als Komponisten.
- Schlussbemerkung: 2 Komponisten, 1 Musikauffassung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Verbindung zwischen John Cage und Erik Satie zu untersuchen. Hierbei wird zunächst der Einfluss Saties auf Cages Lebenslauf und Werk beleuchtet, bevor in einem weiteren Schritt einzelne musikalische und literarische Werke beider Komponisten analysiert werden. Ziel ist es, die oft beschriebene Gemeinsamkeit beider Künstler, eine besondere Musikauffassung, zu beleuchten und zu erklären, wie diese sich in ihren Kompositionen manifestiert.
- Die Rolle Saties in Cages Lebenslauf
- Analyse der Kompositionstechniken und -prinzipien von Satie und Cage
- Die Bedeutung des Humors und der Ironie in den Werken beider Komponisten
- Die Rezeption von Satie und Cage in der Musikgeschichte
- Die Frage nach einer gemeinsamen Musikauffassung bei Satie und Cage
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt John Cage als einen der radikalsten Komponisten des 20. Jahrhunderts vor und beleuchtet die kontroverse Rezeption seines Werkes. Sie führt den Leser auf die ungewöhnliche Beziehung zwischen Cage und Erik Satie ein, die trotz unterschiedlicher Epochen immer wieder eine besondere Nähe suggeriert. Der Einleitungsteil hebt Gemeinsamkeiten im exzentrischen Verhalten, Humor und Kunstverständnis beider Komponisten hervor und stellt die Frage, ob diese Gemeinsamkeiten auf eine gemeinsame Musikauffassung hindeuten.
- 1. Die Rolle Saties in Cages Lebenslauf: Dieses Kapitel widmet sich der Frage, wie Saties Einfluss auf Cages Lebenslauf und Werk nachweisbar ist. Es zeichnet die Entwicklung des Interesses Cages an Satie nach und zeigt, wie Saties Werke Cages Kompositionsstil beeinflusst haben. Zudem wird auf die Gemeinsamkeiten in der Verwendung von Humor und Ironie in den Werken beider Komponisten eingegangen.
- 2. Analytischer Teil: Cage und Satie...als Komponisten: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse einzelner Werke von Satie und Cage. Es geht auf spezifische Kompositionstechniken und -prinzipien ein, die beide Komponisten verwenden, und versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die Kapitel behandeln Werke wie "Vexations", "Musique d'ameublement", "4'33'" und weitere.
- 3. ... und als Schriftsteller: Dieses Kapitel vertieft die Analyse der Werke von Satie und Cage, diesmal mit einem Fokus auf ihre literarischen Beiträge. Es untersucht Texte wie "Die musikalischen Kinder" von Satie und "Lecture on nothing" von Cage, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der literarischen Ausdrucksweise zu identifizieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen John Cage, Erik Satie, Musikauffassung, avantgardistische Musik, Humor, Ironie, Kompositionstechniken, Analyse, Einfluss, Rezeption und Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Welche Verbindung besteht zwischen John Cage und Erik Satie?
Obwohl sie in verschiedenen Epochen lebten, gibt es starke Parallelen in ihrer Musikauffassung, ihrem exzentrischen Verhalten, ihrem Humor und ihrer Vorliebe für Absurdität und Provokation.
Wie beeinflusste Satie das Werk von John Cage?
Cage entdeckte Satie als Seelenverwandten. Er schätzte dessen radikale Einfachheit und die Abkehr von traditionellen musikalischen Strukturen, was Cages eigene avantgardistische Entwicklung prägte.
Was ist "Musique d'ameublement"?
Dieses Konzept von Satie beschreibt Musik als "Möbelstück", das im Hintergrund existiert, ohne dass man ihm aktiv zuhören muss – ein Vorläufer der Ambient-Musik.
Wie hängen Saties "Vexations" und Cages Konzepte zusammen?
Saties "Vexations", ein kurzes Stück, das 840 Mal wiederholt werden soll, nimmt Cages Interesse an Zeitdauer, Monotonie und dem Aufbrechen von Hörerwartungen vorweg.
Warum wird Cage oft als "Außenseiter" bezeichnet?
Durch Werke wie 4'33" (Stille) stellte Cage den Begriff der Musik selbst infrage. Wie Satie lehnte er den konventionellen Kulturbetrieb und das Streben nach klassischem Erfolg oft ab.
- Citar trabajo
- Uta Schmidt (Autor), 2010, John Cage und Erik Satie. Zur Verbindung zwischen zwei musikalischen Außenseitern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160475