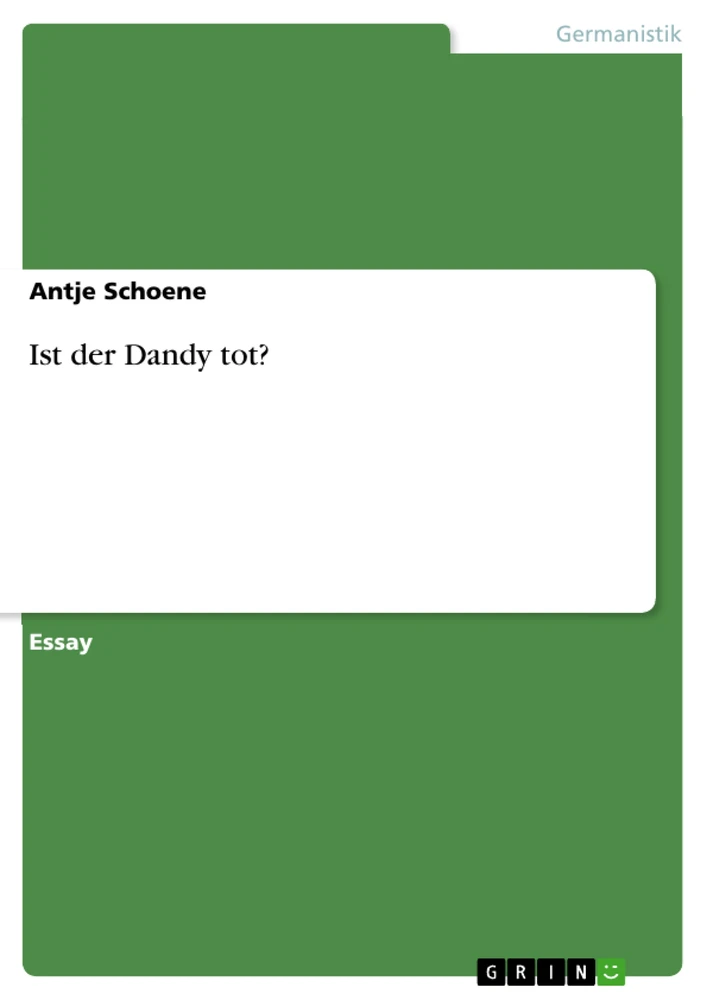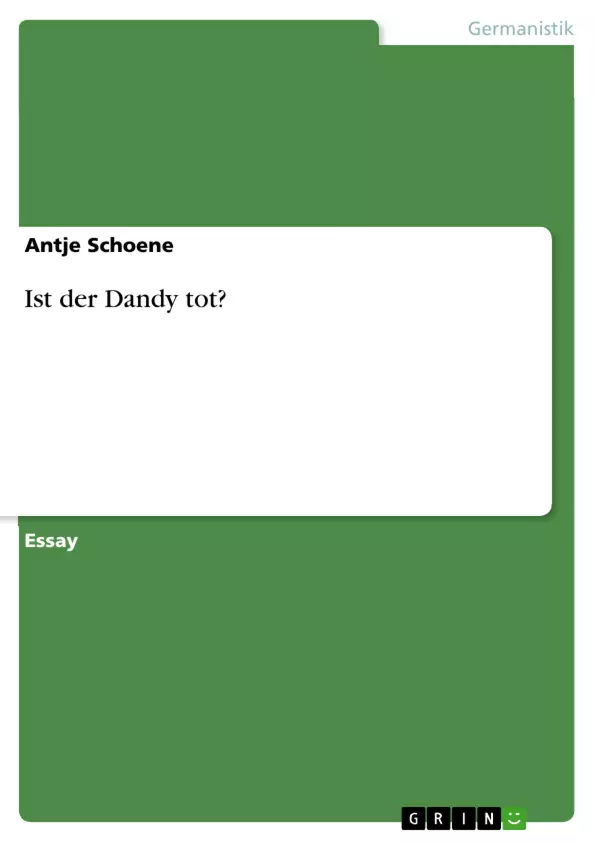Es schein als bedarf der Begriff Dandy heute kaum einer Erklärung. In Feuilletons und Modezeitschriften wird das Wort automatisch verwendet, häufig zur Kennzeichnung gut gekleideter, leicht feminin wirkender Männer, die sich durch besondere Eleganz auszeichnen. Diesem Eindruck nach gibt es ihn noch, den Dandy. Zumindest scheint er ein Comeback zu erleben. Oder ist der moderne Dandy nicht mit der Dandy-Gestalt aus dem 19. Jahrhundert zu vergleichen? Lassen die neuen Medien und unsere Zeit noch einen echten Dandy zu? Scheint doch die triviale Beschränkung auf das Aussehen, ein oberflächlicher Umgang mit dem Dandy-Begriff. Dem geistigen Habitus wird bei einer Verwendung in der Modewelt kaum Bedeutung beigemessen. Eine begriffliche Klärung scheint vonnöten, bevor die Beantwortung der Frage erfolgen kann, ob der Dandy ausgestorben ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff "Dandy" im deutschen Sprachgebrauch
- Der Dandy im 19. Jahrhundert
- Der Dandy in der deutschsprachigen Literatur
- Merkmale des Dandys
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage nach dem Fortbestand des Dandy-Typs im 21. Jahrhundert. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Dandy", seine literarische Rezeption, insbesondere im deutschsprachigen Raum, und analysiert seine charakteristischen Merkmale. Die Arbeit hinterfragt, ob der moderne, vermeintliche Dandy dem historischen Vorbild entspricht.
- Die semantische Entwicklung des Begriffs "Dandy" im Deutschen
- Die Darstellung des Dandys in der englischen und französischen Literatur des 19. Jahrhunderts
- Die Rezeption des Dandy-Motivs in der deutschsprachigen Literatur
- Charakteristische Merkmale des Dandys: Ästhetik, Lebenshaltung, soziale Stellung
- Die Frage nach dem Fortbestand des Dandy-Typs in der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Fortbestand des Dandy-Typs in der Gegenwart. Sie erläutert die Notwendigkeit einer begrifflichen Klärung des Begriffs "Dandy" und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die literarische und sprachliche Entwicklung des Begriffs mit seinen sozialen und kulturellen Implikationen verbindet. Die Einleitung umreißt die historische Entwicklung des Dandy-Bildes und deutet auf die Diskrepanz zwischen der oberflächlichen Verwendung des Begriffs in der Modewelt und seiner tieferen kulturellen Bedeutung hin.
Der Begriff "Dandy" im deutschen Sprachgebrauch: Dieses Kapitel untersucht die sprachliche Entwicklung des Begriffs "Dandy" im Deutschen. Es analysiert die unterschiedlichen Definitionen des Begriffs in verschiedenen Wörterbüchern und Enzyklopädien des 19. und 20. Jahrhunderts, wobei die unterschiedlichen Konnotationen (positiv und negativ) herausgearbeitet werden. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, den Begriff "Dandy" nicht nur linguistisch-semantisch, sondern auch im Kontext seines sozialen, kulturellen und literarischen Umfelds zu betrachten. Die frühe Adaption des Begriffs in Wörterbüchern wie Sanders (1860) wird gegenüber dem Fehlen im Grimm'schen Wörterbuch desselben Jahres gestellt und analysiert. Die negative Konnotation als "Geck" in manchen Definitionen wird mit positiven Konnotationen in anderen Werken kontrastiert.
Der Dandy im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die historische Situation des Dandy im 19. Jahrhundert, insbesondere in England und Frankreich. Es präsentiert George Bryan Brummell als den Prototypen des englischen Dandys und analysiert dessen Einfluss auf die Entwicklung des modernen Herrenanzugs. Das Kapitel beleuchtet die Legenden um Brummell und dessen dezenten, aber aufwändig gestalteten Stil. Der Gegensatz zu dem damaligen Protz und Prunk der adligen Kreise wird hervorgehoben. Weiterhin werden französische Theoretiker des Dandytums wie Jules Amédée Barbey d'Aurevilly, Honoré de Balzac und Charles Baudelaire vorgestellt und die französische Akzentverschiebung in der Bedeutung des Wortes Dandy, mit einer Betonung der Revolte und existentiellen Isolation, analysiert.
Der Dandy in der deutschsprachigen Literatur: Dieses Kapitel befasst sich mit der späten Rezeption des Dandy-Motivs in der deutschsprachigen Literatur. Es hebt die Bedeutung von Richard Schaukals Werk "Leben und Meinungen des Herrn Andreas von Balthesser" hervor und diskutiert die Gründe für die späte Verbreitung des Dandy-Themas im deutschsprachigen Raum. Das Kapitel analysiert die Rolle Schaukals bei der Übersetzung von Barbey d'Aurevillys Essay "Vom Dandytum" und untersucht die Argumentation von Florian Krobb bezüglich des Einflusses der fehlenden Metropole und der spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen in Deutschland. Der Einfluss Schaukals wird im Kontext der Aneignung französischer Anregungen um die Jahrhundertwende diskutiert, wobei die Arbeit "Balthesser" eher als zusammenfassendes Werk denn als innovativer Beitrag eingeordnet wird.
Merkmale des Dandys: Das Kapitel fasst zusammenfassend weitere Merkmale des Dandys zusammen: seinen dekadenten Lebensstil, seine Überlegenheit, Lässigkeit und Elitarität. Es betont seinen kritischen Blick auf Gesellschaft, Fortschritt und Kunst, wobei sein Fokus auf der äußeren Erscheinung liegt. Der aufwändige Aufwand für die Gestaltung seines Aussehens und die Abneigung gegenüber Extravaganzen wird beschrieben. Der Begriff "Raffinement der Einfachheit" wird erklärt und die Abneigung gegen anstrengende Erwerbsarbeit sowie die Bedeutung von Müßiggang und Spiel für den Dandy betont. Schließlich wird seine Fähigkeit zur Selbstinszenierung als zentrales Merkmal herausgestellt und seine Position in der Gesellschaft beschrieben: Mitglied der feinen Gesellschaft, aber gleichzeitig davon abgegrenzt.
Schlüsselwörter
Dandy, Dandytum, Ästhetizismus, George Bryan Brummell, Richard Schaukal, deutschsprachige Literatur, Mode, Eleganz, soziale Kritik, 19. Jahrhundert, Rezeption, Literaturvermittlung, Sprachgebrauch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Dandy-Typs im 21. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Fortbestand des Dandy-Typs im 21. Jahrhundert. Sie analysiert die historische Entwicklung des Begriffs "Dandy", seine literarische Rezeption, insbesondere im deutschsprachigen Raum, und seine charakteristischen Merkmale. Ein zentrales Anliegen ist die Frage, ob der moderne, vermeintliche Dandy dem historischen Vorbild entspricht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die semantische Entwicklung des Begriffs "Dandy" im Deutschen, die Darstellung des Dandys in der englischen und französischen Literatur des 19. Jahrhunderts, die Rezeption des Dandy-Motivs in der deutschsprachigen Literatur, charakteristische Merkmale des Dandys (Ästhetik, Lebenshaltung, soziale Stellung) und die Frage nach dem Fortbestand des Dandy-Typs in der Moderne.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur sprachlichen Entwicklung des Begriffs "Dandy" im Deutschen, ein Kapitel zum Dandy im 19. Jahrhundert (England und Frankreich), ein Kapitel zum Dandy in der deutschsprachigen Literatur, und ein Kapitel zu den Merkmalen des Dandys. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Bedeutung hat die Einleitung?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage, erläutert die Notwendigkeit einer begrifflichen Klärung des Begriffs "Dandy" und skizziert den methodischen Ansatz. Sie umreißt die historische Entwicklung des Dandy-Bildes und weist auf die Diskrepanz zwischen oberflächlicher und tieferer kultureller Bedeutung hin.
Wie wird der Begriff "Dandy" im deutschen Sprachgebrauch behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die sprachliche Entwicklung des Begriffs "Dandy" im Deutschen, untersucht unterschiedliche Definitionen in Wörterbüchern und Enzyklopädien des 19. und 20. Jahrhunderts und arbeitet unterschiedliche Konnotationen (positiv und negativ) heraus. Es betont die Betrachtung des Begriffs im Kontext seines sozialen, kulturellen und literarischen Umfelds.
Wie wird der Dandy des 19. Jahrhunderts dargestellt?
Dieses Kapitel beschreibt den Dandy des 19. Jahrhunderts, insbesondere in England und Frankreich. Es präsentiert George Bryan Brummell als Prototyp und analysiert dessen Einfluss auf den modernen Herrenanzug. Französische Theoretiker wie Barbey d'Aurevilly, Balzac und Baudelaire werden vorgestellt und die französische Bedeutung des Wortes Dandy analysiert.
Welche Rolle spielt die deutschsprachige Literatur?
Dieses Kapitel befasst sich mit der späten Rezeption des Dandy-Motivs in der deutschsprachigen Literatur. Es hebt Richard Schaukals Werk "Leben und Meinungen des Herrn Andreas von Balthesser" hervor und diskutiert die Gründe für die späte Verbreitung des Dandy-Themas im deutschsprachigen Raum. Der Einfluss Schaukals und die Aneignung französischer Anregungen werden analysiert.
Welche Merkmale werden dem Dandy zugeschrieben?
Das Kapitel fasst Merkmale des Dandys zusammen: dekadenten Lebensstil, Überlegenheit, Lässigkeit, Elitarität, kritischer Blick auf Gesellschaft, Fortschritt und Kunst, aufwändige Gestaltung des Aussehens, Abneigung gegen Extravaganzen, "Raffinement der Einfachheit", Abneigung gegen Erwerbsarbeit, Bedeutung von Müßiggang und Spiel, und die Fähigkeit zur Selbstinszenierung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Dandy, Dandytum, Ästhetizismus, George Bryan Brummell, Richard Schaukal, deutschsprachige Literatur, Mode, Eleganz, soziale Kritik, 19. Jahrhundert, Rezeption, Literaturvermittlung, Sprachgebrauch.
- Citation du texte
- BA Antje Schoene (Auteur), 2010, Ist der Dandy tot?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160525