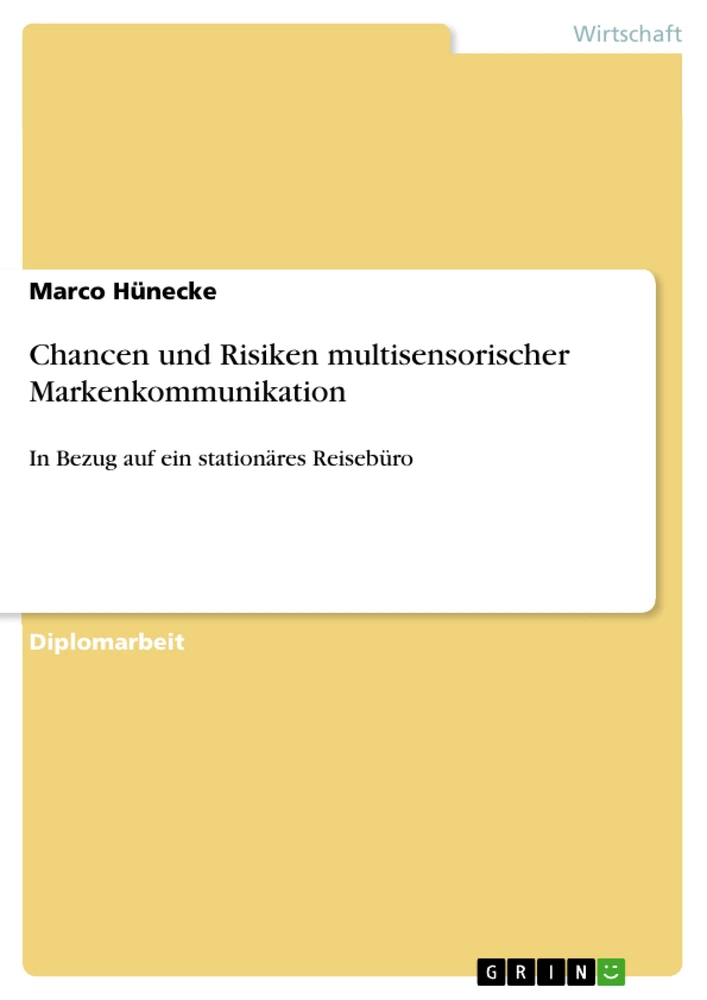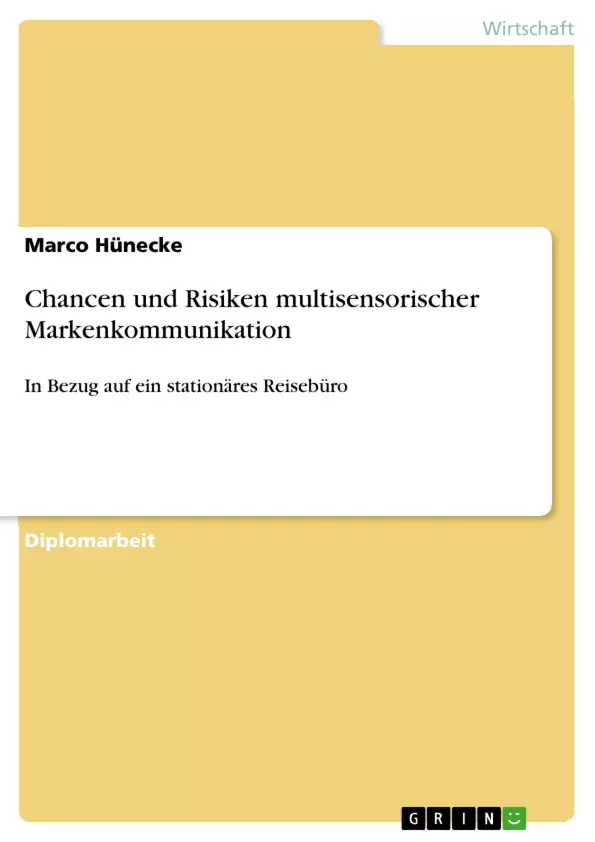Die Tourismusbranche hatte in den vergangenen Jahren mit einer Vielzahl von
Problemen zu kämpfen.
Terrorismus, Seuchen oder politische Krisenherde sorgten für einschneidende
Veränderungen sowie für einen Rückgang der Reisetätigkeiten weltweit.
Für die stationär angesiedelten Reisebüros, auch Reisevermittler genannt, zeigen
sich weit schwerwiegendere Veränderungen auf, welche bis hin zur
Existenzbedrohung führen könnten.
Die technische Entwicklung und die Verbreitung des Internets geben
Reiseinteressenten heutzutage die Möglichkeit, das stationäre Reisebüro im
gesamten Prozess der Recherche und Buchung einer Reise außen vor zu lassen.
Das Reisebüro als Zwischenhändler verliert somit nach und nach an Bedeutung,
und könnte somit in wenigen Jahren zu einem großen Teil vom Markt
verschwinden.
Gegenüber den Onlinepräsenzen besitzt das klassische Reisebüro jedoch 2
wesentliche Merkmale über die man sich differenzieren kann und muss.
Zum einen ist der Faktor einer kompetente Beratung ein Vorteil gegenüber
Onlineanbietern den es auszubauen gilt, zum anderen muss es den stationären
Reisebüros gelingen, das Urlaubserlebnis bereits beim Betreten des Reisebüros
vermitteln zu können.
Das multisensorische Marketing kann hierbei unterstützend wirken.
Aus diesen Faktoren muss das stationäre Reisebüro einen Mehrwert für die
Kunden schaffen um sich auch zukünftig konkurrenzfähig präsentieren zu können.
Ziel der Arbeit ist es, aus den Erkenntnissen der Neurowissenschaften
Rückschlüsse zu ziehen, und diese so in Handlungsempfehlungen umzuwandeln,
dass eine neue Kommunikation zwischen Marke und Mensch, zwischen
Reisebüro und Kunde entsteht.
Die multisensorische Kundenansprache bildet dabei den Grundstein für das
Urlaubserlebnis, welches bereits bei dem Beratungs- und Buchungsvorgang im
stationären Reisebüro entstehen soll. Ein zu nutzendes USP, welches der
wachsenden Konkurrenz der Internetreisebüros nicht zur Verfügung steht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktualität der Problemstellung
- Zielsetzung der Arbeit
- Grundlagen und Begriffserklärungen
- Markengrundlagen
- Definition „Marke“
- Markenimage
- Markentreue
- Markenwert
- Definition und Begriffsabgrenzung
- Das klassische stationäre Reisebüro
- Aufgaben und Produkte
- Veränderte Rahmenbedingungen im Markenmanagement
- Marktbezogene Veränderungen
- Aktuelle Lage des Tourismusmarktes
- Disintermediation
- Konsumentenbezogene Veränderungen
- Information Overload
- Erlebniskonsum
- Hybrides Konsumverhalten
- Smart Shopping
- Variety Seeking
- Markenrelevante Erkenntnisse der Hirnforschung
- Physiologischer Aufbau des menschlichen Gehirns
- Die Multisensorische Gehirn
- Kortikale Entlastung – First-Brand-Choice-Effect
- Der Priming Effekt
- Pilot/Autopilot
- Zwischenfazit
- Das neue stationäre Reisebüro - Handlungsempfehlungen
- Freizeit und Reisen als Dritter Ort
- Sehen - Darbietung visueller Reize
- Spiegelneuronen
- Riechen - Darbietung olfaktorischer Reize
- Hören - Darbietung akustischer Reize
- Schmecken - Darbietung gustatorischer Reize
- Tasten – Darbietung haptischer Reize
- Zusammenspiel aller Sinne
- Risiken
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Chancen und Risiken der multisensorischen Markenkommunikation im Kontext eines stationären Reisebüros. Die Arbeit untersucht, wie Reisebüros durch die gezielte Ansprache verschiedener Sinne eine stärkere Markenbindung und Kundenloyalität erreichen können. Darüber hinaus werden die Herausforderungen und potenziellen Risiken dieser Strategie beleuchtet.
- Die Bedeutung von multisensorischen Marketingstrategien im Tourismussektor
- Der Einfluss von sensorischen Reizen auf die Markenwahrnehmung und -präferenz
- Die Rolle der Hirnforschung im Verständnis von Konsumentenverhalten und Markenloyalität
- Die Herausforderungen der Implementierung multisensorischer Markenkommunikation in stationären Reisebüros
- Die Analyse von Erfolgsfaktoren und Risikofaktoren für die Anwendung multisensorischer Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der multisensorischen Markenkommunikation ein und erläutert die Aktualität der Problemstellung. Kapitel 2 legt die Grundlagen des Markenmanagements und definiert zentrale Begriffe wie Markenimage, Markentreue und Markenwert. Zudem werden die Besonderheiten des klassischen stationären Reisebüros beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert die veränderten Rahmenbedingungen im Markenmanagement, die durch den Wandel des Tourismusmarktes und das veränderte Konsumentenverhalten geprägt sind. Kapitel 4 beleuchtet die Erkenntnisse der Hirnforschung, die für das Verständnis der Markenwirkung im Gehirn relevant sind. Dabei werden Konzepte wie Kortikale Entlastung, Priming-Effekt und Pilot/Autopilot-System vorgestellt.
Kapitel 5 stellt Handlungsempfehlungen für das neue stationäre Reisebüro vor, die auf den Erkenntnissen der Hirnforschung basieren. Es werden verschiedene Strategien zur gezielten Ansprache der Sinne – Sehen, Riechen, Hören, Schmecken, Tasten – im Kontext von Reisebüros erläutert.
Schlüsselwörter
Multisensorische Markenkommunikation, Reisebüro, Tourismus, Konsumentenverhalten, Hirnforschung, Markenwahrnehmung, Markenimage, Markentreue, Markenwert, sensorische Reize, Erlebniskonsum, Disintermediation, Information Overload, Hybrides Konsumverhalten, Smart Shopping, Variety Seeking.
Häufig gestellte Fragen
Was ist multisensorische Markenkommunikation?
Es ist eine Marketingstrategie, die gezielt mehrere Sinne (Sehen, Riechen, Hören, Schmecken, Tasten) anspricht, um ein ganzheitliches Markenerlebnis zu schaffen und die Kundenbindung zu stärken.
Warum ist multisensorisches Marketing für Reisebüros wichtig?
Stationäre Reisebüros stehen unter Druck durch das Internet. Durch multisensorische Reize können sie das „Urlaubserlebnis“ bereits im Beratungsgespräch spürbar machen – ein klarer Vorteil gegenüber reinen Online-Portalen.
Welche Rolle spielt die Hirnforschung in diesem Konzept?
Die Hirnforschung erklärt Effekte wie den „First-Brand-Choice-Effect“ oder das „Priming“. Sie zeigt, wie sensorische Reize direkt das Unterbewusstsein (den „Autopiloten“) ansprechen und Kaufentscheidungen beeinflussen.
Wie können Sinne im Reisebüro konkret angesprochen werden?
Durch visuelle Reize (Bilder), olfaktorische Reize (Düfte wie Sonnencreme), akustische Reize (Meeresrauschen), gustatorische Reize (landestypische Snacks) und haptische Reize (hochwertige Kataloge oder Sand).
Welche Risiken birgt die multisensorische Ansprache?
Ein Risiko ist die Überreizung des Kunden („Information Overload“). Zudem kann eine unpassende Reizkombination unglaubwürdig wirken und das Markenimage eher schädigen als stärken.
- Citation du texte
- Marco Hünecke (Auteur), 2010, Chancen und Risiken multisensorischer Markenkommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160537