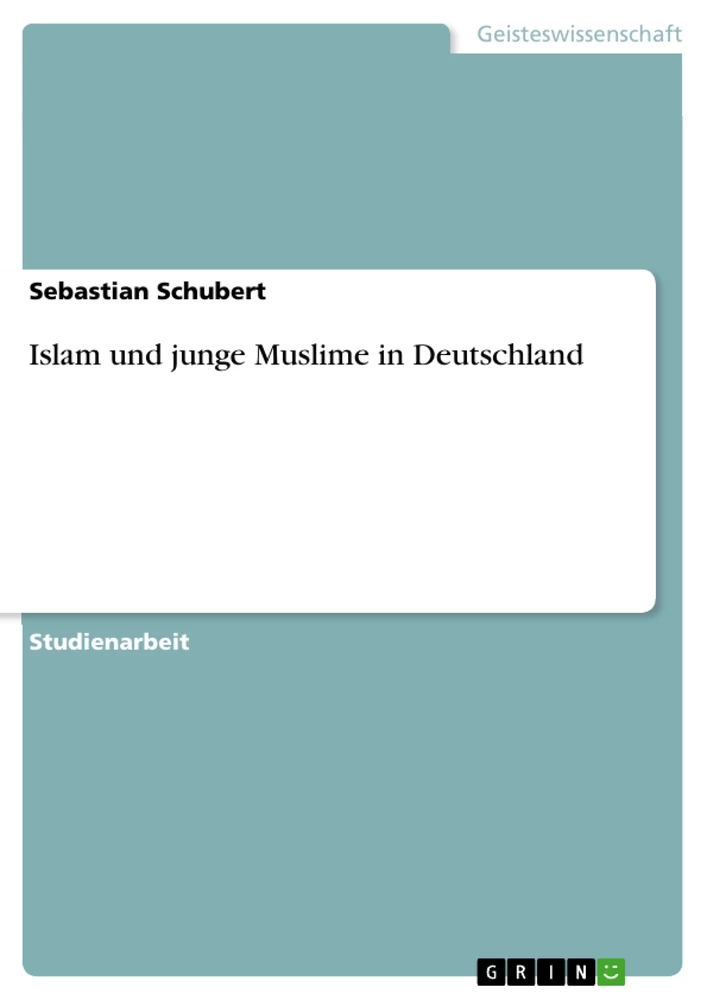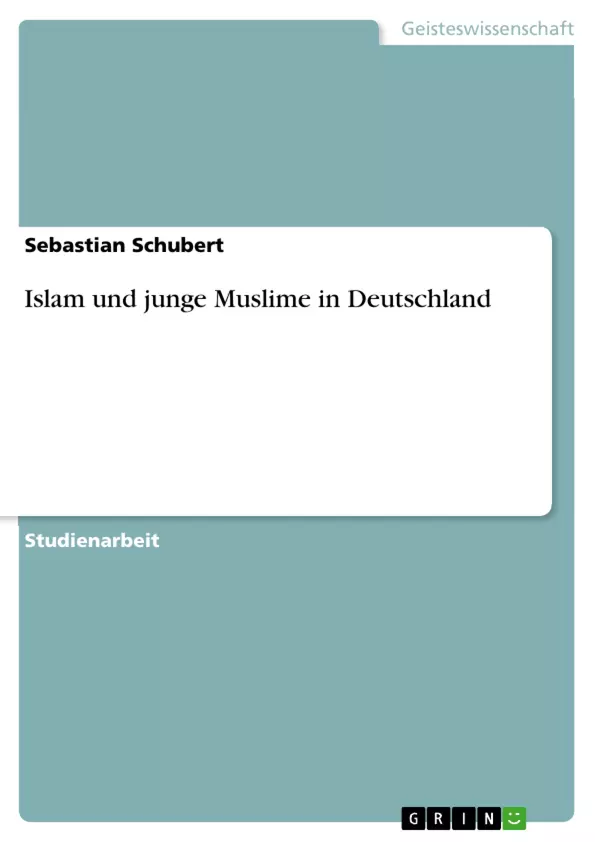Laut einer Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BMF) im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz (DIK) leben in Deutschland mittlerweile rund vier Millionen Muslime, darunter rund zwei Drittel mit türkischer Abstammung (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2009 : 11ff.). Die Muslime sind und werden mehr und mehr ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft.
Umso verständlicher ist es, das in den letzten Jahren auch die Integration der Muslime wieder vermehrt in den Blickpunkt der Forschung rückt. Zahlreiche Publikationen und Studien befassen sich mit dieser Thematik. Sie alle stellen sich die Frage, wie die Muslime in Deutschland integriert sind. Entscheidend ist diese Frage auch für die dritte Generation der eingewanderten Muslime, die heutigen muslimischen Jugendlichen. Sie sind im Gegensatz zu vielen ihrer Eltern in Deutschland geboren und aufgewachsen und in Zukunft bilden sie einen Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Integration ist hier ein sehr wichtiger Faktor.
Die vorliegende Arbeit wird sich daher im Besonderen mit der Integration junger Muslime in Deutschland befassen. In Anbetracht der Tatsache, dass es in der Bevölkerung eine scheinbar weitverbreitete negative Einstellung gegenüber Muslimen gibt (besonders nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, siehe auch Gesemann 2006: 4f.), lautet die bewusst einfach formulierte Forschungshypothese, dass junge Muslime in Deutschland schlecht in die heutige Gesellschaft integriert sind.
Um diese Hypothese zu untersuchen, wird folgendermaßen vorgegangen. Zunächst wird ein kurzer Überblick darüber gegeben, was der Begriff Integration überhaupt bedeutet. Daran anknüpfend werden in Kapitel 2 zwei große Studien auf ihre Aussagen zur Integration von jungen Muslimen hin analysiert und die Ergebnisse vorgestellt. Konkret werden wir uns mit der sprachlich-sozialen Integration, den Bildungserfolgen, den Integrationseinstellungen und der Religiosität bzw. den religiösen Orientierungen befassen. In Kapitel 3 werden die dargestellten Studienergebnisse in Beziehung zur Hypothese gesetzt und abschließend analysiert. Zusätzlich wird ein Ausblick auf weitere Untersuchungsfragen gegeben, etwa ob auch sexuelle Identität Auswirkungen auf die Integration hat oder wie sich die neue Jugendbewegung Pop-Islam womöglich auf die Integration auswirkt. Die wichtigsten Literaturquellen dieser Untersuchung sind die Studien von Katrin Brettfeld und Peter Wetzels (2007) sowie von Frank Gesemann (2006).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Integration junger Muslime
- 2.1 Studienergebnisse
- 2.1.1 Sprachlich-soziale Integration
- 2.1.2 Bildungserfolge
- 2.1.3 Integrationseinstellungen
- 2.1.4 Religiosität und religiöse Einstellungen
- 2.1 Studienergebnisse
- 3. Schlussbetrachtung
- 3.1 Analyse
- 3.4 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Integration junger Muslime in Deutschland. Sie analysiert Studienergebnisse, die sich mit der sprachlich-sozialen Integration, Bildungserfolgen, Integrationseinstellungen und der Religiosität junger Muslime auseinandersetzen.
- Sprachlich-soziale Integration junger Muslime
- Bildungserfolge junger Muslime
- Integrationseinstellungen junger Muslime
- Religiosität und religiöse Einstellungen junger Muslime
- Zusammenhang zwischen Integration und religiöser Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Integration junger Muslime in Deutschland ein und skizziert die Relevanz der Thematik. Das Kapitel "Integration junger Muslime" präsentiert Studienergebnisse, die sich mit der sprachlich-sozialen Integration, Bildungserfolgen, Integrationseinstellungen und der Religiosität junger Muslime befassen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Integration junger Muslime in Deutschland ein komplexer Prozess ist, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Die Schlussbetrachtung analysiert die Studienergebnisse und bietet einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Integration, junge Muslime, Deutschland, Sprachlich-soziale Integration, Bildungserfolge, Integrationseinstellungen, Religiosität, Religiöse Einstellungen, Studienergebnisse, Clusteranalyse, Kompositindikator, Person mit Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Muslime leben derzeit in Deutschland?
Laut einer Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) leben rund vier Millionen Muslime in Deutschland, wovon etwa zwei Drittel türkischer Abstammung sind.
Welche Faktoren beeinflussen die Integration junger Muslime?
Die Integration wird durch verschiedene Faktoren wie die sprachlich-soziale Einbindung, Bildungserfolge, religiöse Orientierungen und die allgemeine Einstellung der Gesellschaft beeinflusst.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Religiosität und Integration?
Die Arbeit analysiert Studienergebnisse zur Religiosität und prüft, wie religiöse Identität und Einstellungen der Jugendlichen mit ihrem Integrationsprozess in der deutschen Gesellschaft korrelieren.
Wie erfolgreich sind junge Muslime im deutschen Bildungssystem?
Die Arbeit untersucht gezielt die Bildungserfolge der dritten Generation eingewanderter Muslime, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, als einen Grundpfeiler der zukünftigen Gesellschaft.
Was versteht man unter dem Begriff „Pop-Islam“?
Pop-Islam beschreibt eine neue Jugendbewegung, die muslimische Identität mit Elementen der modernen Popkultur verbindet und möglicherweise neue Wege der Integration eröffnet.
Welche Rolle spielten die Anschläge vom 11. September für die Integration?
In der Bevölkerung entstand nach den Anschlägen oft eine negativere Einstellung gegenüber Muslimen, was die soziale Integration und die Wahrnehmung muslimischer Jugendlicher erschwerte.
- Citar trabajo
- Sebastian Schubert (Autor), 2010, Islam und junge Muslime in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160608