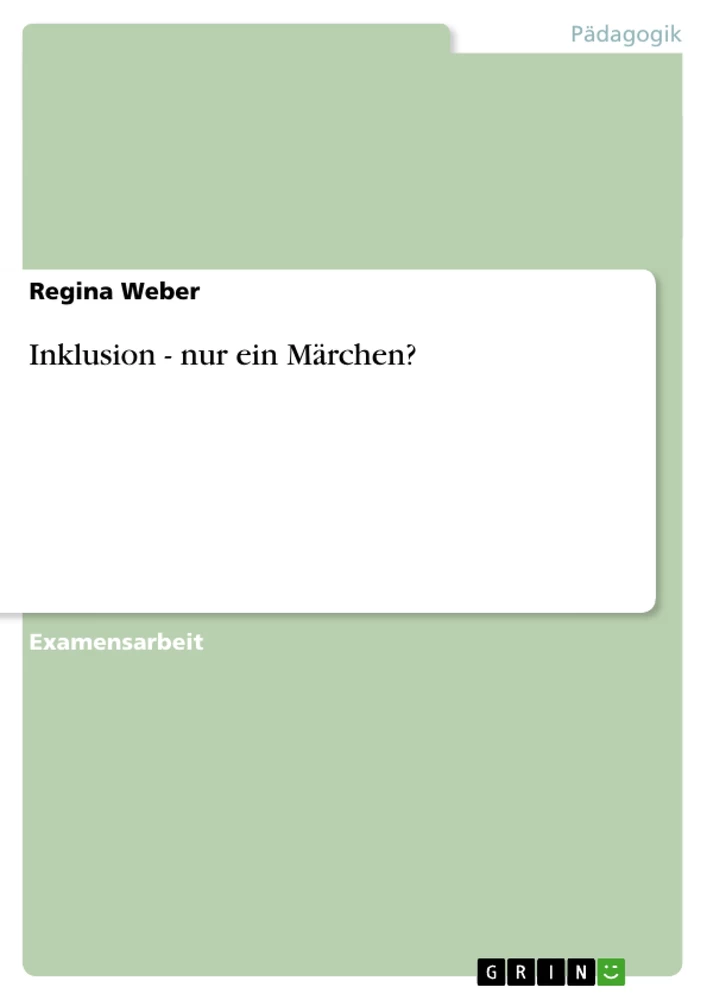Zu Beginn möchte ich auf eine Doppeldeutigkeit im Titel meiner Arbeit „Inklusion - nur ein Märchen?“ hinweisen. Auf der einen Seite wird hier die Fragestellung deutlich, die meiner Arbeit zugrunde liegt: Ist Inklusion ein erstrebenswertes Ideal, das wirklich in die Realität umgesetzt werden kann, oder handelt es sich hierbei nur um ein „Märchen“ bzw. eine nicht realisierbare Utopie?
Andererseits soll der Titel darauf hinweisen, dass das Thema „Märchen“ für die Beantwortung der oben genannten Leitfrage in meiner Arbeit eine entscheidende Rolle spielt. Sie basiert auf Erfahrungen einer Unterrichtsreihe bzw. einem Projekt zum Thema „Märchen“ im Gemeinsamen Unterricht1 von Kindern mit und ohne „Behinderungen“.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Idee einer Schule für alle
- 1.1 Zum Verständnis von Integration und Inklusion
- 1.1.1 Integration - was ist das?
- 1.1.2 Inklusion - was ist das?
- 1.1.3 Der Vergleich
- 1.2. Warum Gemeinsamer Unterricht?
- 1.2.1 Ein neues Verständnis von Bildung und Lernen
- 1.2.2 Lernen und Lehren aus konstruktivistischer Sicht
- 1.2.2.1 Lernen als Konstruktion
- 1.2.2.2 Lehren als Konstruktion
- 1.3. Charakteristische Merkmale des Gemeinsamen Unterrichts
- 1.3.1 Heterogenität statt Homogenisierung
- 1.3.1.1 Das Ergänzungmodell nach Hinz
- 1.3.2 Auf der Suche nach dem Gleichgewicht zwischen Innerer Differenzierung und Förderung der Gemeinsamkeit
- 1.3.3 Der Gemeinsame Gegenstand
- 1.3.3.1 Definition und Verständnis des Gemeinsamen Gegenstandes nach Feuser
- 1.3.3.2 Definiton und Verständnis des Gemeinsamen Gegenstandes nach Wocken
- 1.3.4 Gemeinsame Lernsituationen
- 1.3.1 Heterogenität statt Homogenisierung
- 1.1 Zum Verständnis von Integration und Inklusion
- 2. Märchen - ein Stück Kultur
- 2.1. Märchen - eine literarische Betrachtung
- 2.2 Märchen - eine didaktische Betrachtung
- 2.3 Die Bedeutung von Märchen für Kinder mit „Behinderung“
- 3. Eine Unterrichtsreihe im Gemeinsamen Unterricht: „Märchen“
- 3.1 Das Bedingungsfeld
- 3.2. Durchführung der Unterrichtsreihe zum Thema „Märchen“
- 3.2.1 Verlaufsübersicht
- 3.2.2 Ein Gemeinsamer Gegenstand: „Der Zauberspiegel“
- 3.3 Reflexion der Durchführung der Unterrichtsreihe – Inwiefern konnten die theoretischen Ideale Gemeinsamen Unterrichts in die Praxis umgesetzt werden?
- 4. Ausblick: Inklusion - nur ein Märchen... oder eine realisierbare Leitidee?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Inklusion ein realistisches Ideal für das Bildungssystem ist oder nur eine Utopie. Sie analysiert die Konzepte von Integration und Inklusion im Kontext von Gemeinsamen Unterricht und beleuchtet die didaktischen und pädagogischen Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus einem inklusiven Bildungsansatz ergeben.
- Konzepte von Integration und Inklusion im Vergleich
- Grundlagen des Gemeinsamen Unterrichts
- Didaktische und pädagogische Prinzipien des Gemeinsamen Unterrichts
- Die Rolle von Märchen im Kontext von Inklusion
- Reflexion und Auswertung einer Unterrichtsreihe zum Thema „Märchen“ im Gemeinsamen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beschäftigt sich mit den Begriffen Integration und Inklusion und analysiert ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Der Fokus liegt auf dem Gemeinsamen Unterricht und seinen theoretischen Grundlagen. Kapitel 2 beleuchtet die literarische, didaktische und kulturelle Bedeutung von Märchen. Insbesondere wird die Relevanz von Märchen für Kinder mit „Behinderung“ thematisiert. Kapitel 3 stellt eine Unterrichtsreihe zum Thema „Märchen“ im Gemeinsamen Unterricht vor. Die Analyse der Unterrichtsreihe zeigt, wie die theoretischen Ideale des Gemeinsamen Unterrichts in die Praxis umgesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Inklusion, Integration, Gemeinsamer Unterricht, Heterogenität, Differenzierung, Märchen, konstruktivistisches Lernen, Bildung, Behinderung, Unterrichtsreihe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration gliedert Menschen mit Behinderung in ein bestehendes System ein, während Inklusion das System so verändert, dass Heterogenität die Normalität ist und niemand angepasst werden muss.
Was bedeutet "Gemeinsamer Gegenstand" nach Feuser?
Es bedeutet, dass alle Kinder, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand, am selben Thema arbeiten, jedoch auf ihrem individuellen Niveau.
Warum eignen sich Märchen für den inklusiven Unterricht?
Märchen sind Teil des kulturellen Erbes, bieten klare Strukturen und Symbole und ermöglichen vielfältige didaktische Zugänge für alle Kinder.
Was ist das Ziel einer "Schule für alle"?
Ziel ist ein Bildungssystem, das jedes Kind in seiner Einzigartigkeit annimmt und gemeinsames Lernen ohne Ausgrenzung ermöglicht.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus beim Lernen?
Lernen wird als aktiver Konstruktionsprozess des Individuums gesehen; Lehrer fungieren dabei eher als Lernbegleiter denn als Wissensvermittler.
- Citar trabajo
- Regina Weber (Autor), 2003, Inklusion - nur ein Märchen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16062