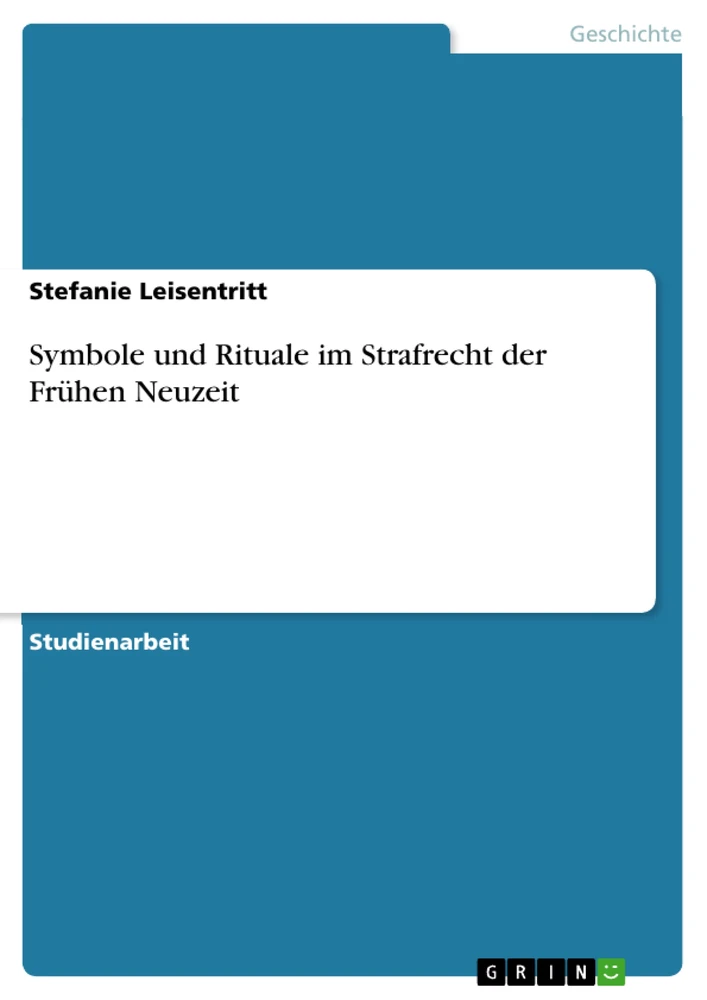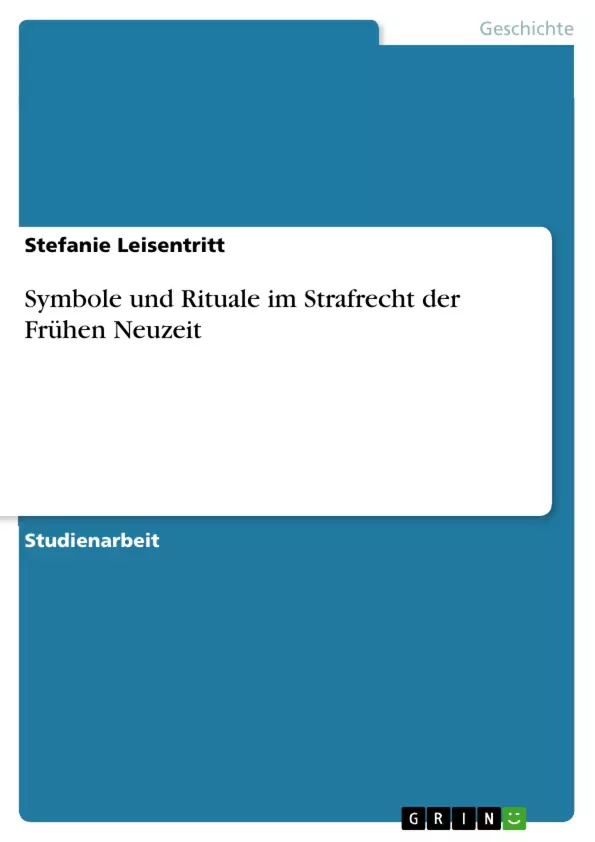Stabbrechen und Henkersmahlzeit, Prangerstrafen und Hinrichtungen als öffentliche Inszenierungen – in der heutigen Zeit muten diese Gerichtspraktiken sonderbar an und sind kaum in Einklang mit unserer Vorstellung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens und einer gerechten Strafe zu bringen. In der Frühen Neuzeit waren sie hingegen entscheidend für den ordentlichen Ablauf von Gerichtsverfahren und Bestrafung.
Symbole und Rituale, Vorstellungen von Stand und Ehre und ihre Demonstration sind fester Bestandteil der Constitutio Criminalis Carolina aus dem Jahre 1532 und aller darauffolgender Gerichtsordnungen. Exemplarisch soll hier auf die Peinliche
Gerichtsordnung der Stadt Regensburg, die zwischen den Jahren 1565 und 1575 entstanden ist, in Beispielen zurückgegriffen werden. Es handelt sich hierbei also nicht um archaische Vorstellungen, die vom einfachen Volk aufrecht erhalten wurden, sondern um Vorgaben, die von der Obrigkeit bewusst eingesetzt wurden.
Die vorliegende Arbeit möchte die ganze Vielfalt an Symbolen und Ritualen in der Rechtspraxis zeigen und ihre Bedeutungen im Einzelnen erklären.
Da sich der Ablauf eines frühneuzeitlichen Gerichtsverfahrens erheblich vom modernen Gerichtsverfahren unterscheidet, soll zunächst eine kurze Einführung in dieses Themengebiet gegeben werden. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird diese nüchterne Beschreibung des Ablaufs ergänzt durch eine Untersuchung der
symbolischen Handlungen und Rituale. Hierbei wird nicht nach dem
chronologischen Ablauf der einzelnen Verfahrensschritte gegliedert, sondern nach thematischen Gebieten. Dies bietet den Vorteil, dass ähnliche Ereignisse, die an unterschiedlichen Stellen im Gerichtsverfahren eine Rolle spielen,zusammenfassend erläutert werden können. Zunächst soll auf die Symbole der Hochgerichtsbarkeit eingegangen werden, die auch außerhalb eines laufenden Gerichtsverfahrens eine symbolische Wirkung ausüben konnten. Anschließend soll der symbolische Einsatz von Farben und Geräuschen näher betrachtet und interpretiert werden. Wie im gesamten Leben der frühneuzeitlichen Gesellschaft spielten religiöse und magische Vorstellungen auch bei der Rechtspraxis eine wichtige Rolle, die hier ebenfalls untersucht werden soll. Nicht zu unterschätzen ist
auch der Einfluss der Ehre auf den Prozess der Wahrheitsfindung und die Verurteilung und Bestrafung. Vorstellungen zu Ehre und Ehrverlust eines Menschen gipfelten schließlich im frühneuzeitlichen Sonderfall der Ehrenstrafen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Verdacht zum Urteil - Der Ablauf des frühneuzeitlichen Gerichtsverfahrens
- Symbole, Rituale, Magie und Religion
- Symbole der Hochgerichtsbarkeit
- Galgen und Pranger
- Gerichtsstab und Gerichtsschwert
- Der symbolische Einsatz von Farben
- Der symbolische Einsatz von Geräuschen
- Religiöse und magische Vorstellungen
- vor der Strafvollstreckung
- während und nach der Strafvollstreckung
- Die Rolle der Ehre im Strafrecht der Frühen Neuzeit
- Im Prozess der Wahrheitsfindung
- Bei Verurteilung und Bestrafung
- Die Ehrenstrafen
- Warum hatten Symbole und Rituale eine so große Bedeutung im frühneuzeitlichen Strafrecht?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung von Symbolen und Ritualen im frühneuzeitlichen Strafrecht. Dabei soll die Vielfalt dieser Elemente gezeigt und ihre Bedeutungen im Einzelnen erklärt werden.
- Der Ablauf des frühneuzeitlichen Gerichtsverfahrens
- Der symbolische Einsatz von Objekten, Farben und Geräuschen
- Die Rolle religiöser und magischer Vorstellungen in der Strafjustiz
- Der Einfluss der Ehre auf den Prozess der Wahrheitsfindung und die Bestrafung
- Die Bedeutung von Symbolen und Ritualen für die Ordnung der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik und die Zielsetzung der Arbeit vor und erläutert den Ablauf des frühneuzeitlichen Gerichtsverfahrens im Vergleich zum modernen Verfahren.
Das zweite Kapitel beleuchtet den Ablauf des frühneuzeitlichen Gerichtsverfahrens, beginnend bei der Generalinquisition über die Spezialinquisition und die Bedeutung des Geständnisses bis hin zur Urteilsverkündung und der öffentlichen Strafvollstreckung.
Im dritten Kapitel wird die Bedeutung von Symbolen und Ritualen in der Strafjustiz der Frühen Neuzeit untersucht. Dazu zählen die Symbole der Hochgerichtsbarkeit, wie Galgen und Pranger, der symbolische Einsatz von Farben und Geräuschen sowie die Rolle religiöser und magischer Vorstellungen.
Das vierte Kapitel widmet sich der Rolle der Ehre im Strafrecht der Frühen Neuzeit. Es wird untersucht, wie Ehre im Prozess der Wahrheitsfindung, bei Verurteilung und Bestrafung sowie bei den sogenannten Ehrenstrafen eine Rolle spielte.
Schlüsselwörter
Frühneuzeit, Strafrecht, Symbole, Rituale, Magie, Religion, Ehre, Gerichtsverfahren, Strafvollstreckung, Hochgerichtsbarkeit, Galgen, Pranger, Farben, Geräusche, Ehrenstrafen, Constitutio Criminalis Carolina
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Symbole im Strafrecht der Frühen Neuzeit?
Symbole wie der Gerichtsstab oder das Schwert dienten dazu, die Macht der Obrigkeit zu demonstrieren und den ordnungsgemäßen Ablauf eines Verfahrens rituell zu legitimieren.
Was war die Bedeutung von Galgen und Pranger?
Diese Symbole der Hochgerichtsbarkeit dienten der Abschreckung und der öffentlichen Markierung von Verbrechen, auch wenn gerade keine Hinrichtung stattfand.
Was ist eine Ehrenstrafe?
Ehrenstrafen zielten darauf ab, den sozialen Status und die Ehre eines Verurteilten öffentlich zu vernichten, was in der ständischen Gesellschaft der Frühen Neuzeit oft schlimmer als körperlicher Schmerz empfunden wurde.
Wie wurden Farben und Geräusche rituell eingesetzt?
Bestimmte Farben (wie Rot für Blut/Gericht) oder das Läuten von Armesünderglöckchen begleiteten die Inszenierung der Strafe, um die Bevölkerung emotional einzubinden.
Was ist die Constitutio Criminalis Carolina (1532)?
Die Carolina war das erste bedeutende deutsche Strafgesetzbuch, das Symbole und Rituale als festen Bestandteil der Gerichtsordnung festschrieb.
- Quote paper
- Stefanie Leisentritt (Author), 2010, Symbole und Rituale im Strafrecht der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160635