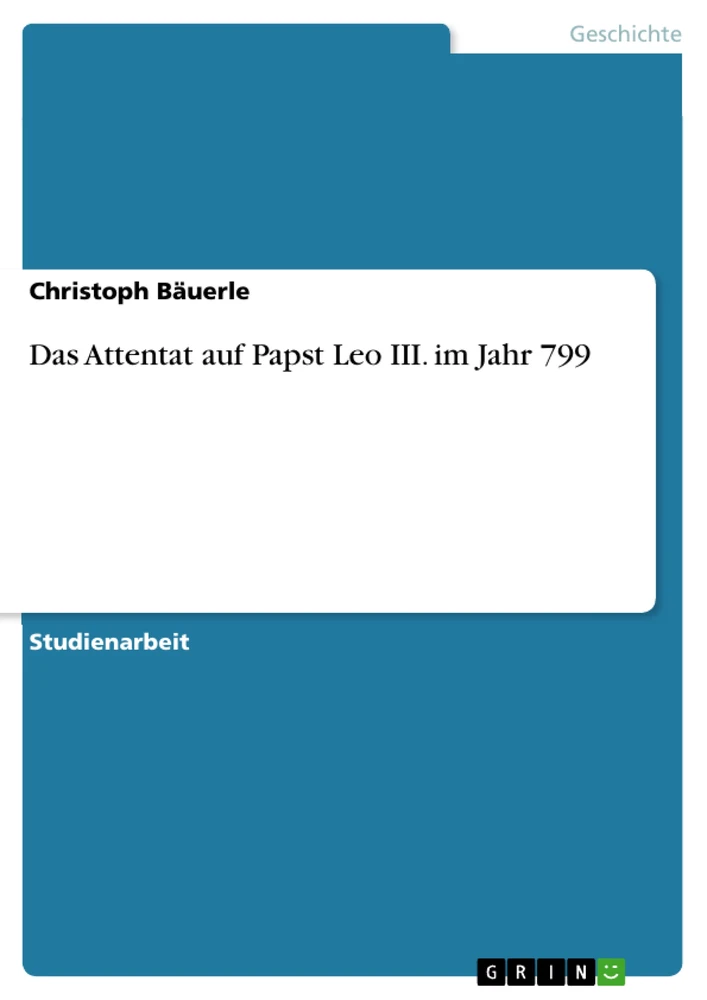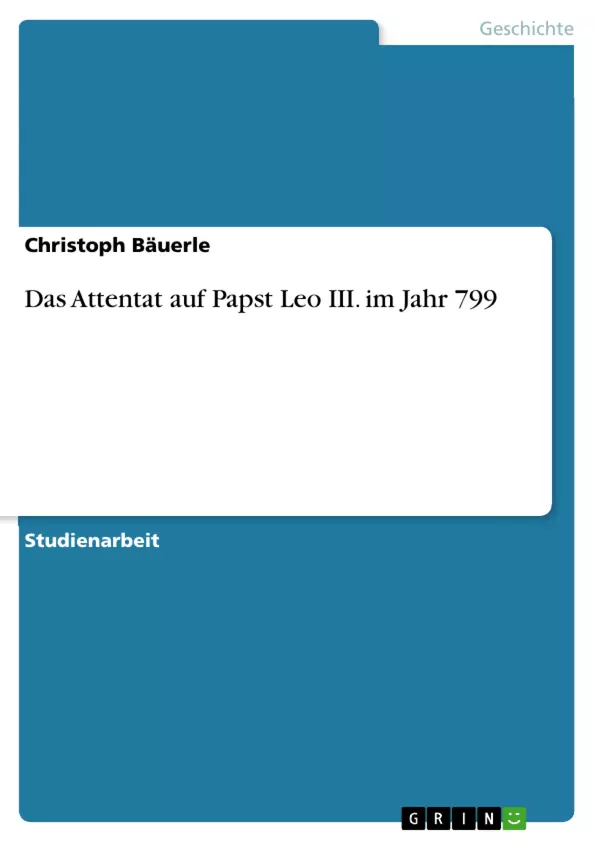Papst Leo III., Nachfolger des hoch geschätzten Papstes Hadrian I., hatte von Anfang an Akzeptanzprobleme bei der römischen Aristokratie. Seine unedle Herkunft, er war vermutlich nicht adeliger Abstammung, und auch sein angeblich verwerflicher Lebenswandel ließen zahlreiche Stimmen innerhalb der römischen Aristokratie gegen ihn aufkommen. Nur mit Widerwillen wurde er geduldet. Die innerrömischen Streitigkeiten mündeten schließlich in einem Anschlag Adliger auf den Papst während der Litania-maior-Prozession am 25. April 799.
Die genaue Rekonstruktion der Ereignisse von damals ist äußerst schwierig. Die Quellen, die die Historiker für ihre Forschungen heranziehen können, sind keinesfalls eindeutig. Sie zeigen sogar Widersprüche auf und zwar in so solchem Maß, dass sich die Frage aufdrängt, ob die realen Begebenheiten überhaupt überliefert werden sollten. Die päpstliche „Vita Leonis“ spricht zum Beispiel von zwei Anschlägen während die fränkischen Reichsannalen von nur einem Angriff berichten. Wurde Leo tatsächlich seiner Zunge und seines Augenlichtes beraubt? Wie hätte er mit solchen Verletzungen noch bis 816 sein Amt ausführen können, offensichtlich ohne körperliche Beeinträchtigungen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Tod von Papst Hadrian I. und die Wahl von Leo III.
- Leos Herkunft und sein Bund mit Karl
- Der römische Adel - Paschalis und Campulus
- Der Anschlag während der Prozession und seine Folgen
- Die wundersame Heilung der Wunden und ihre Deutung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Attentat auf Papst Leo III. im Jahr 799. Sie analysiert die Motive der Attentäter, beleuchtet die widersprüchlichen Quellen und deren Interpretation in der heutigen Forschung, und setzt dies in den Kontext der Beziehung zwischen Papsttum und fränkischem Königtum.
- Die politische Situation in Rom um 799 und die Instabilität nach dem Tod Hadrians I.
- Die Beziehung zwischen Papst Leo III. und Karl dem Großen.
- Die Rolle der römischen Aristokratie und die Motive des Attentats.
- Die widersprüchlichen Darstellungen des Attentats in den Quellen.
- Die historische Bedeutung des Attentats für die Entwicklung des abendländischen Kaisertums.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion des Attentats auf Papst Leo III. aufgrund widersprüchlicher Quellen und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der historischen Tragweite des Ereignisses im Hinblick auf die Kaiserkrönung Karls des Großen.
Der Tod von Papst Hadrian I. und die Wahl von Leo III.: Dieses Kapitel behandelt den Tod Hadrians I. und die Wahl Leos III. zum Papst. Es beleuchtet die politische Situation in Rom, die angespannte Beziehung zwischen Leo und der römischen Aristokratie und Leos Bemühungen, das Bündnis seines Vorgängers mit Karl dem Großen zu erneuern, um seine Position zu stärken. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Bündnisses für beide Seiten und dem Versuch Leos, die Unterstützung Karls zu sichern.
Leos Herkunft und sein Bund mit Karl: Das Kapitel beschreibt die unsichere Herkunft Leos III. und seine unbeliebte Stellung bei Teilen der römischen Aristokratie. Es analysiert Leos Strategie, durch ein starkes Bündnis mit Karl dem Großen seine Position zu festigen, welches durch die Übergabe des Schlüssels zum Petrusgrab und des Stadtbanners Roms symbolisiert wurde. Das Kapitel betont den Austausch von Gesandtschaften und die gegenseitige Bestätigung der Rollenverteilung zwischen geistlichem und weltlichem Herrscher.
Schlüsselwörter
Papst Leo III., Karl der Große, Attentat, römische Aristokratie, Quellenkritik, fränkisches Reich, Kaiserkrönung, Papstwahl, Bündnis, historische Tragweite.
Häufig gestellte Fragen: Attentat auf Papst Leo III.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Attentat auf Papst Leo III. im Jahr 799. Sie analysiert die Motive der Attentäter, beleuchtet die widersprüchlichen Quellen und deren Interpretation in der heutigen Forschung, und setzt dies in den Kontext der Beziehung zwischen Papsttum und fränkischem Königtum.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die politische Situation in Rom um 799, die Beziehung zwischen Papst Leo III. und Karl dem Großen, die Rolle der römischen Aristokratie und die Motive des Attentats, die widersprüchlichen Darstellungen des Attentats in den Quellen und die historische Bedeutung des Attentats für die Entwicklung des abendländischen Kaisertums.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Der Tod von Papst Hadrian I. und die Wahl von Leo III., Leos Herkunft und sein Bund mit Karl, Der römische Adel - Paschalis und Campulus, Der Anschlag während der Prozession und seine Folgen, Die wundersame Heilung der Wunden und ihre Deutung und Fazit.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion des Attentats aufgrund widersprüchlicher Quellen und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der historischen Tragweite des Ereignisses im Hinblick auf die Kaiserkrönung Karls des Großen.
Worüber berichtet das Kapitel zum Tod Hadrians I. und der Wahl Leos III.?
Dieses Kapitel behandelt den Tod Hadrians I. und die Wahl Leos III., beleuchtet die politische Situation in Rom, die angespannte Beziehung zwischen Leo und der römischen Aristokratie und Leos Bemühungen, das Bündnis seines Vorgängers mit Karl dem Großen zu erneuern, um seine Position zu stärken. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Bündnisses für beide Seiten und dem Versuch Leos, die Unterstützung Karls zu sichern.
Worum geht es im Kapitel über Leos Herkunft und seinen Bund mit Karl?
Das Kapitel beschreibt die unsichere Herkunft Leos III. und seine unbeliebte Stellung bei Teilen der römischen Aristokratie. Es analysiert Leos Strategie, durch ein starkes Bündnis mit Karl dem Großen seine Position zu festigen, welches durch die Übergabe des Schlüssels zum Petrusgrab und des Stadtbanners Roms symbolisiert wurde. Das Kapitel betont den Austausch von Gesandtschaften und die gegenseitige Bestätigung der Rollenverteilung zwischen geistlichem und weltlichem Herrscher.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Papst Leo III., Karl der Große, Attentat, römische Aristokratie, Quellenkritik, fränkisches Reich, Kaiserkrönung, Papstwahl, Bündnis, historische Tragweite.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist in der vorliegenden Zusammenfassung nicht enthalten. Die Arbeit selbst wird jedoch eine detaillierte Quellenangabe beinhalten.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt, zur Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Arbeit zitieren
- Stud. phil. Christoph Bäuerle (Autor:in), 2010, Das Attentat auf Papst Leo III. im Jahr 799, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160637