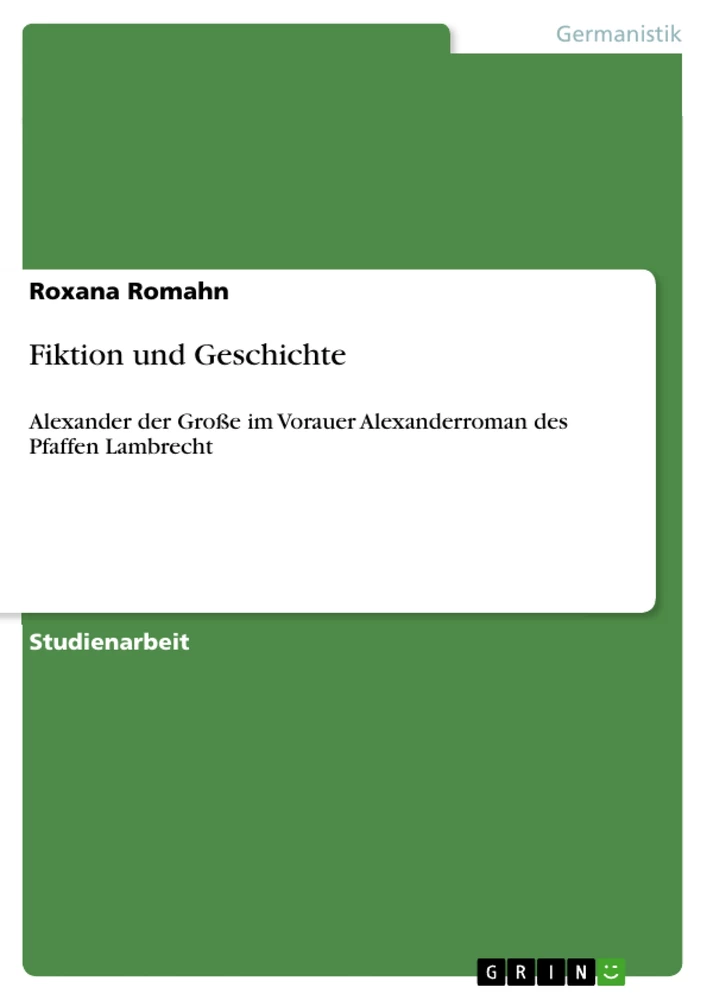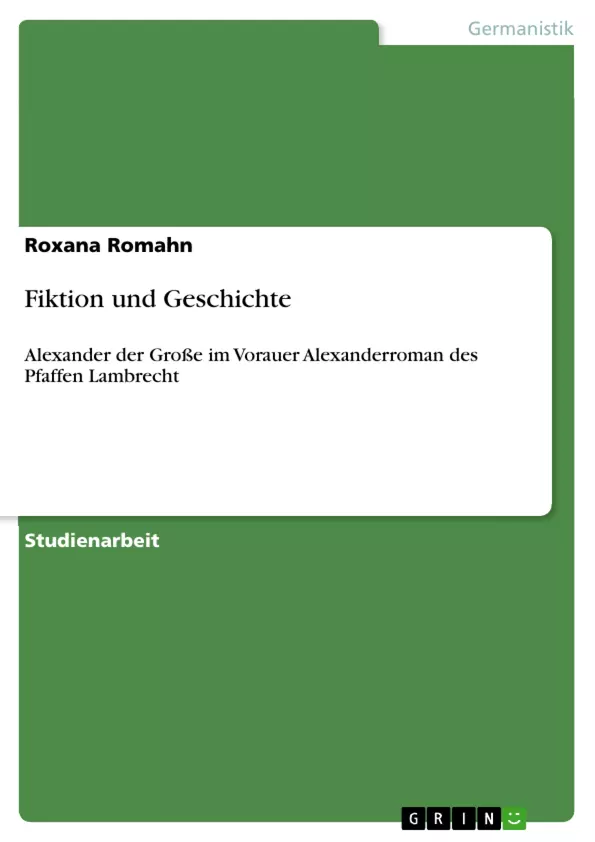Die Geschichte Alexanders des Großen ist so vielschichtig, dass sie seit nunmehr fast zwei Jahrtausenden den Forscherdrang der Historiker, die Abenteuerlust von Wagemutigen und die Fantasie von Autoren beflügelt.
Alexander ist längst über sich hinaus gewachsen und hat sich zu einem weltumspannenden Phänomen entwickelt. Und wie Ulrich Wilcken bereits bemerkte, hat jeder Gelehrte sein eigenes Alexanderbild. Allerdings ist diese Entwicklung zu einem individuellen Idealbild Alexanders keinesfalls sprunghaft erst in der Moderne aufgetreten.
. Feldherren wie Publius Cornelius Scipio Africanus Maior, Kaiser wie Augustus und Könige wie Luis XIV. nahmen ihn zum Vorbild und sein berühmter Alexanderzug faszinierte Heerführer wie Gelehrte von jeher.
Es ist also nicht verwunderlich, dass auch im Mittelalter Alexanders Ruf als großer Kämpfer und tugendhafter König vorbildhaft für Herrscher in ganz Europa war.
Diese Arbeit soll einen der so genannten mittelalterlichen Alexanderromane zum Thema haben. Es handelt sich hierbei um den Alexanderroman des Pfaffen Lamprecht, der wohl um 1150 entstand und wie man es von einem Roman über einen Vorreiter und Visionär seiner Zeit nicht anders erwarten konnte, in der mittelhochdeutschen Literatur neue Maßstäbe setzte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Zum Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht
- Quellen
- Autor
- Versionen und der Vorauer Alexander
- Inhaltsangabe des Romans
- Personen und erwähnte Namen
- Die Person Alexanders
- Familie Alexanders
- Kameraden und Freunde
- Gegner Alexanders
- Zugstrecke und erwähnte Schlachten
- Zugstrecke Alexanders im Roman und der Wirklichkeit
- Dargestellte Schlachten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht, einem mittelhochdeutschen Werk, das um 1150 entstand. Ziel der Arbeit ist es, den historischen Wahrheitsgehalt des Romans zu untersuchen und die Rolle von Legenden und dichterischen Freiheiten in der Erzählung zu beleuchten. Dabei werden die Protagonisten, Orte und Schlachten des Romans im Kontext der historischen Quellen betrachtet.
- Der historische Hintergrund des Alexanderzuges
- Die literarische Verarbeitung der Alexandergeschichte im Mittelalter
- Die Rolle von Legenden und Mythen in der Alexanderliteratur
- Die sprachliche und stilistische Gestaltung des Alexanderromans
- Die Bedeutung des Romans für die Entwicklung der mittelhochdeutschen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die historische Bedeutung Alexanders des Großen und die Entwicklung seines Mythos in der Antike und im Mittelalter dargestellt werden. Anschließend werden die Quellen des Alexanderromans des Pfaffen Lambrecht beleuchtet, insbesondere die lateinische Übersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Die Arbeit setzt sich mit dem Autor und seinen möglichen Quellen auseinander und skizziert den Entstehungskontext des Werkes.
Im weiteren Verlauf werden die wichtigsten Personen, Orte und Schlachten des Romans vorgestellt und mit historischen Fakten abgeglichen. Die Arbeit analysiert die erzählerischen Strategien des Autors und beleuchtet die Rolle von Legenden und dichterischen Freiheiten in der Darstellung des Alexanderzuges.
Schlüsselwörter
Alexanderroman, Pfaffe Lambrecht, Mittelalter, Mittelhochdeutsch, Alexander der Große, Legenden, Geschichte, Dichtung, Quellenforschung, Historizität, Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht?
Es handelt sich um ein mittelhochdeutsches Werk, das um 1150 entstand und das Leben und die Taten Alexanders des Großen literarisch verarbeitet. Es setzte neue Maßstäbe in der mittelalterlichen Literatur.
Wie historisch korrekt ist der Roman?
Die Arbeit untersucht den Wahrheitsgehalt und zeigt, wo der Autor Legenden und dichterische Freiheiten nutzt, um Alexander als vorbildhaften christlichen Herrscher darzustellen.
Welche Quellen nutzte der Pfaffe Lambrecht?
Eine wichtige Quelle war die lateinische Übersetzung des Pseudo-Kallisthenes, die im Mittelalter weit verbreitet war.
Warum war Alexander der Große im Mittelalter so populär?
Er galt als Idealbild eines tapferen Kämpfers und tugendhaften Königs, an dem sich mittelalterliche Herrscher in ganz Europa orientierten.
Welche Versionen des Romans existieren?
Die Arbeit behandelt verschiedene Fassungen, darunter auch den sogenannten "Vorauer Alexander".
- Citar trabajo
- Roxana Romahn (Autor), 2010, Fiktion und Geschichte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160728