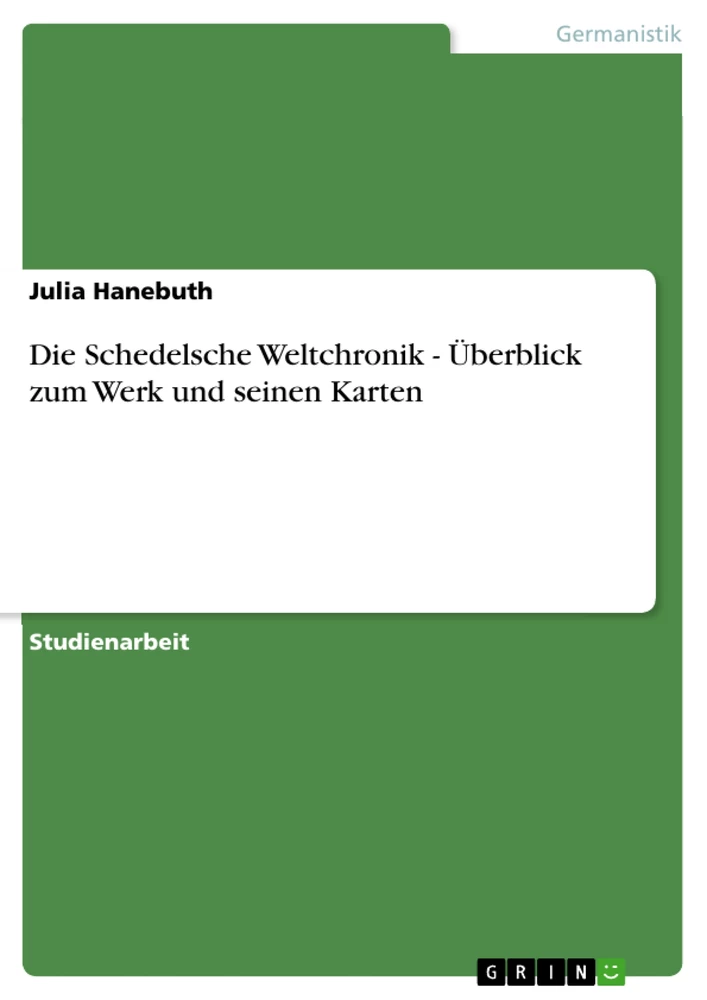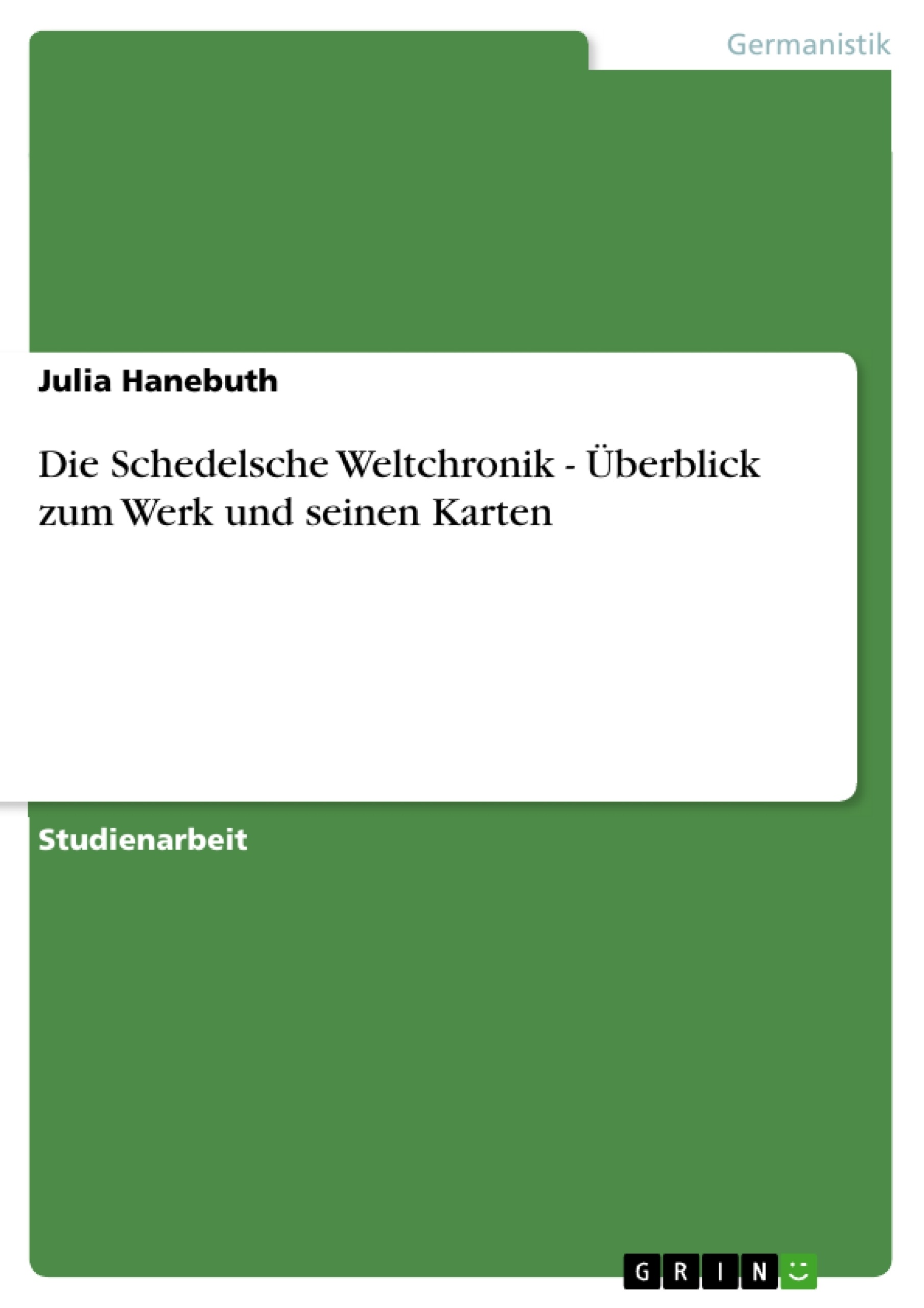Die „Schedelsche Weltchronik“ aus dem Jahr 1493 genießt in der Forschung ein hohes Ansehen. Die Chronik gilt neben den großen Bibeldrucken als das bedeutendste Verlagserzeugnis dieser Zeit. Zum einen liegt dieses Ansehen darin begründet, dass die Chronik das spätmittelalterliche Welt- und Geschichtsbild beinhaltet, aber auch daran, dass es sich wohl um die aufwändigste und kostenintensivste Verlagsproduktion der Inkunabelzeit handelt.
Darüber hinaus gilt es als das bildreichste Werk des ausgehenden 15. Jahrhunderts. In ihrer Detailfülle liegt wohl auch begründet, dass die „Schedelsche Weltchronik“ nach ihrem Erscheinen von zahlreichen Chronisten und Autoren als Quelle benutzt wurde.
Allerdings lassen sich in der Literatur auch kritische Stimmen finden, die Schedels Werk neben allem Lob u.a. „als eine imposante Ab-, Um- und Nachschreibe-Arbeit“ bezeichnen.
Nicht nur aus diesen weiter zu erörternden Vorwürfen sowie den Leistungen der Weltchronik hat sich die Schedelsche Weltchronik als Forschungsfeld etabliert, sondern auch aufgrund der einmaligen Funde zu diesem Nürnberger Projekt. Doch auch die Kartographie hat einen bedeutenden Beitrag in Form von einer Welt- und Europakarte zur „Schedelschen Weltchronik“ beigetragen.
Der vorliegenden Arbeit liegt folgende Fragestellung zugrunde, die bearbeitet werden soll: Wie werden Europa und die Welt kartographisch in der „Schedelschen Weltchronik“ dargestellt?
Ausgehend von dieser Fragestellung soll es allerdings in einem ersten Schritt darum gehen, die „Schedelsche Weltchronik“ näher vorzustellen. Daher werden in einem ersten Kapitel zunächst die wichtigsten Daten der Weltchronik zusammengefasst. Hierbei soll neben dem Inhalt sowie dem Aufbau auch die Entstehung betrachtet werden. Daran anschließend werden in einem zweiten Kapitel wichtige Personen vorgestellt, die an der Herstellung und der Produktion der Weltchronik beteiligt waren. Hierbei wird insbesondere auf die Person Hartmann Schedels eingegangen, da er der Verfasser der Weltchronik ist.
Darauf folgt in dem dritten Kapitel der vorliegenden Arbeit die Erörterung der oben genannten Fragestellung. Wobei allerdings zunächst kurz auf das zum Ende des 15.Jahrhunderts vorherrschende Weltbild eingegangen werden soll, um einen Eindruck der Zeit zu geben. Daran schließt sich die Untersuchung der beiden in dem Werk enthaltenen Karten an. In einem abschließenden Fazit sollen die gesammelten Ergebnisse zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Einführender Überblick zur „Schedelschen Weltchronik“
- 1.1 Zum Druckwerk
- 1.2 Zum Aufbau und Inhalt
- 1.3 Zu den Illustrationen
- 1.4 Zu den Quellen
- 1.5 Zum Nachdruck
- 2 Wichtige Mitarbeiter der „Schedelschen Weltchronik“
- 2.1 Mitarbeiter und Mäzene
- 2.2 Der Verfasser Hartmann Schedel
- 3 Das Kartenmaterial in der „Schedelschen Weltchronik“
- 3.1 Das vorherrschende Weltbild Ende des 15. Jahrhunderts in Europa
- 3.2 Die Weltkarte
- 3.3 Die Europakarte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der „Schedelschen Weltchronik“, einer bedeutenden Inkunabel, die das Welt- und Geschichtsbild des späten Mittelalters widerspiegelt. Die Arbeit untersucht insbesondere die kartographischen Darstellungen in der Weltchronik, mit dem Ziel, die Darstellung von Europa und der Welt im 15. Jahrhundert zu analysieren.
- Die „Schedelsche Weltchronik“ als bedeutende Inkunabel
- Das Welt- und Geschichtsbild des späten Mittelalters
- Die Rolle der Kartographie in der Weltchronik
- Die Darstellung von Europa und der Welt im 15. Jahrhundert
- Die Bedeutung der „Schedelschen Weltchronik“ als Quelle für die Geschichtsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die „Schedelsche Weltchronik“ als ein bedeutendes Werk der Inkunabelzeit vor und erläutert die Forschungsrelevanz des Werkes. Kapitel 1 bietet einen detaillierten Überblick über die Weltchronik, einschließlich ihrer Entstehung, ihres Aufbaus, ihres Inhalts und ihrer Illustrationen. Kapitel 2 befasst sich mit den wichtigen Personen, die an der Herstellung und Produktion der Weltchronik beteiligt waren, insbesondere mit Hartmann Schedel, dem Verfasser des Werkes. Kapitel 3 widmet sich den kartographischen Darstellungen in der Weltchronik, wobei zunächst das Weltbild des 15. Jahrhunderts betrachtet wird, bevor die Welt- und Europakarte detailliert analysiert werden.
Schlüsselwörter
Schedelsche Weltchronik, Inkunabel, Welt- und Geschichtsbild, Kartographie, Europakarte, Weltkarte, 15. Jahrhundert, Hartmann Schedel, Quellenforschung, Druckwerk, Illustrationen, Weltbild, .
- Citation du texte
- Julia Hanebuth (Auteur), 2008, Die Schedelsche Weltchronik - Überblick zum Werk und seinen Karten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160772