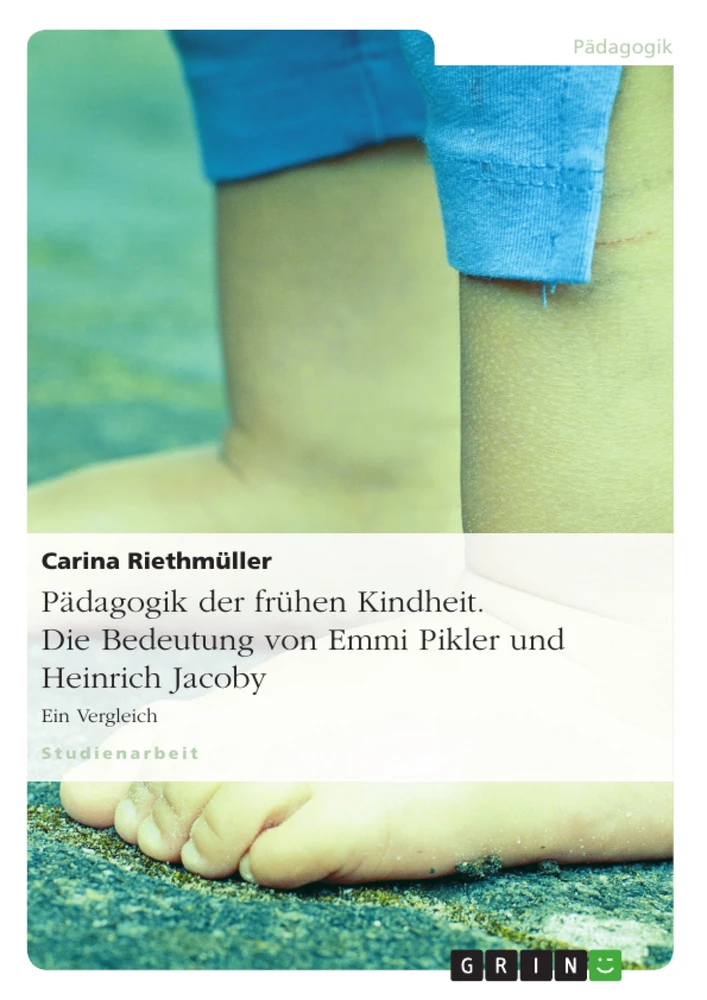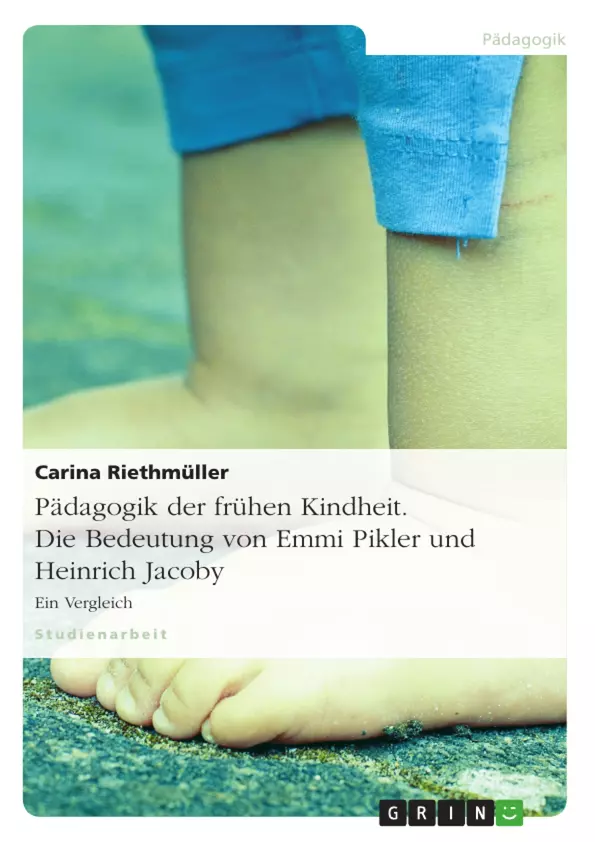Die Ansichten darüber, was eine gute Kindheit ausmacht und welche Bedeutung ihr im Leben eines Menschen zukommt, haben sich seit Jahrhunderten von Epoche zu Epoche stark gewandelt. Doch nie zuvor rückte das Kind so stark in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses, wie im 20. Jahrhundert, dem von Ellen Key ausgerufenen „Jahrhundert des Kindes“. Was sind letztendlich die „wahren“ Faktoren einer erfolgreichen Erziehung und Sozialisation? Wie kann auf die positive Entwicklung des Kindes eingewirkt werden, um diese langfristig zu fördern? – Diese Fragen stellte sich nun die neu aufkommende Reformpädagogik, vertreten durch bekannte Namen wie Maria Montessori, Rudolph Steiner oder Célestin Freinet. Auch in der noch jungen Wissenschaft der Psychologie befasste man sich zunehmend interessiert mit den Besonderheiten der kindlichen Seele, sowohl auf entwicklungs- als auch auf verhaltenspsychologischer Ebene, wie es zum Beispiel Jean Piaget und Anna Freud taten.
Doch inmitten dieser Bewegung, die der Lebensspanne der Kindheit mehr Bedeutung beimaß, als es bislang der Fall gewesen war, bildeten sich etwa gleichzeitig auch andere interessante pädagogische Ansätze heraus, die viel Wert auf das Kind legten und dabei mitunter beachtliche Erfolge vermelden konnten, heute aber bedauerlicherweise neben den bekannteren Kollegen relativ in Vergessenheit geraten sind.
Zwei dieser PädagogInnen sind Emmi Pikler und Heinrich Jacoby; als ausgebildete Kinderärztin widmete Pikler ihr Leben der Säuglings- und Kleinkindentwicklungsforschung; sie entwarf ein neues, beinahe revolutionäres Konzept der freien Bewegungsentfaltung der Kinder. Jacoby, seines Zeichens Musikpädagoge, befasste sich ein Leben lang mit der Frage nach den Möglichkeiten der Entfaltung der menschlichen Potentiale und erarbeitete in jahrelanger Zusammenarbeit mit als unbegabt geltenden Menschen ein Konzept, mithilfe dessen Leistungsschwierigkeiten in Leistungsstärken verwandelt werden konnten. Die Kindheit spielt in diesem Ansatz eine ungeahnt tragende Rolle.
So möchte ich in dieser Arbeit die pädagogischen Ansätze und Positionen Emmi Piklers und Heinrich Jacobys sowie deren Entwicklung vergleichend darstellen, um ihren Wert und ihre Bedeutung für die Pädagogik der frühen Kindheit noch einmal zum Tragen bringen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Biographischer Überblick
- 1.1. Zum Leben Emmi Piklers
- 1.2. Zum Leben Heinrich Jacobys
- 1.3. Biographische Berührungspunkte
- 2. Pädagogische Positionen und deren Entwicklungsverlauf
- 2.1. Emmi Pikler
- 2.1.1. Der Weg vom theoretischen Ansatz zum pädagogisch-praktischen Konzept
- 2.1.2. Piklers erste Publikation und deren Inhalte
- 2.1.3. Das Säuglingsheim in der Lóczystraße
- 2.2. Heinrich Jacoby
- 2.2.1. Der Weg vom theoretischen Ansatz zum pädagogisch-praktischen Konzept
- 2.2.2. Die Publikationen seines Nachlasses und deren Inhalte
- 2.3. Konzeptionelle und pädagogisch-praktische Berührungspunkte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die pädagogischen Ansätze von Emmi Pikler und Heinrich Jacoby und beleuchtet deren Bedeutung für die Pädagogik der frühen Kindheit. Der Fokus liegt auf der Darstellung ihrer Konzepte und der Entwicklung derselben, um ihren Wert für die heutige Pädagogik aufzuzeigen.
- Biografische Entwicklung und Einflüsse auf die pädagogischen Konzepte von Pikler und Jacoby
- Vergleich der pädagogischen Positionen und deren Entwicklungsgeschichte
- Analyse der konzeptionellen und praktischen Berührungspunkte beider Ansätze
- Bedeutung der Konzepte für die heutige Pädagogik der frühen Kindheit
- Hervorhebung der relativen Unbekanntheit der Ansätze im Vergleich zu bekannteren Reformpädagogen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Biographischer Überblick: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über das Leben und Wirken von Emmi Pikler und Heinrich Jacoby. Es beleuchtet wichtige Stationen in ihren Biografien, die ihre jeweiligen pädagogischen Entwicklungen prägten, wie Piklers Ausbildung zur Kinderärztin und ihre Arbeit im Säuglingsheim in der Lóczystraße, sowie Jacobys musikalische Ausbildung und seine Arbeit mit Menschen, die als "unbegabt" galten. Die Darstellung der biographischen Parallelen und Unterschiede legt den Grundstein für den folgenden Vergleich ihrer pädagogischen Ansätze. Die frühen Lebensumstände beider werden in Bezug auf ihre spätere Arbeit analysiert.
2. Pädagogische Positionen und deren Entwicklungsverlauf: Dieses Kapitel analysiert die pädagogischen Ansätze von Emmi Pikler und Heinrich Jacoby, indem es deren Entwicklung von den theoretischen Ansätzen bis zu den praktisch angewandten Konzepten nachzeichnet. Es untersucht Piklers Konzept der freien Bewegungsentfaltung und Jacobys Ansatz zur Förderung von Potenzialen bei Menschen mit vermeintlichen Leistungsschwierigkeiten. Der Vergleich hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Methoden und Zielen hervor, wobei der Fokus auf der Bedeutung der frühen Kindheit für die Entwicklung des Menschen liegt. Die Kapitel untersuchen die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung der jeweiligen Konzepte, belegen diese mit Originalzitaten und analysieren deren Implikationen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Emmi Pikler, Heinrich Jacoby, Frühe Kindheit, Pädagogik, Bewegungsentwicklung, Potenzialentfaltung, Reformpädagogik, Säuglingsentwicklung, Vergleichende Pädagogik, Bewegungsfreiheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Pädagogischen Ansätze von Emmi Pikler und Heinrich Jacoby
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die pädagogischen Ansätze von Emmi Pikler und Heinrich Jacoby und beleuchtet deren Bedeutung für die Pädagogik der frühen Kindheit. Der Fokus liegt auf der Darstellung ihrer Konzepte und der Entwicklung derselben, um ihren Wert für die heutige Pädagogik aufzuzeigen. Die Arbeit beinhaltet einen biographischen Überblick, eine Analyse der pädagogischen Positionen und deren Entwicklung, einen Vergleich konzeptioneller und praktischer Berührungspunkte sowie eine Betrachtung der Bedeutung der Konzepte für die heutige Pädagogik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Biografische Entwicklung und Einflüsse auf die pädagogischen Konzepte von Pikler und Jacoby; Vergleich der pädagogischen Positionen und deren Entwicklungsgeschichte; Analyse der konzeptionellen und praktischen Berührungspunkte beider Ansätze; Bedeutung der Konzepte für die heutige Pädagogik der frühen Kindheit; Hervorhebung der relativen Unbekanntheit der Ansätze im Vergleich zu bekannteren Reformpädagogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert. Kapitel 1 bietet einen detaillierten biographischen Überblick über Emmi Pikler und Heinrich Jacoby, inklusive wichtiger Lebensstationen und deren Einfluss auf ihre pädagogischen Entwicklungen. Kapitel 2 analysiert die pädagogischen Ansätze beider, zeichnet deren Entwicklung nach und vergleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Methoden und Zielen. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung der frühen Kindheit für die menschliche Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Emmi Pikler, Heinrich Jacoby, Frühe Kindheit, Pädagogik, Bewegungsentwicklung, Potenzialentfaltung, Reformpädagogik, Säuglingsentwicklung, Vergleichende Pädagogik, Bewegungsfreiheit.
Was wird im Kapitel "Biographischer Überblick" behandelt?
Das Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über das Leben und Wirken von Emmi Pikler und Heinrich Jacoby. Es beleuchtet wichtige Stationen in ihren Biografien, die ihre pädagogischen Entwicklungen prägten (z.B. Piklers Ausbildung zur Kinderärztin und Arbeit im Säuglingsheim, Jacobys musikalische Ausbildung und Arbeit mit Menschen, die als "unbegabt" galten). Biografische Parallelen und Unterschiede werden dargestellt, um den Vergleich ihrer pädagogischen Ansätze vorzubereiten. Die frühen Lebensumstände beider werden in Bezug auf ihre spätere Arbeit analysiert.
Was wird im Kapitel "Pädagogische Positionen und deren Entwicklungsverlauf" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die pädagogischen Ansätze von Emmi Pikler und Heinrich Jacoby, indem es deren Entwicklung von den theoretischen Ansätzen bis zu den praktisch angewandten Konzepten nachzeichnet. Es untersucht Piklers Konzept der freien Bewegungsentfaltung und Jacobys Ansatz zur Förderung von Potenzialen bei Menschen mit vermeintlichen Leistungsschwierigkeiten. Der Vergleich hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Methoden und Zielen hervor, wobei der Fokus auf der Bedeutung der frühen Kindheit für die Entwicklung des Menschen liegt. Die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Konzepte werden untersucht, belegt und deren Implikationen für die Praxis analysiert.
Welche Bedeutung haben die Ansätze von Pikler und Jacoby für die heutige Pädagogik?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Konzepte von Pikler und Jacoby für die heutige Pädagogik der frühen Kindheit und hebt deren relativen Bekanntheitsgrad im Vergleich zu bekannteren Reformpädagogen hervor. Die Analyse soll den Wert der Konzepte für die aktuelle pädagogische Praxis aufzeigen.
- Citar trabajo
- Carina Riethmüller (Autor), 2009, Pädagogik der frühen Kindheit. Die Bedeutung von Emmi Pikler und Heinrich Jacoby, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160797