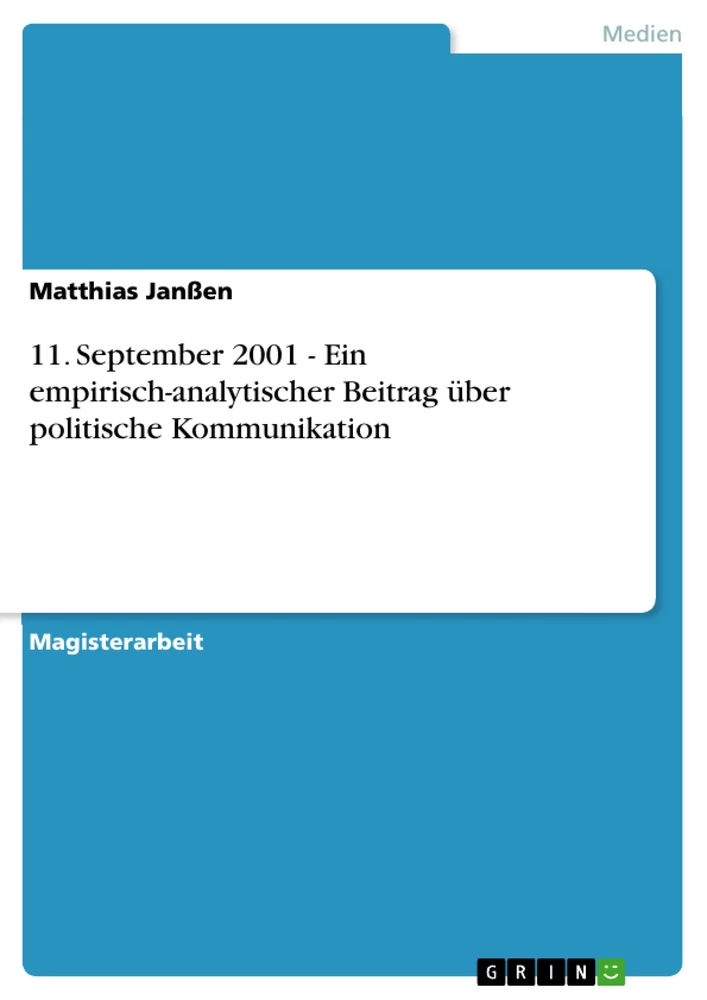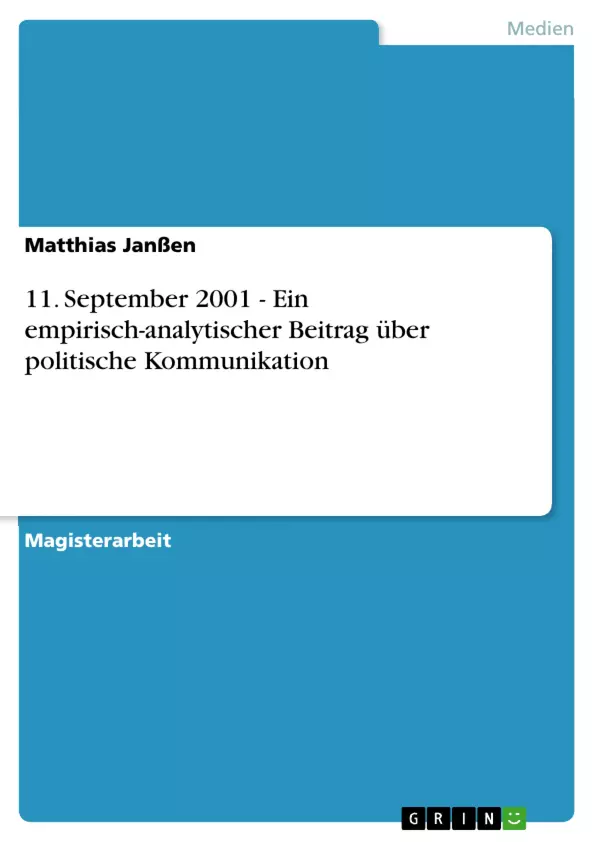Die vorliegende Arbeit stellt einen Beitrag zur politischen Kommunikation dar, welche ihren Fokus auf das Problemfeld der massenmedialen Konstruktion politischer Wirklichkeiten richtet. Politische Kommunikation, das sagt bereits der 'Begriff', befasst sich mit der kommunikativen Vermittlung politischer Sachverhalte. In Demokratien unserer Zeit gelingt dies über den 'Gebrauch' von Massenmedien. Politiker stehen der Aufgabe gegenüber, ihr politisches Handeln und Denken in der Öffentlichkeit von Massendemokratien zu dokumentieren. Die Art und Weise, wie dieser Prozess vollzogen wird, ist geprägt von der 'Beschaffenheit' der Massenmedien, welche in ihren 'sprachlichen Ausformungen' im gleichen Zuge die öffentliche Wahrnehmung der politischen Wirklichkeiten bestimmt. Für die Kommunikationswissenschaft eröffnet sich durch die Auseinandersetzung mit dieser Thematik ein Forschungsgegenstand, der einen Einblick in die Zusammenhänge von 'Politik', 'Massenmedien' und 'Wirklichkeit' gewährt und daran anschließend ein Verständnis der politisch-kommunikativen Prozesse vermitteln kann. Der besondere Wert, politische Kommunikation aus dem Blickwinkel der 'Konstruktion von Wirklichkeit' theoretisch zu beschreiben und empirisch zu untersuchen, liegt in der konstitutiven Bedeutung dieser Prozesse für die kulturelle Ausprägung von Gesellschaften begründet. Kommunikative, kognitive und kulturelle Prozesse, die in ihrer Reziprozität die Bedingungen der Wirklichkeitswahrnehmung hervorbringen und prägen, bilden dabei den Ausgangspunkt und die Grundlage für die Beantwortung der allgemeinen Frage, 'wie Wirklichkeit um uns herum entsteht'.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretische Grundlagen
- 1. Die elementaren Zusammenhänge von Massenmedien, Öffentlichkeit und Wirklichkeit
- 1.1 Ein kurzer Abriss der Entwicklung von Kommunikationsmedien
- 1.2 Erlebte Welt – Eine konstruktivistische Darstellung zur Entstehung von Wirklichkeiten
- 1.2.1 Einführung zu einer konstruktivistischen Perspektive
- 1.2.2 Das Beobachten als Grundlage von Wirklichkeitskonstruktion.
- 1.2.3 Das Entstehen wirklichkeitsrelevanter Bedingungen durch kognitive und kulturelle Prozesse
- 1.2.4 Die Alltagswelt: Allerweltswissen und die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit
- 1.3 Massenmedien: Bedingungen und Eigenarten der Wirklichkeitskonstruktion
- 1.3.1 Einführungs zur Wirklichkeit von Massenmedien
- 1.3.2 Die besonderen Merkmale der Massenmedien
- 1.3.3 Der wirklichkeitskonstituierende Einfluss von Massenmedien
- 1.3.4 Die Selektion von Nachrichten
- 1.3.5 Massenmedien und Wahrheit
- 1.4 Öffentlichkeit: Annäherung an einen Begriff
- 1.4.1 Aspekte von Öffentlichkeit
- 1.4.2 Eingrenzung des Öffentlichkeitsbegriffs
- 1.4.2.1 Die Funktion von Öffentlichkeit in Gesellschaften
- 1.4.3 Öffentlichkeit in massenmedialer Kommunikation
- 1.4.3.1 Öffentlichkeit und Themen
- 1.4.3.2 Aufmerksamkeit
- 1.4.4 Aspekte der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung
- 1.4.4.1 Die öffentliche Meinung
- 1.4.4.2 Die veröffentlichte Meinung
- Luhmann's Verständnis von öffentlicher Meinung
- 2. Die Konstruktion politischer Wirklichkeiten: Die Bedeutung rhetorischer Sprachstrategien in politischen Diskursen von Massendemokratien
- 2.1 Einführung in das Kapitel
- 2.2 Zur politischen Kommunikation in Massendemokratien
- 2.3 Der Diskurs als wirklichkeitskonstituierendes Phänomen einer massenmedialen Gesellschaft
- 2.4 Die Matrix der fünf Adressen beim Deuten von Ereignissen
- 2.5 Die Logik der öffentlichen Aufmerksamkeit: Rahmenbedingungen rhetorischer Sprachstrategien
- 2.6 Die rhetorischen Strategien politischer Kommunikation
- 2.6.1 Zur Einführung
- 2.6.2 Die semantischen Komponenten von Deutungsmustern
- 2.6.2.1 Konnotationen
- 2.6.2.2 Deontik: Positive und negative Zuschreibungen von Begriffen
- 2.6.2.3 Die Hochwertbegriffe
- 2.6.3 Moralisierung als rhetorische Strategie in politischen Diskursen
- 2.6.3.1 Die narrative Darstellungsform politischer Diskurse
- 2.6.3.2 Topoi: Argumentationsfiguren politischer Kommunikation
- 2.6.3.3 Personalisierung
- 2.6.3.4 Ent- und Gegenmoralisierung
- 2.6.4 Komplementärkategorien der Moralisierung
- 2.6.4.1 Komplementärkategorie I: Sachzwang
- 2.6.4.2 Komplementärkategorie II: Interesse
- 2.6.5 Die Bedeutung von Angstkommunikation
- 2.6.5.1 Die Funktion von Feindbildern und vom Gut-Böse-Schema
- 1. Die elementaren Zusammenhänge von Massenmedien, Öffentlichkeit und Wirklichkeit
- III. Empirischer Teil
- 1. Vorbemerkungen zur Diskursanalyse
- 1.1 Die Betrachtung des Untersuchungsgegenstands
- 1.2 Untersuchungsgegenstand und Materialauswahl
- 1.2.1 Politische Kommunikation in der Tageszeitung
- 1.2.2 Der analytische Umgang mit den Artikeln der Frankfurter Rundschau
- 1.3 Allgemeines zur Diskursanalyse
- 2. Eine diskursanalytische Beobachtung der Deutungsmuster im thematischen Zusammenhang mit dem 'Krieg gegen den Terror' in der Frankfurter Rundschau
- 2.1 Übersicht über den Aufbau der Diskursanalyse
- 2.2 Das diskursive Ereignis des 11. September: Ein Szenario der Betroffenheit und Bedrohung
- 2.2.1 Vom Ereignis zur massenmedialen Realität
- 2.2.2 Überraschungsangriff: Der Mythos von der Unverwundbarkeit
- 2.2.3 Die übergreifende Beschreibung und Bewertung des Terrorismus
- 2.2.4 Die Symbolisierung von World Trade Center und Pentagon
- 2.2.5 Vom Motiv zur Bestimmung des Feindes
- 2.2.6 Das Untergangsszenario: Die Bedrohung unserer Grundwerte
- 2.2.7 Die Solidarität der Guten im Kampf gegen das Böse
- 2.3 Die Opferrhetorik
- 2.4 Die diskursive Bedeutung der dargestellten Ermittlungen und Beweise
- 2.4.1 Das Betroffenheits- und Bedrohungsszenario als Grundlage für die Narration der Ermittlungen
- 2.4.2 Die 'Fakten und Tatsachen' des 11. September
- 2.4.3 Von der Vermutung zur Gewissheit: Die Verbindung zu bin Laden
- 2.5 Kriegsrhetorik: Strategien der Moralisierung im Vorfeld des Afghanistankriegs
- 2.5.1 Vom 'Kampf Gut gegen Böse'
- 2.5.2 Die Konstruktion der zentralen Feindbilder
- 2.5.2.1 Allgemeines zur Rolle der Feindbilder
- 2.5.2.2 Osama bin Laden
- 2.5.2.3 Al Qaeda
- 2.5.2.4 Die Taliban
- 2.5.2.5 Das übergreifende Feindbild vom internationalen Terrorismus
- 2.5.2.6 Folgen der Feindbildkonstruktion
- 2.5.4 Über den Topos der Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Zivilisation
- 2.5.5 Solidarität gegenüber den USA: Die moralische Pflicht zur uneingeschränkten Unterstützung
- 2.6 Ein Fazit über die öffentliche Legitimation des Afghanistankriegs: Die Deutungszusammenhänge politischer Argumentationslogiken
- 1. Vorbemerkungen zur Diskursanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Phänomen der politischen Kommunikation im Kontext der Massenmedien zu untersuchen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie politische Wirklichkeiten in der massenmedialen Kommunikation konstruiert werden. Die Arbeit analysiert die Relevanz von diskursiven Strategien für diesen Prozess.
- Die Rolle der Massenmedien in der Konstruktion von Wirklichkeit
- Die Bedeutung von Diskursen in der politischen Kommunikation
- Rhetorische Strategien zur Konstruktion politischer Wirklichkeiten
- Die Bedeutung von Feindbildern und Moralisierung in politischen Diskursen
- Der Einfluss von Angstkommunikation auf die öffentliche Meinung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der politischen Kommunikation und die Relevanz der Konstruktion von Wirklichkeit. Kapitel II beleuchtet die theoretischen Grundlagen, indem es die Zusammenhänge von Massenmedien, Öffentlichkeit und Wirklichkeit sowie die Bedeutung von Diskursen für die Wirklichkeitskonstruktion analysiert. Kapitel III widmet sich dem empirischen Teil der Arbeit. Es untersucht, wie die Deutungsmuster im Zusammenhang mit dem "Krieg gegen den Terror" in der Frankfurter Rundschau verwendet werden. Die Analyse fokussiert auf die rhetorischen Strategien, die im Diskurs eingesetzt werden, und wie diese zur Konstruktion von Feindbildern und zur Legitimation des Krieges beitragen.
Schlüsselwörter
Politische Kommunikation, Massenmedien, Wirklichkeitskonstruktion, Diskursanalyse, Rhetorik, Feindbilder, Moralisierung, Angstkommunikation, Öffentlichkeitsmeinung, Krieg gegen den Terror, Frankfurter Rundschau.
Häufig gestellte Fragen
Wie konstruieren Massenmedien politische Wirklichkeit?
Medien selektieren Nachrichten und nutzen sprachliche Deutungsmuster (Framing), wodurch sie bestimmen, welche Themen die Öffentlichkeit als relevant und „wahr“ wahrnimmt.
Welche rhetorischen Strategien werden in politischen Diskursen genutzt?
Wichtige Strategien sind Moralisierung, Personalisierung, die Verwendung von „Hochwertbegriffen“ (wie Freiheit oder Demokratie) sowie die Angstkommunikation durch Feindbilder.
Was ist das „Gut-Böse-Schema“ nach dem 11. September?
Nach den Anschlägen wurde die Welt oft in „Gute“ (die zivilisierte Welt) und „Böse“ (Terroristen) unterteilt, um militärische Interventionen wie den Afghanistankrieg moralisch zu legitimieren.
Was versteht man unter einer Diskursanalyse?
Eine Diskursanalyse untersucht, wie Sprache in einem bestimmten Kontext (z.B. Zeitungsartikel) Wissen erzeugt, Machtverhältnisse stützt und gesellschaftliche Realität formt.
Welche Funktion hat die Opferrhetorik in der Politik?
Sie dient dazu, Betroffenheit zu erzeugen, Solidarität einzufordern und eine moralische Pflicht zum Handeln (oder zur Unterstützung von Kriegsmaßnahmen) zu begründen.
- Quote paper
- Matthias Janßen (Author), 2003, 11. September 2001 - Ein empirisch-analytischer Beitrag über politische Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16083