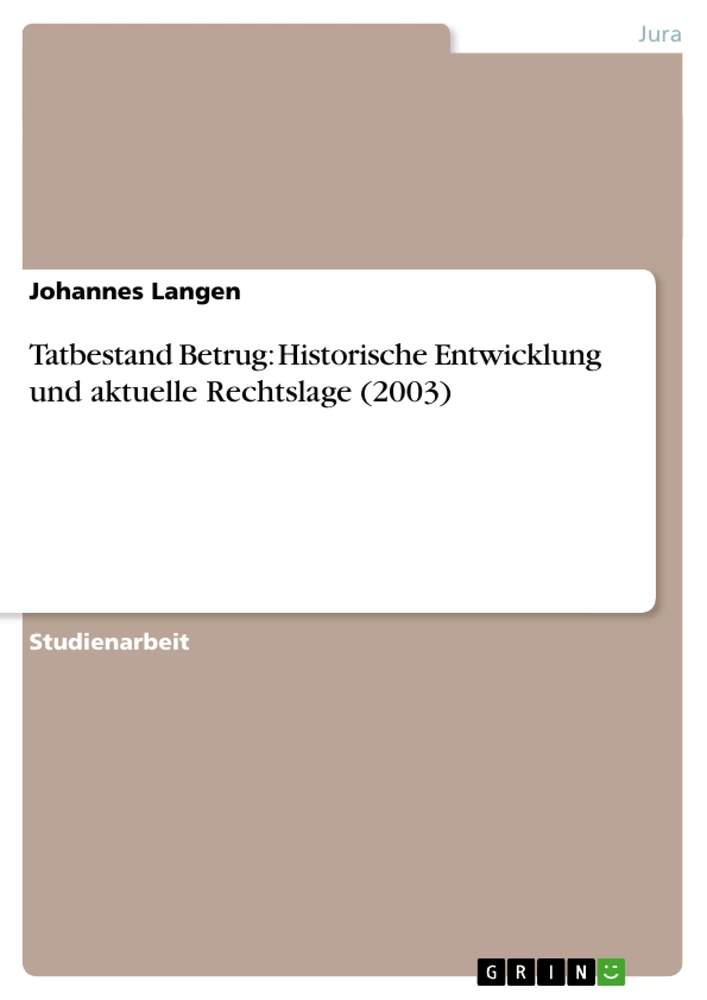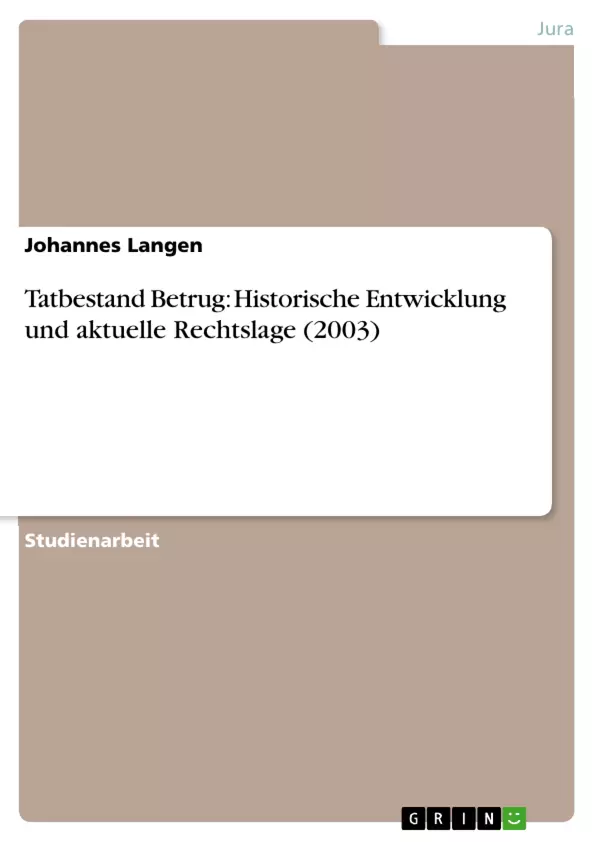Zunächst erwartet den Leser, woher unser heutiger Betrugstatbestand, § 263 StGB, kommt. Das historische Kapitel reicht zurück bis zu den Römern und umfasst etwa 1/4 der Arbeit.
Das Hauptaugenmerk liegt auf der aktuellen Rechtslage mit etwa 3/4 Anteilen. Tatbestandmerkmale, Aufbau und Diskussionsstände geben dabei einen umfassenden Überblick.
Inhaltsverzeichnis
- BETRUG
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die historische Entwicklung von Rechtsfiguren, dogmatischen Begriffen und Tatbeständen im Betrugsstrafrecht und beleuchtet den aktuellen Diskussionsstand. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Entwicklung des Betrugsrechts zu vermitteln und aktuelle Debatten zu präsentieren.
- Historische Entwicklung des Betrugsbegriffs
- Dogmatische Entwicklung und Abgrenzung zu anderen Delikten
- Aktuelle Rechtsprechung zum Vermögensschaden
- Problematik des Irrtums des Getäuschten
- Konkurrenzverhältnisse zu anderen Delikten (z.B. Erpressung)
Zusammenfassung der Kapitel
BETRUG: Diese Arbeit befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung des Betrugsstrafrechts, beginnend mit frühen Definitionen bis hin zum heutigen Verständnis. Sie analysiert die Evolution dogmatischer Begriffe und Tatbestände, beleuchtet wichtige Gerichtsentscheidungen und diskutiert aktuelle Rechtsfragen und Streitpunkte im Kontext des Betrugsdelikts. Die Arbeit untersucht kritisch die Abgrenzung des Betrugs zu ähnlichen Delikten, die Rolle des Vermögensschadens und des Irrtums des Opfers, sowie die verschiedenen Konstellationen und Fallgruppen, die im Laufe der Zeit im Betrugsstrafrecht behandelt wurden. Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Rechtsentwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen und juristischen Diskussionen. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung und dem aktuellen Diskussionsstand der Rechtsprechung zu diesem komplexen Thema.
Literaturverzeichnis: Das Literaturverzeichnis listet eine Vielzahl von juristischen Quellen und Fachartikeln auf, die für die Erstellung der Seminararbeit zum Thema Betrug herangezogen wurden. Die Liste umfasst Monographien, Lehrbücher, Zeitschriftenbeiträge und Gerichtsentscheidungen verschiedener Gerichte, und dient der Nachvollziehbarkeit der Forschung und der wissenschaftlichen Fundierung der Arbeit. Es zeigt die breite Palette an wissenschaftlicher Literatur, die für eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema Betrug notwendig ist.
Schlüsselwörter
Betrug, Strafrecht, Rechtsgeschichte, Vermögensschaden, Irrtum, Rechtsprechung, Dogmatik, Tatbestand, Abgrenzung, Konkurrenzdelikte, historische Entwicklung, aktueller Diskussionsstand.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Betrug
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die historische Entwicklung des Betrugsstrafrechts, von frühen Definitionen bis zur aktuellen Rechtsprechung. Sie analysiert die Evolution dogmatischer Begriffe und Tatbestände und beleuchtet wichtige Gerichtsentscheidungen sowie aktuelle Rechtsfragen und Streitpunkte.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die historische Entwicklung des Betrugsbegriffs, die dogmatische Entwicklung und Abgrenzung zu anderen Delikten (z.B. Erpressung), die aktuelle Rechtsprechung zum Vermögensschaden, die Problematik des Irrtums des Getäuschten und die Konkurrenzverhältnisse zu anderen Delikten.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, eine Zusammenfassung der Kapitel (Betrug und Literaturverzeichnis) und ein Schlüsselwortverzeichnis. Das Kapitel "Betrug" behandelt die geschichtliche Entwicklung des Betrugsstrafrechts umfassend, während das Literaturverzeichnis die verwendeten juristischen Quellen auflistet.
Welche Quellen werden in der Seminararbeit verwendet?
Das Literaturverzeichnis enthält eine Vielzahl von juristischen Quellen, darunter Monographien, Lehrbücher, Zeitschriftenbeiträge und Gerichtsentscheidungen. Diese Quellen dienen der wissenschaftlichen Fundierung der Arbeit und gewährleisten die Nachvollziehbarkeit der Forschung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Betrug, Strafrecht, Rechtsgeschichte, Vermögensschaden, Irrtum, Rechtsprechung, Dogmatik, Tatbestand, Abgrenzung, Konkurrenzdelikte, historische Entwicklung und aktueller Diskussionsstand.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Entwicklung des Betrugsrechts zu vermitteln und aktuelle Debatten zu präsentieren.
Welche Aspekte des Betrugsrechts werden kritisch untersucht?
Die Arbeit untersucht kritisch die Abgrenzung des Betrugs zu ähnlichen Delikten, die Rolle des Vermögensschadens und des Irrtums des Opfers sowie verschiedene Konstellationen und Fallgruppen im Betrugsstrafrecht.
Auf welche Aspekte legt die Seminararbeit den Schwerpunkt?
Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung und dem aktuellen Diskussionsstand der Rechtsprechung zum Betrug.
- Quote paper
- Johannes Langen (Author), 2003, Tatbestand Betrug: Historische Entwicklung und aktuelle Rechtslage (2003), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16084