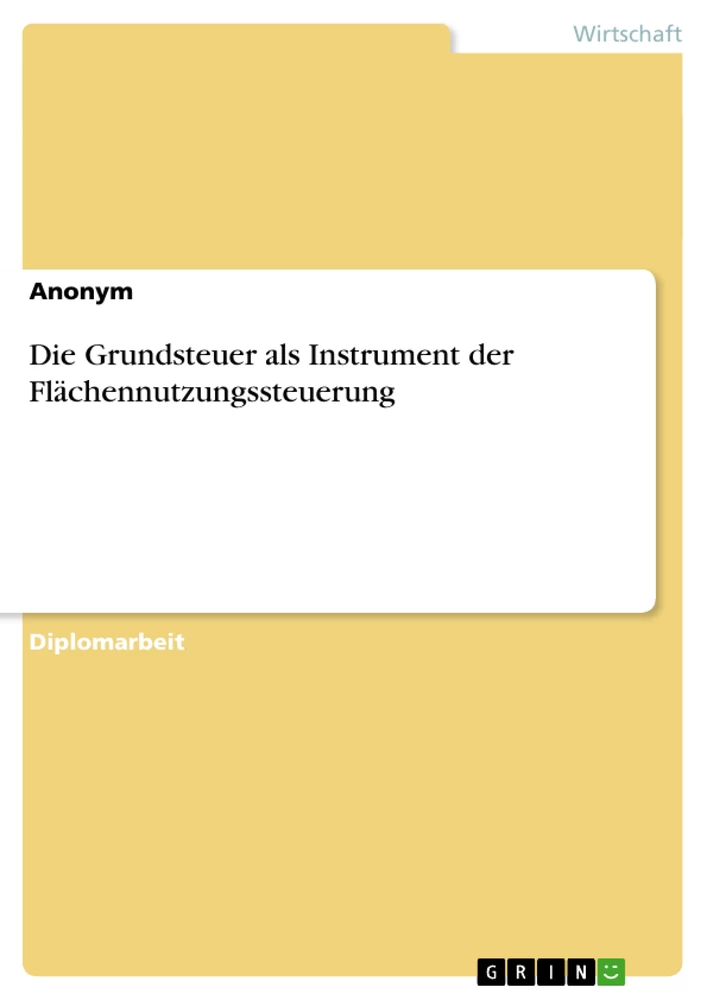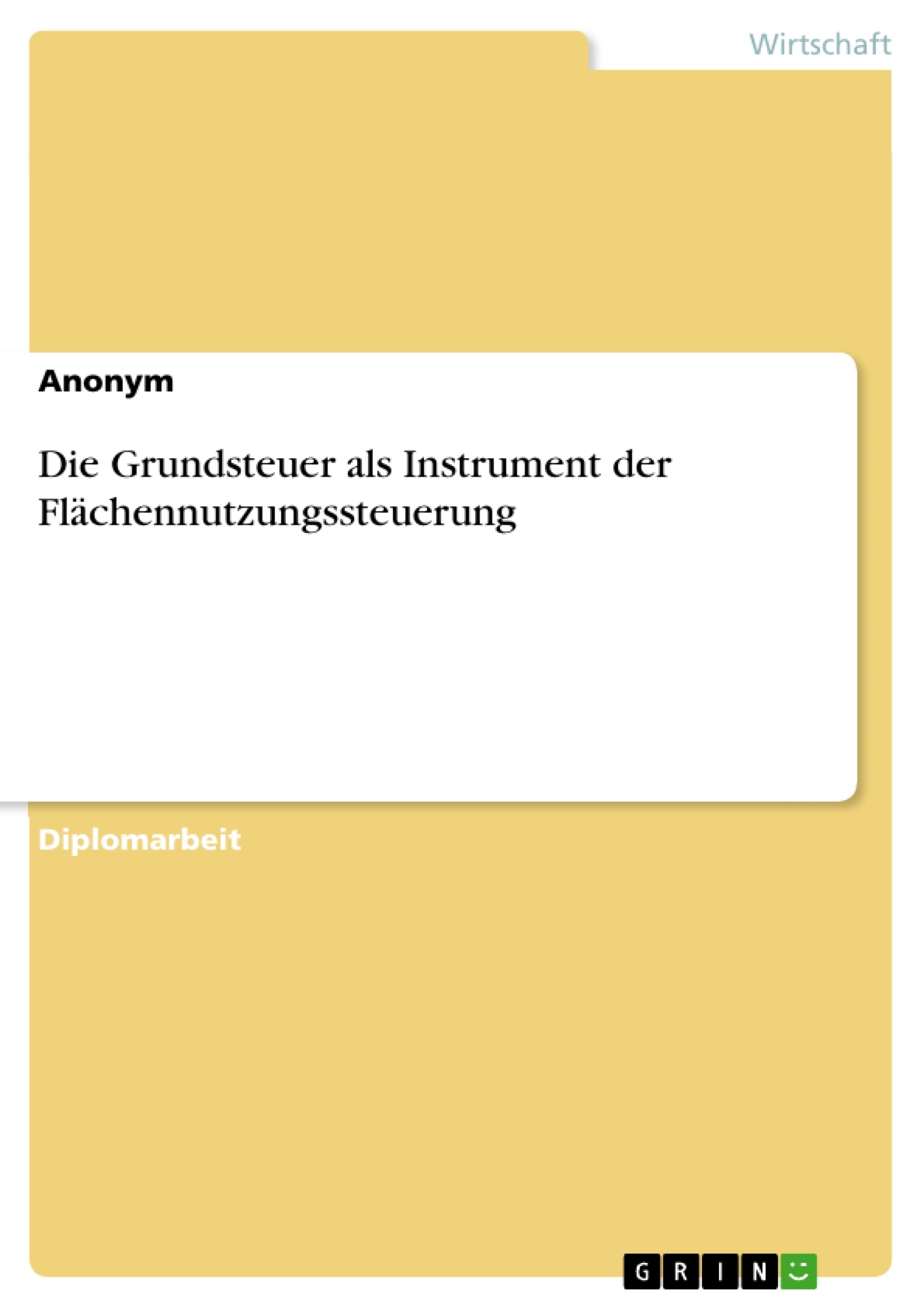1 Einleitung
1.1 Hintergrund
Boden nimmt als Ressource eine Sonderstellung durch seine speziellen Charakteristika und auch in der Empfindung der Menschen ein. Boden ist immobil, sein Wert wird von seiner Beschaffenheit und Lage, aber auch von der Nutzung der benachbarten Flächen beeinflusst. An Boden bestehen im Unterschied zu Wasser und Luft private Verfügungsrechte unterschiedlichster Art.
Vor allem aber: Die Ressource Boden ist endlich. Boden kann zwar nicht „verbraucht“ werden, aber jede Form der Land- und Raumnutzung durch den Menschen findet unter Inanspruchnah-me von Flächen statt, die in vielen Fällen irreversible Schäden auslöst und kaum rückkehrbar ist. Die Ressource Boden erfüllt eine Vielzahl von Funktionen: Der Boden nimmt eine zentrale Stellung im Ökosystem ein, dokumentiert Natur- und Kulturgeschichte und ist unentbehrlich für die Produktion von Lebensmitteln und Biomasse wie auch für die Schaffung von Wohnraum, Arbeitsplätzen und Erholungsflächen. Aus diesen unterschiedlichen Funktionen ergeben sich Konflikte, da sich der überwiegende Teil der Nutzungsformen gegenseitig ausschließt.
Die permanente Zunahme an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland stellt die Bodenpolitik vor neue Herausforderungen, denn die Nutzungsumwidmung durch den Menschen hat ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen. Jede Flächeninanspruchnahme bedeutet eine erhebliche Einschränkung zukünftiger Nutzungsoptionen.
1.2 Problemstellung
In der Nachhaltigkeitsdebatte wird die Grundsteuer als „blinder Fleck“ der Politik zur Flächeneffizienz bezeichnet. Es wird eine Reform der Grundsteuer zum Zweck der Flächennutzungssteuerung unter Beibehaltung ihrer traditionellen Funktionen als Kommunalsteuer gefordert. In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob die Grundsteuer zur Steuerung der Flächennutzung geeignet ist.
Dazu muss festgestellt werden, ob ein staatlicher Eingriff in den Markt gerechtfertigt ist, welche Ziele erreicht werden müssen und ob von einer Besteuerung von Grund und Boden Lenkungs-wirkungen auf die Nachfrage nach Flächen zur Wohnraumerstellung und auf die Nutzung von Bestandsflächen ausgehen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hintergrund
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Vorgehensweise
- 2 Flächennutzung
- 2.1 Flächennutzung heute und Entwicklungen der letzten Jahre
- 2.2 Theoretische Grundlagen des Bodenmarkts
- 2.2.1 Grundrententheorien
- 2.2.2 Grundrente und Nutzungsstruktur
- 2.3 Charakteristika des Bodenmarktes
- 2.3.1 Öffentliche Güter
- 2.3.2 Unvollständige Informationen
- 2.3.3 Externe Effekte
- 2.3.4 Staatliche Eingriffe
- 2.4 Ursachen und Folgen der Flächenneuinanspruchnahme und ineffizienter Nutzung
- 2.4.1 Zersiedelung
- 2.4.2 Saltatorisches Siedeln
- 2.4.3 Demographie und Völkerwanderung
- 2.4.4 Der optionale Charakter von Grund und Boden
- 2.4.5 Ökonomische Auswirkungen
- 2.4.6 Soziale und städtebauliche Auswirkungen
- 2.4.7 Ökologische Auswirkungen
- 2.5 Zusammenfassung
- 3 Flächennutzungssteuerung
- 3.1 Ziele der Flächennutzungssteuerung
- 3.1.1 Quantitative Ziele bzw. Flächensparziele
- 3.1.2 Qualitative Ziele bzw. Flächennutzungsziele
- 3.2 Zielkonflikte
- 3.2.1 Sich konterkarierende Ziele der Flächennutzungssteuerung
- 3.2.2 Zielkonflikte mit Wirtschafts- und Sozialverträglichkeit
- 3.3 Flächennutzungssteuerung heute
- 3.3.1 Die Instrumente und ihre Funktionsweise
- 3.3.2 Grenzen der Steuerbarkeit mit den vorhandenen Mitteln
- 3.4 Flächenpolitische Handlungsoptionen
- 3.5 Anwendung auf die Flächennutzungssteuerung
- 3.5.1 Steuer vs. Rechtehandel
- 3.5.2 Eine Steuer als Lenkungsinstrument
- 3.5.3 Die Zusatzlast der Besteuerung
- 3.5.4 Die doppelte Dividende
- 3.6 Festlegung der Bewertungsziele
- 3.7 Zusammenfassung
- 4 Die Grundsteuer geltenden Rechts
- 4.1 Entwicklung und Bedeutung der Grundsteuer
- 4.2 Aufbau und Funktionsweise
- 4.3 Reformbedarf
- 4.3.1 Flächenpolitische Mängel
- 4.3.2 Steuertechnische Mängel
- 4.4 Zusammenfassung
- 5 Reform der Grundsteuer
- 5.1 Anforderungen an die Reformvorschläge
- 5.1.1 Steuerinzidenz
- 5.1.1.1 Bodensteuer
- 5.1.1.2 Gebäudesteuer
- 5.1.2 Die Zusatzlast der Besteuerung
- 5.1.3 Verzerrung der zeitlichen Nutzungsstruktur
- 5.1.4 Rechtfertigung der Grundsteuer
- 5.1.5 Fiskalziel
- 5.1.6 Neutralität
- 5.1.7 Erhebungs- und Entrichtungskosten
- 5.1.8 Praktikabilität
- 5.1.9 Durchsetzbarkeit
- 5.1.10 Anforderung an kommunale Steuern
- 5.1.11 Anforderungs-Konflikte
- 5.2 Die Reformdiskussion
- 5.3 Darstellung und Analyse der Reformvorschläge
- 5.3.1 Bemessungsgrundlage Fläche
- 5.3.1.1 Mengensteuer
- 5.3.1.2 Die Flächennutzungsteuer
- 5.3.2 Bemessungsgrundlage Wert
- 5.3.2.1 Die Bodenwertsteuer
- 5.3.2.2 Kombinationsmodelle
- 5.3.3 Eine bodenwertorientierte Reform
- 5.4 Zusammenfassung
- 6 Schlussbemerkung
- 6.1 Ergebnisse der Untersuchung und Handlungsempfehlung
- 6.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Eignung der Grundsteuer als Instrument zur Steuerung der Flächennutzung. Die Arbeit analysiert den Bodenmarkt, identifiziert Marktversagen und bewertet verschiedene Reformvorschläge der Grundsteuer hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren und eine effizientere Flächennutzung zu fördern.
- Analyse des Bodenmarktes und seiner Unvollkommenheiten
- Bewertung der Ziele und Zielkonflikte der Flächennutzungssteuerung
- Untersuchung verschiedener Instrumente der Flächennutzungssteuerung
- Bewertung von Reformvorschlägen für die Grundsteuer
- Entwicklung eines Anforderungskatalogs für eine Grundsteuerreform
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt den Hintergrund der Arbeit, die Problemstellung der ineffizienten Flächennutzung und skizziert die Vorgehensweise der Untersuchung.
2 Flächennutzung: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die aktuelle Flächennutzung in Deutschland, beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Bodenmarktes (inkl. Grundrententheorien), analysiert die Charakteristika des Bodenmarktes (Marktunvollkommenheiten wie öffentliche Güter, unvollständige Informationen und externe Effekte), und untersucht die Ursachen und Folgen der Flächenneuinanspruchnahme und ineffizienter Nutzung unter ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekten.
3 Flächennutzungssteuerung: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele der Flächennutzungssteuerung (quantitativ und qualitativ), identifiziert Zielkonflikte und analysiert die bestehenden Instrumente und ihre Grenzen. Es werden alternative Handlungsoptionen wie Steuern und Rechtehandel vorgestellt und deren Eignung für die Flächennutzungssteuerung bewertet. Abschließend werden Bewertungsziele für die Analyse der Reformvorschläge festgelegt.
4 Die Grundsteuer geltenden Rechts: Hier wird die Entwicklung und Bedeutung der Grundsteuer erläutert, ihr Aufbau und ihre Funktionsweise beschrieben. Der Abschnitt beleuchtet die bestehenden Reformbedürfnisse, sowohl aus flächenpolitischer als auch steuertechnischer Sicht, und zeigt die Mängel des bestehenden Systems auf.
5 Reform der Grundsteuer: Dieses Kapitel entwickelt einen Anforderungskatalog für eine Grundsteuerreform, wobei die Steuerinzidenz, Zusatzlast, zeitliche Nutzungsstruktur, Rechtfertigung, Fiskalziele und Neutralität berücksichtigt werden. Es werden verschiedene Reformvorschläge vorgestellt und anhand des Anforderungskatalogs und der Bewertungsziele analysiert und bewertet. Die Analyse umfasst Mengensteuern, die Flächennutzungsteuer, die Bodenwertsteuer und Kombinationsmodelle.
Schlüsselwörter
Grundsteuer, Flächennutzungssteuerung, Bodenmarkt, Marktversagen, Reformvorschläge, Bodenwertsteuer, Flächennutzungsteuer, Lenkungssteuer, Fiskalpolitik, Ökologische Steuerreform, Nachhaltige Entwicklung, Innenentwicklung, Zersiedelung, Bodenrichtwert, Steuerinzidenz, Zusatzlast, Kommunalfinanzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Reform der Grundsteuer als Instrument zur Flächennutzungssteuerung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Eignung der Grundsteuer als Instrument zur Steuerung der Flächennutzung. Sie analysiert den Bodenmarkt, identifiziert Marktversagen und bewertet verschiedene Reformvorschläge der Grundsteuer hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren und eine effizientere Flächennutzung zu fördern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse des Bodenmarktes und seiner Unvollkommenheiten, Bewertung der Ziele und Zielkonflikte der Flächennutzungssteuerung, Untersuchung verschiedener Instrumente der Flächennutzungssteuerung, Bewertung von Reformvorschlägen für die Grundsteuer und Entwicklung eines Anforderungskatalogs für eine Grundsteuerreform.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus sechs Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik, Problemstellung und Vorgehensweise. Kapitel 2 (Flächennutzung): Überblick über die aktuelle Flächennutzung, theoretische Grundlagen des Bodenmarktes, Charakteristika des Bodenmarktes und Ursachen/Folgen von Flächenneuinanspruchnahme und ineffizienter Nutzung. Kapitel 3 (Flächennutzungssteuerung): Ziele der Flächennutzungssteuerung, Zielkonflikte, bestehende Instrumente und ihre Grenzen, sowie alternative Handlungsoptionen. Kapitel 4 (Die Grundsteuer geltenden Rechts): Entwicklung und Bedeutung der Grundsteuer, Aufbau, Funktionsweise und Reformbedarf. Kapitel 5 (Reform der Grundsteuer): Anforderungskatalog für eine Reform, Analyse verschiedener Reformvorschläge (inkl. Mengensteuern, Flächennutzungsteuer, Bodenwertsteuer und Kombinationsmodelle). Kapitel 6 (Schlussbemerkung): Ergebnisse, Handlungsempfehlungen und Ausblick.
Welche Reformvorschläge für die Grundsteuer werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Reformvorschläge, die sich in ihrer Bemessungsgrundlage unterscheiden: Modelle mit der Fläche als Bemessungsgrundlage (z.B. Mengensteuer, Flächennutzungsteuer) und Modelle mit dem Wert als Bemessungsgrundlage (z.B. Bodenwertsteuer). Auch Kombinationsmodelle werden berücksichtigt.
Welche Kriterien werden zur Bewertung der Reformvorschläge verwendet?
Die Bewertung der Reformvorschläge erfolgt anhand eines Anforderungskatalogs, der Kriterien wie Steuerinzidenz, Zusatzlast, zeitliche Nutzungsstruktur, Rechtfertigung, Fiskalziele, Neutralität, Erhebungs- und Entrichtungskosten, Praktikabilität, Durchsetzbarkeit und Anforderungen an kommunale Steuern umfasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter: Grundsteuer, Flächennutzungssteuerung, Bodenmarkt, Marktversagen, Reformvorschläge, Bodenwertsteuer, Flächennutzungsteuer, Lenkungssteuer, Fiskalpolitik, Ökologische Steuerreform, Nachhaltige Entwicklung, Innenentwicklung, Zersiedelung, Bodenrichtwert, Steuerinzidenz, Zusatzlast, Kommunalfinanzen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Flächennutzung und Grundsteuerreform.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2010, Die Grundsteuer als Instrument der Flächennutzungssteuerung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160859