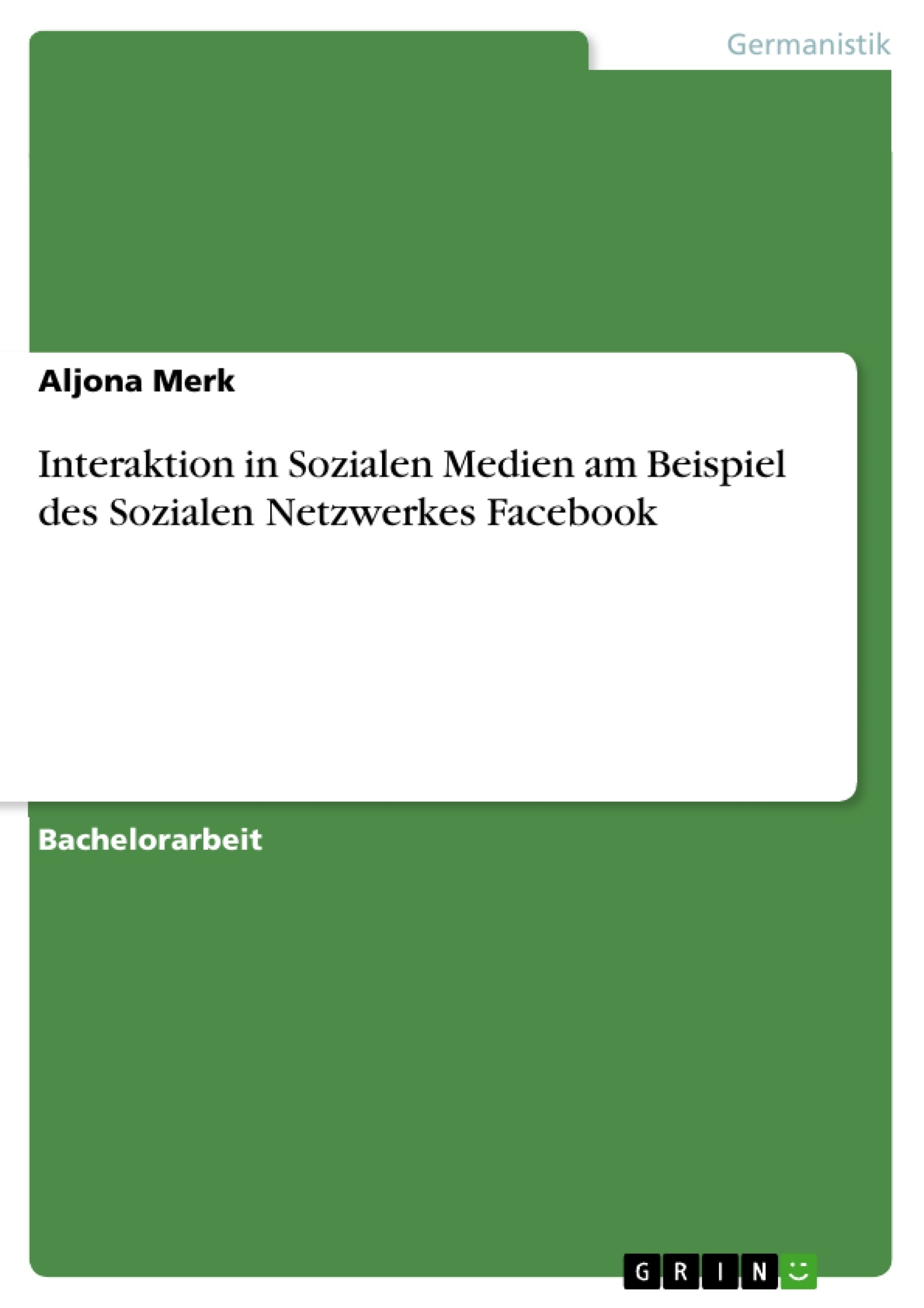Ziel dieser Arbeit ist es, darzustellen, welche Möglichkeiten dem Nutzer zur Verfügung stehen, um innerhalb Sozialer Medien (im Fokus: Soziale Netzwerke) sozial zu interagieren (Kapitel 1). Ferner soll herausgearbeitet werden, dass diese Interaktionsmöglichkeiten im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation zwar einerseits Kommunikationsgrenzen aufweichen, andererseits jedoch neue Grenzen schaffen, weil sie den Bedingtheiten der Online-Kommunikation unterliegen. Da Online-Kommunikation zum Großteil textbasiert ist, zeigen sich vor allem in der Verwendung der Sprache deutliche Auswirkungen jener Grenzen und gleichzeitig Versuche, sie zu überwin-den (Kapitel 2). Die folgenden Fragen werden im Rahmen dieser Arbeit besonders verfolgt:
F1: Welche Möglichkeiten der Interaktion bieten Soziale Medien?
F2: Welche Begrenzungen der Interaktion ergeben sich dadurch, dass es sich in Sozialen Medien um Online-Kommunikation handelt?
F3: Welche sprachlichen Auswirkungen zeigen sich durch diese Begrenzungen in der Interaktion in Sozialen Medien?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Hinführung
- 0.1 Einleitung
- 0.2 Zielsetzung und Fragestellung
- 0.3 Korpus und formale Hinweise
- 1. Soziale Medien und ihre Anwendungen
- 1.1 Die Ideologie: Web 2.0
- 1.2 Die Technik: schnell. einheitlich. verfügbar
- 1.3 Die Anwendungen: aktuell. wechselseitig. vernetzt
- 1.3.1 E-Mail
- 1.3.2 (Mikro-)Blog
- 1.3.3 Chat
- 1.3.4 Social Sharing
- 1.3.5 Social Games
- 1.3.6 Soziale Netzwerke
- 2. Kommunikation in Sozialen Medien
- 2.1 Charakteristika der Online-Kommunikation
- 2.1.1 Kommunikationsarten
- 2.1.2 Kommunikationskanäle und Entkörperlichung
- 2.1.3 Entzeitlichung und Enträumlichung
- 2.1.4 Privatheit und Öffentlichkeit
- 2.2 Textbasierte Begegnungen: Sprache in der Online-Kommunikation
- 2.2.1 Oraliteralität
- 2.2.2 Emoticons
- 2.2.3 Emulierte Prosodie
- 2.2.4 Lexik
- 3. Das Soziale Netzwerk Facebook
- 3.1 Netzwerkbildung
- 3.1.1 Profil
- 3.1.2 Freunde
- 3.2 Netzwerkpflege
- 3.2.1 Startseite und Neuigkeiten
- 3.2.2 Nachrichten und Postfach
- 3.2.3 Facebook-Chat
- 3.2.4 Anstupsen
- 3.2.5 Anwendungen und Spiele
- 3.2.6 Facebook mobil
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Interaktionsmöglichkeiten in sozialen Medien, insbesondere in sozialen Netzwerken, und vergleicht diese mit der Face-to-Face-Kommunikation. Sie beleuchtet die Grenzen und Möglichkeiten der Online-Kommunikation und analysiert die sprachlichen Auswirkungen dieser Begrenzungen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Interaktionsformen und der Anpassung der Sprache an die spezifischen Bedingungen des Online-Mediums.
- Interaktionsmöglichkeiten in sozialen Medien
- Vergleich zwischen Online- und Face-to-Face-Kommunikation
- Grenzen und Möglichkeiten der Online-Kommunikation
- Sprachliche Auswirkungen der Online-Kommunikation
- Analyse des sozialen Netzwerks Facebook als Beispiel
Zusammenfassung der Kapitel
0. Hinführung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt den Wandel des Internets vom rein abruforientierten Medium hin zum interaktiven Mitmachnetzwerk (Web 2.0). Es hebt die zunehmende Bedeutung kommunikativer Anwendungen hervor und betont die Möglichkeiten der Nutzer, Inhalte selbst zu generieren und zu teilen. Die Arbeit fokussiert auf die Herausforderungen der Online-Kommunikation, insbesondere das Fehlen nonverbaler und paraverbaler Zeichen und die daraus resultierenden Anpassungen in der Kommunikation.
1. Soziale Medien und ihre Anwendungen: Dieses Kapitel definiert soziale Medien und ihre verschiedenen Anwendungen, von E-Mail über Blogs und Chats bis hin zu sozialen Netzwerken und Social Games. Es beleuchtet die technischen und ideologischen Grundlagen des Web 2.0 und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Interaktion und des Informationsaustauschs auf. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der verschiedenen Plattformen und deren Funktionen im Kontext der Online-Kommunikation.
2. Kommunikation in Sozialen Medien: Dieses Kapitel analysiert die Charakteristika der Online-Kommunikation im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation. Es thematisiert die Entkörperlichung, Entzeitlichung und Enträumlichung und deren Auswirkungen auf die Kommunikation. Ein wichtiger Aspekt ist die Anpassung der Sprache an die textbasierte Umgebung, einschließlich der Verwendung von Emoticons und der Entwicklung einer spezifischen Online-Linguistik. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Kompensationsmechanismen für fehlende nonverbale Kommunikation.
3. Das Soziale Netzwerk Facebook: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das soziale Netzwerk Facebook als konkreten Fall einer Plattform sozialer Interaktion. Es werden die Möglichkeiten der Netzwerkbildung (Profilerstellung, Freundschaftsanfragen) und die Funktionen der Netzwerkpflege (Startseite, Nachrichten, Chat, Anwendungen) ausführlich erläutert. Die Analyse zeigt anhand konkreter Beispiele, wie die Interaktion auf Facebook funktioniert und welche sprachlichen Besonderheiten sich zeigen.
Schlüsselwörter
Soziale Medien, soziale Netzwerke, Online-Kommunikation, Face-to-Face-Kommunikation, Interaktion, Web 2.0, Sprache, Textbasierte Kommunikation, Emoticons, Facebook, Netzwerkbildung, Netzwerkpflege, Entkörperlichung, Entzeitlichung, Enträumlichung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Soziale Medien und Online-Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Interaktionsmöglichkeiten in sozialen Medien, insbesondere in sozialen Netzwerken, und vergleicht diese mit der Face-to-Face-Kommunikation. Sie beleuchtet die Grenzen und Möglichkeiten der Online-Kommunikation und analysiert die sprachlichen Auswirkungen dieser Begrenzungen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Interaktionsformen und der Anpassung der Sprache an die spezifischen Bedingungen des Online-Mediums. Ein besonderes Beispiel hierfür ist das soziale Netzwerk Facebook.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Interaktionsmöglichkeiten in sozialen Medien, Vergleich zwischen Online- und Face-to-Face-Kommunikation, Grenzen und Möglichkeiten der Online-Kommunikation, sprachliche Auswirkungen der Online-Kommunikation und eine detaillierte Analyse des sozialen Netzwerks Facebook.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Hinführung, die den Wandel des Internets und die Bedeutung kommunikativer Anwendungen beschreibt; ein Kapitel zu sozialen Medien und ihren Anwendungen (E-Mail, Blogs, Chats, soziale Netzwerke etc.); ein Kapitel zur Kommunikation in sozialen Medien, das die Charakteristika der Online-Kommunikation und die Anpassung der Sprache analysiert; und schließlich ein Kapitel zum sozialen Netzwerk Facebook, das Netzwerkbildung und -pflege detailliert untersucht.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie sich die Kommunikation in sozialen Medien von der Face-to-Face-Kommunikation unterscheidet, welche Kompensationsmechanismen für fehlende nonverbale Kommunikation eingesetzt werden (z.B. Emoticons, emulierte Prosodie) und wie die Sprache an die textbasierte Umgebung angepasst wird. Die Analyse von Facebook veranschaulicht diese Aspekte anhand eines konkreten Beispiels. Die Arbeit beschreibt Web 2.0 und seine ideologischen und technischen Grundlagen, sowie die damit einhergehenden Chancen und Herausforderungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Medien, soziale Netzwerke, Online-Kommunikation, Face-to-Face-Kommunikation, Interaktion, Web 2.0, Sprache, textbasierte Kommunikation, Emoticons, Facebook, Netzwerkbildung, Netzwerkpflege, Entkörperlichung, Entzeitlichung, Enträumlichung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Interaktionsmöglichkeiten in sozialen Medien zu untersuchen und die Besonderheiten der Online-Kommunikation im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation aufzuzeigen. Sie analysiert, wie sich die Sprache an die Bedingungen des Online-Mediums anpasst und welche sprachlichen Auswirkungen die Grenzen der Online-Kommunikation haben.
- Arbeit zitieren
- Aljona Merk (Autor:in), 2010, Interaktion in Sozialen Medien am Beispiel des Sozialen Netzwerkes Facebook, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160885