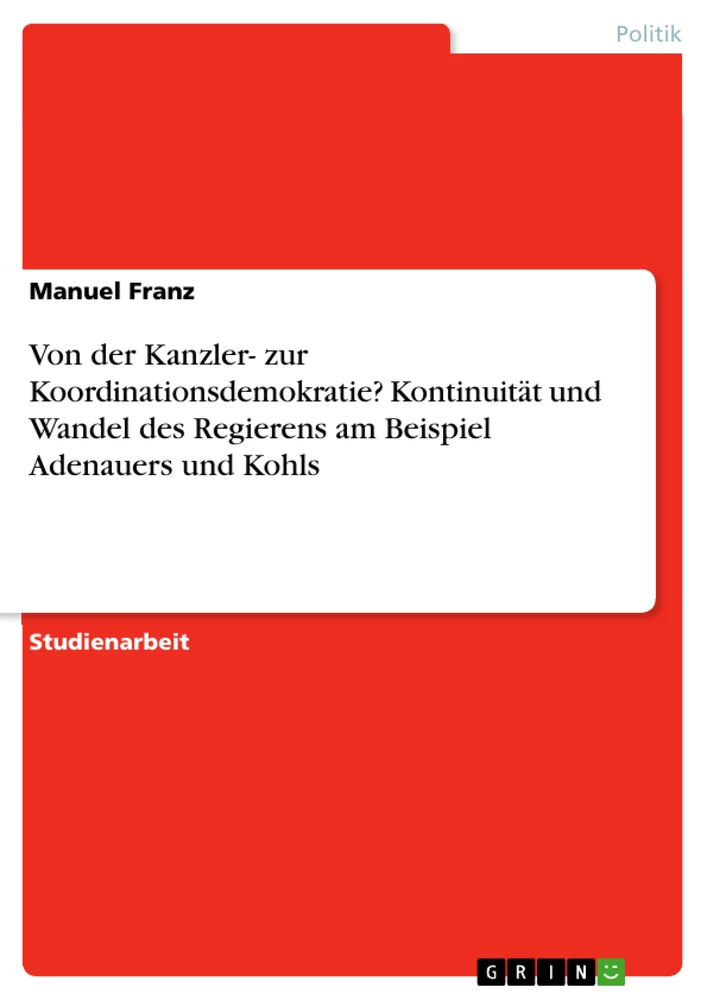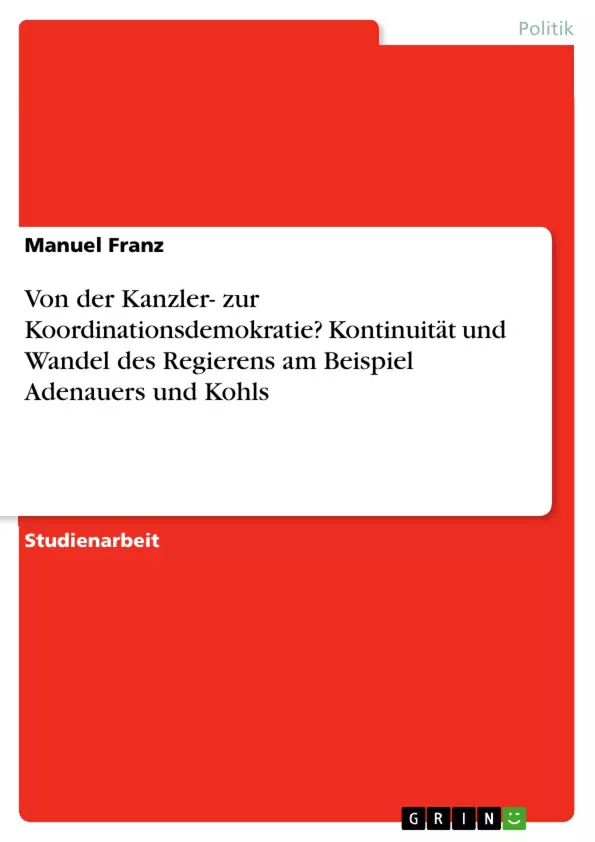„Auf den Kanzler kommt es an.“ Dieser Ausspruch ist nicht nur als Slogan auf Wahlplakaten sehr beliebt, er fasst auch treffend den Eindruck zusammen, den viele Beobachter des politischen Geschehens haben: Der Bundeskanzler steht oft im Zentrum des öffentlichen Interesses und nimmt in der medialen Berichterstattung eine herausgehobene Position ein. So gilt er bei vielen als zentraler Akteur im politischen System der Bundesrepublik und die aktuelle Amtsinhaberin wird sogar als „mächtigste Frau der Welt“ bezeichnet. So dauert es meist auch nicht lange bis das Wort von der Kanzlerdemokratie fällt, um die Bedeutung des Regierungschefs in Deutschland auf ein Schlagwort zu bringen.
Andere Kommentatoren wiederum halten diesen Begriff für einen Anachronismus aus den 1950er-Jahren. Sie betonen, dass es im komplexen Regierungsgefüge mittlerweile weniger auf die Machtdurchsetzung des Kanzlers im Sinne Webers als vielmehr auf die Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren des Mehrebenensystems Bundesrepublik ankommt. Vertreter dieser Denkrichtung sprechen daher von einer Koordinationsdemokratie.
Folgerichtig bietet sich eine politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen sich scheinbar so widersprechenden Auffassungen von der Position des Bundeskanzlers an: Was macht eine Kanzlerdemokratie aus? Inwieweit ist diese Bezeichnung für das politische System Deutschlands noch angemessen? Und ist die Theorie von der Koordinationsdemokratie zutreffend?
Zur Beantwortung der Fragen erscheint im Aufbau dieser Hausarbeit zunächst ein Blick auf die historischen und verfassungsrechtlichen Grundlagen der Kanzlerdemokratie sinnvoll, bevor eine Betrachtung der Regierungszeit Konrad Adenauers, der den Begriff prägte, folgt. Als Vergleichsgröße bietet sich im Anschluss Helmut Kohl an: Er steht mit seiner langen Amtszeit bis 1998, die in der Politikwissenschaft bereits besser erforscht ist als die seiner beiden Nachfolger, stellvertretend für das moderne Regieren im wiedervereinigten Deutschland. Zudem wurde er wegen einer Reihe von Gemeinsamkeiten mit dem Vorgänger gelegentlich als „Enkel Adenauers“ charakterisiert, was einen Vergleich noch interessanter macht. Schließlich erfolgt ein Überblick über die Theorie der Koordinationsdemokratie, um dann abschließend zu einer Antwort auf die Fragestellungen zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Die Debatte um Kanzler- oder Koordinationsdemokratie
- II. Grundlagen der Kanzlerdemokratie
- II.1. Historische Wurzeln
- II.2. Verfassungsrechtliche Bestimmungen
- III. Die Regierung Adenauer: Herausbildung der Kanzlerdemokratie und ihrer Strukturmerkmale
- III.1. Die Dominanz des Kanzlerprinzips über Kollegial- und Ressortprinzip
- III.2. Die enge Verbindung zwischen Kanzler und Kanzlerpartei
- III.3. Der deutliche Gegensatz zwischen Regierung und Opposition
- III.4. Das Engagement des Kanzlers in der Außenpolitik
- III.5. Die starke Personalisierung und Medienpräsenz des Kanzlers
- IV. Die Regierung Kohl: Kontinuität und Wandel
- IV.1. Die Dominanz des Kanzlerprinzips über das Kollegial- und Ressortprinzip
- IV.2. Die enge Verbindung zwischen Kanzler und Kanzlerpartei
- IV.3. Der deutliche Gegensatz zwischen Regierung und Opposition
- IV.4. Das Engagement des Kanzlers in der Außenpolitik
- IV.5. Die starke Personalisierung und Medienpräsenz des Kanzlers
- V. Die Theorie von der Koordinationsdemokratie
- VI. Schlussbetrachtungen: Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und dem Wandel der Rolle des Bundeskanzlers im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die historische und verfassungsrechtliche Grundlage der Kanzlerdemokratie und untersucht, inwieweit diese Bezeichnung für das politische System Deutschlands noch angemessen ist. Die Arbeit stellt die Theorien von der Kanzler- und der Koordinationsdemokratie gegenüber und untersucht, ob die Theorie von der Koordinationsdemokratie zutreffend ist. Die Arbeit konzentriert sich auf die Regierungszeiten von Konrad Adenauer und Helmut Kohl, um die Rolle des Bundeskanzlers in der Geschichte der Bundesrepublik zu beleuchten.
- Die historische Entwicklung des Kanzleramtes in Deutschland
- Die verfassungsrechtliche Grundlage des Kanzlerprinzips
- Die Rolle des Bundeskanzlers in der Regierungstätigkeit
- Die Beziehungen zwischen Kanzler, Regierung und Parlament
- Die Theorie von der Koordinationsdemokratie und ihre Relevanz für das deutsche politische System
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Debatte um Kanzler- oder Koordinationsdemokratie vor und erläutert die zentrale Fragestellung der Arbeit: Inwieweit ist der Begriff der Kanzlerdemokratie noch angemessen für das politische System Deutschlands?
Das zweite Kapitel befasst sich mit den historischen und verfassungsrechtlichen Grundlagen der Kanzlerdemokratie. Es zeigt die Entwicklung des Kanzleramtes vom Mittelalter bis zur Bundesrepublik auf und analysiert die im Grundgesetz verankerten Kompetenzen des Bundeskanzlers.
Die Kapitel III und IV untersuchen die Regierungszeiten von Konrad Adenauer und Helmut Kohl, um die Herausbildung und Weiterentwicklung der Kanzlerdemokratie zu beleuchten. Diese Kapitel analysieren die Dominanz des Kanzlerprinzips, die enge Verbindung zwischen Kanzler und Kanzlerpartei, den Gegensatz zwischen Regierung und Opposition, das Engagement des Kanzlers in der Außenpolitik und die Personalisierung und Medienpräsenz des Kanzlers.
Kapitel V bietet einen Überblick über die Theorie von der Koordinationsdemokratie und diskutiert ihre Relevanz für das deutsche politische System.
Schlüsselwörter
Kanzlerdemokratie, Koordinationsdemokratie, Bundeskanzler, Regierungsführung, Politisches System, Deutschland, Bundesregierung, Parlament, Grundgesetz, Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Historische Entwicklung, Verfassungsrecht, Machtverteilung, Richtlinienkompetenz, Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Kanzlerdemokratie"?
Der Begriff beschreibt ein System, in dem der Bundeskanzler eine dominante Stellung innerhalb der Regierung und gegenüber dem Parlament einnimmt, wie es besonders unter Konrad Adenauer der Fall war.
Was ist eine "Koordinationsdemokratie"?
Im Gegensatz zur Kanzlerdemokratie betont dieses Modell die Notwendigkeit der Kooperation und Abstimmung zwischen vielen Akteuren (Parteien, Bundesländer, EU) in einem komplexen Mehrebenensystem.
Warum wird Helmut Kohl oft mit Adenauer verglichen?
Beide hatten sehr lange Amtszeiten und prägten ihre Ären durch eine starke Führung der Kanzlerpartei sowie ein starkes Engagement in der Außenpolitik.
Was ist die Richtlinienkompetenz?
Gemäß Art. 65 Grundgesetz bestimmt der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.
Hat sich die Macht des Kanzlers über die Zeit verändert?
Ja, viele Politikwissenschaftler sehen eine Entwicklung hin zur Koordinationsdemokratie, da die Komplexität der Themen und die Abhängigkeit von internationalen Partnern (EU) Alleingänge des Kanzlers erschweren.
- Arbeit zitieren
- Manuel Franz (Autor:in), 2010, Von der Kanzler- zur Koordinationsdemokratie? Kontinuität und Wandel des Regierens am Beispiel Adenauers und Kohls, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161034