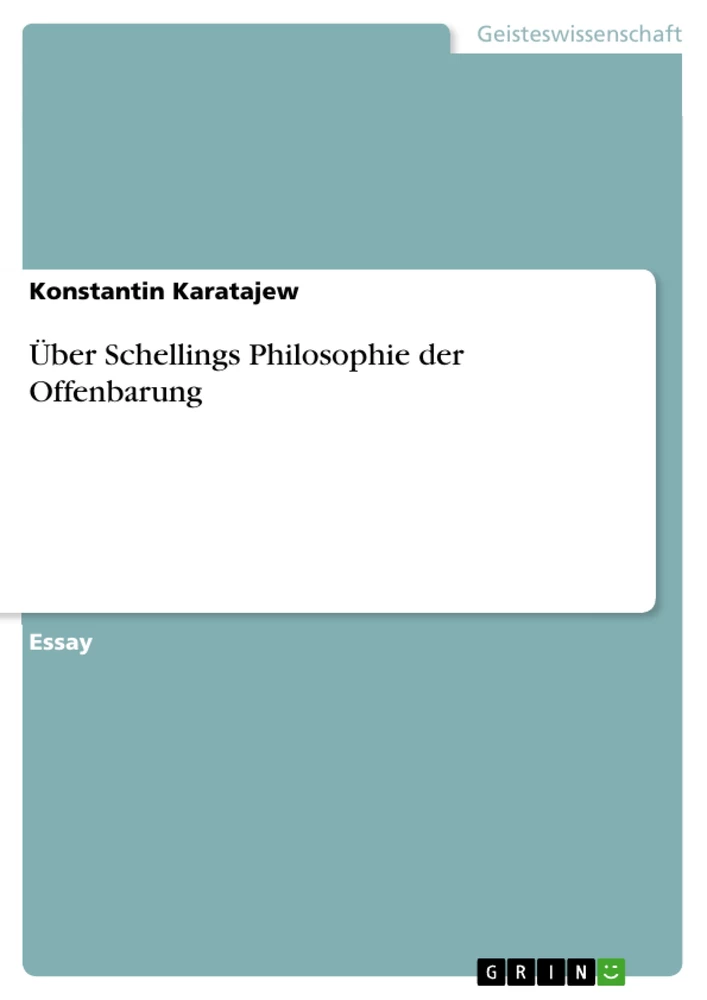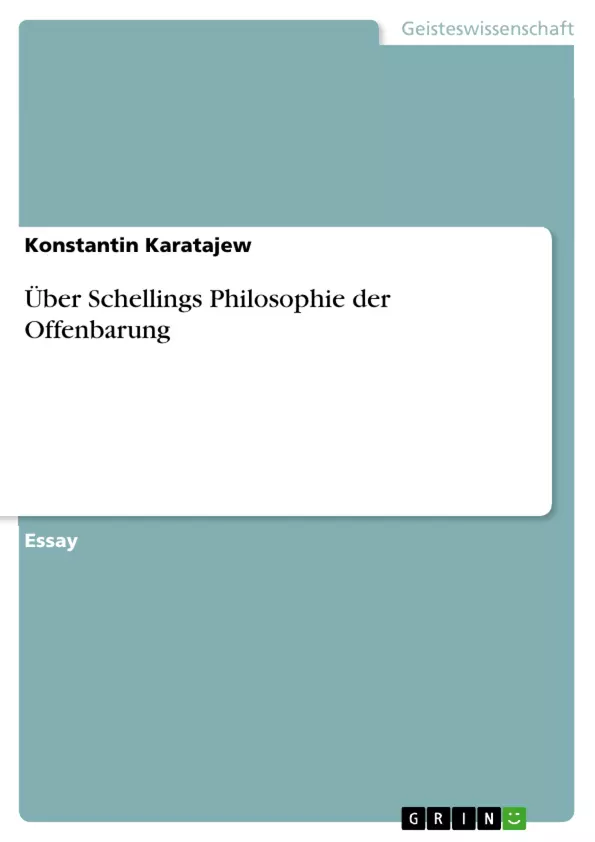Die Frage, warum überhaupt etwas ist, und nicht vielmehr nichts, diese Fundamentalfrage der theoretischen Philosophie ist im Reich der Notwendigkeit nicht hinreichend zu beantworten. Wenn Etwas aus Nichts notwendig folgt, dann ist dieses Nichts kein Nichts, sondern nur ein Nichts von Etwas. Wenn aus reinem Sein, welches zugleich Nichts ist, eine notwendige Begriffsbewegung entsteht, dann ist damit nicht die Entstehung der Welt aus dem Nichts erklärt, sondern nur gezeigt, dass dieses an den Anfang gesetzte Sein/Nichts nicht das absolut Erste sein kann. So wie die Kosmologie über die ursprüngliche kosmische Singularität, den Urknall, nicht hinaus gehen kann, kann die Ontologie über das reine Sein nicht hinaus gehen, und muss es zum Anfang machen und mit dem Nichts gleichsetzen. Die Hegelsche Wissenschaft der Logik ist als Wissenschaft logisch und braucht ein Axiom; da logisch nicht tiefer als zum reinen Sein und zum Nichts vorzudringen ist, kann die Wissenschaft der (ontologischen) Logik als Wissenschaft nur mit dem reinen Sein und dem Nichts anfangen, woraus alles Weitere mit logischer Notwendigkeit folgt.
Schelling fängt mit der Freiheit an, die von nichts Anderem ableitbar ist. Schellings Schritt hinter die logischen Bestimmungen des reinen Seins und des Nichts ist selbst für die spekulative ontologische Logik Hegels nicht mehr wissenschaftlich, sondern geht über jede Wissenschaftlichkeit hinaus in die Sphären des Alogischen, in welchem das logische Sosein der Welt erst willentlich gesetzt werden muss, damit es eine logisch erklärbare Welt überhaupt geben kann. Der Mystizismus des späten Schelling ist ein notwendiger Schritt über die mit Hegel zum Abschluss gekommene wissenschaftliche Philosophie hinaus; Schelling geht in der Philosophie der Offenbarung keineswegs philosophisch-wissenschaftlich über die Philosophie Hegels hinaus, sondern in der Weise, in der das Absolute als der Gegenstand der Wissenschaft vom Absoluten, der Philosophie, über dieselbe hinaus geht.
Inhaltsverzeichnis
- DIE LOGIK DER FREIHEIT
- DIE BESTIMMTE WELT.
- RELIGION UND LEBENSPHILOSOPHIE.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die drei Essays untersuchen die Philosophie der Offenbarung von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, indem sie seine theoretische Spätphilosophie analysieren und in Beziehung zu Hegels Wissenschaft der Logik setzen. Die Essays fokussieren auf die Frage nach der Freiheit in Bezug auf das Sein und das Nichts, und untersuchen Schellings Gedanken zu einer Welt aus Freiheit im Gegensatz zu einer Welt aus Notwendigkeit.
- Die Logik der Freiheit als Grundlage von Schellings Philosophie der Offenbarung
- Die Kritik an Hegels Wissenschaft der Logik und der Begriff des Alogischen
- Die Bedeutung des absoluten Geistes und die Notwendigkeit der Offenbarung
- Die Rolle der Freiheit bei der Erschaffung der Welt
- Der Einfluss des Fichteschen Ich=Ich und die Bedeutung der Innenperspektive des Subjekts
Zusammenfassung der Kapitel
- 1. DIE LOGIK DER FREIHEIT: Dieses Kapitel analysiert Schellings theoretische Spätphilosophie, die in den Vorlesungen 5 bis 15 entwickelt wird. Schelling unterscheidet zwischen dem "sein Könnenden" (das Erste Sein), dem "reinen Sein" und der "Freiheit" als dem Dritten, das beide ausschließt. Dieses "Dritte" stellt die Grundlage für eine Welt aus Freiheit dar, im Gegensatz zu einer Welt aus Notwendigkeit, die von Hegel angenommen wird.
- 2. DIE BESTIMMTE WELT.: Dieses Kapitel vertieft die Kritik an Hegels Logik und zeigt, dass die Welt nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Freiheit entsteht. Es beleuchtet die Frage, warum überhaupt etwas ist, und nicht nichts, und stellt fest, dass die Hegelsche Ontologie an den Anfang gesetztes Sein/Nichts nicht das absolut Erste sein kann. Schelling argumentiert, dass die Entstehung der Welt ein alogischer Akt purer Freiheit ist.
- 3. RELIGION UND LEBENSPHILOSOPHIE.: Dieses Kapitel untersucht die Rolle des absoluten Geistes und die Notwendigkeit der Offenbarung. Schelling argumentiert, dass die bestimmte Persönlichkeit des absoluten Geistes weder aus logischen Bestimmungen noch aus seiner Identität mit dem endlichen Geist des Menschen abgeleitet werden kann. Die Offenbarung des absoluten Geistes geht über alle Wissenschaft hinaus und hat die Form des Mystizismus. Es ist ein alogischer Akt, der das Logische zum Wirklichen macht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Schellings Philosophie der Offenbarung, die Logik der Freiheit, die Kritik an Hegels Wissenschaft der Logik, der absolute Geist, Offenbarung, Mystizismus, Freiheit, Notwendigkeit, Sein und Nichts. Weitere wichtige Konzepte sind das "sein Könnende", das "reine Sein" und die "Freiheit" als "Drittes". Die Essays beleuchten die Rolle des alogischen Akts in der Entstehung der Welt und betonen die Bedeutung des Ich-Begriffs und der Innenperspektive des Subjekts.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Schellings „Philosophie der Offenbarung“?
Schellings Spätphilosophie setzt die Freiheit als absoluten Anfang, der nicht logisch aus Notwendigkeit ableitbar ist, und grenzt sich damit von Hegel ab.
Wie unterscheidet sich Schellings Ansatz von Hegels „Wissenschaft der Logik“?
Während Hegel die Welt aus logischer Notwendigkeit entstehen lässt, sieht Schelling die Schöpfung als einen alogischen Akt purer Freiheit.
Was versteht Schelling unter dem Begriff des „Alogischen“?
Das Alogische bezeichnet eine Sphäre jenseits rein logischer Bestimmungen, in der das Sosein der Welt willentlich gesetzt werden muss.
Welche Bedeutung hat die Offenbarung in diesem System?
Die Offenbarung ist laut Schelling notwendig, um die Persönlichkeit des absoluten Geistes zu erfahren, die nicht rein rational abgeleitet werden kann.
Welchen Einfluss hatte Fichte auf Schellings Spätwerk?
Schelling greift auf Fichtes Konzept des „Ich=Ich“ zurück, um die Bedeutung der Innenperspektive des Subjekts und den Ich-Begriff zu betonen.
Warum bezeichnet die Arbeit Schellings Schritt als „Mystizismus“?
Weil Schelling über die wissenschaftliche Philosophie hinausgeht, um das Absolute als Gegenstand zu erfassen, der über rein logische Wissenschaftlichkeit hinausreicht.
- Arbeit zitieren
- Konstantin Karatajew (Autor:in), 2010, Über Schellings Philosophie der Offenbarung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161036