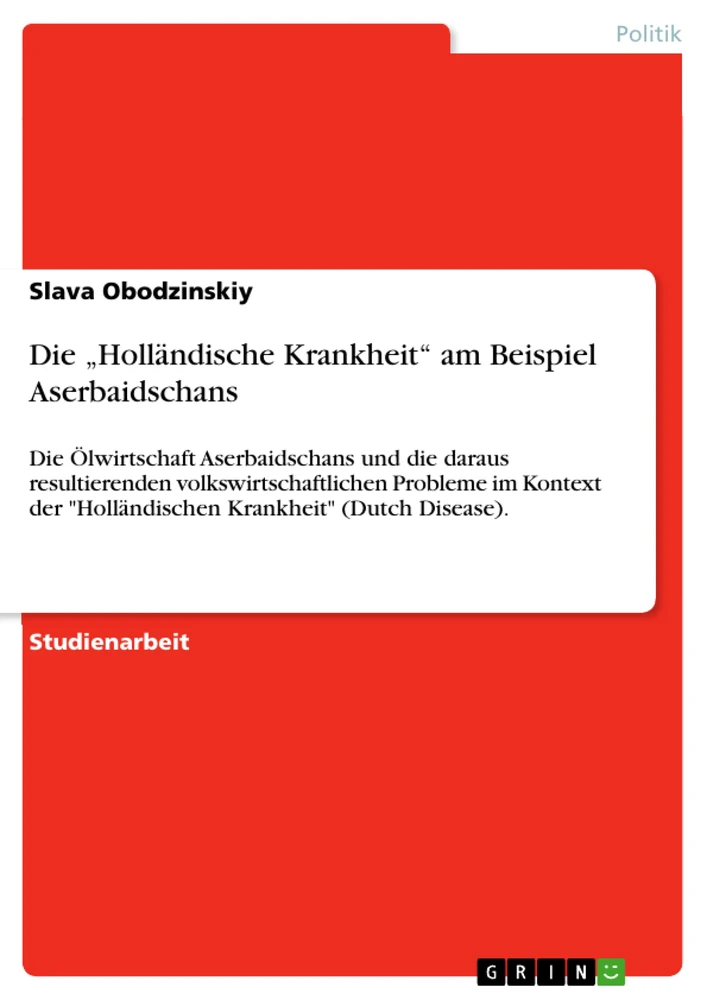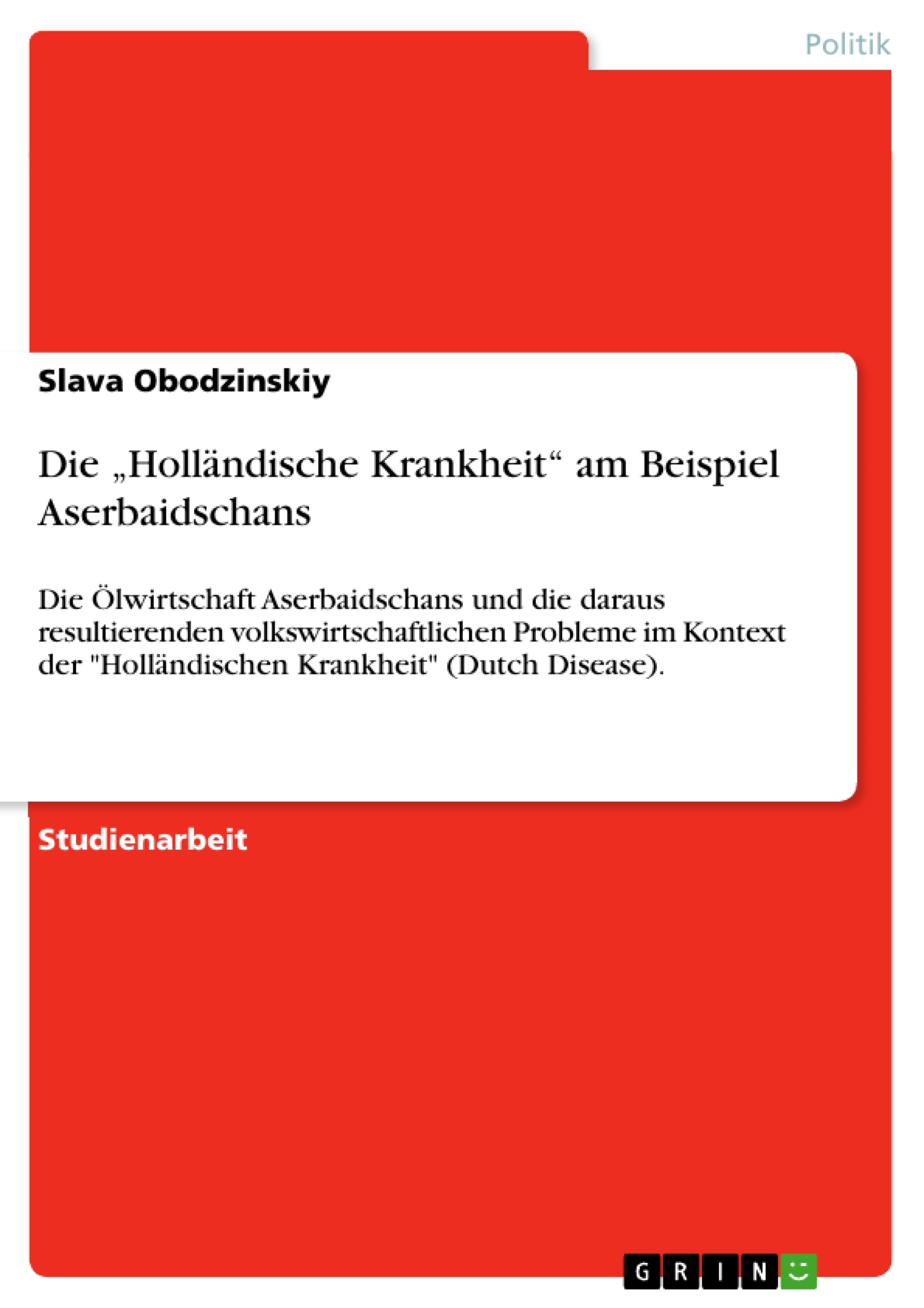In der heutigen Gesellschaft spielen Rohstoffe wie Erdöl und Erdgas eine enorm wichtige Rolle. Die drastisch gestiegenen Benzinpreise waren wochenlang Gegenstand einer öffentlichen Diskussion. Gasstreitigkeiten zwischen Russland und der Ukraine sowie der Bau der Baku-Tbilisi-Ceyhan-Pipeline sind längst Probleme, die politisch mehrere Staaten erheblich tangieren. Die Rohstoffknappheit bringt die Fragen nach der Zukunft der Atomkraft und alternativen Methoden der Energiegewinnung auf die Tagesordnung und lässt düstere Szenarien bezüglich der Entwicklung unseres Planeten entstehen. Das sind nur wenige Beispiele für die extrem hohe Bedeutung der Rohstoffe, vor allem des Erdöls, für die Politik.
Gerade in solchen Zeiten könnte man meinen, dass das Rohstoffreichtum die wirtschaftliche Stärke und den Wohlstand des Landes garantieren sowie die politische Stabilität gewährleisten sollte. Doch wenn man das Wirtschaftswachstum der ölexportierenden Länder in den letzten zwanzig Jahren betrachtet, stellt man fest, dass nur wenige von ihnen aus ihrem Ressourcenreichtum Profit schlagen konnten. Die Wachstumsraten sind oft kleiner, als bei den Staaten die kein Öl exportieren, manchmal sogar negativ. In vielen dieser Staaten ist die Ölbranche die einzige, die entwickelt ist, während andere stagnieren und grundlegende Waren importiert werden müssen. Ein Großteil der Ölexportländer leidet an Inflation und Korruption, viele dieser Länder haben eine autoritäre Regierung und der Lebensstandard der Menschen ist erstaunlich niedrig. Doch was sind die Gründe für eine solch paradoxe Entwicklung?
In diesem Zusammenhang sprechen die Wissenschaftler oft vom Fluch der Ressourcen. Konkrete Gründe dafür können die falsche Zielsetzung bei Investitionen und Staatsausgaben, die mangelhafte Regierungsqualität oder rent seeking sein. In dieser Hausarbeit wird aber die wohl wichtigste Ursache für den Fluch der Ressourcen erläutert, nämlich die so genannte Holländische Krankheit (Dutch Disease).
Ein aktuelles Beispiel für ein von der Holländischen Krankheit betroffenes Land ist Aserbaidschan. Aserbaidschan und das Kaspische Meer galten Mitte der 90er Jahre als das letzte unerschlossene Erdölgebiet. Das hohe Interesse der Industrieländer sowie Investitionen waren die Folge. Trotz großer Erdölvorkommen und guter Beziehungen sowohl zu der Russländischen Föderation als auch zur EU und zu den USA ist Aserbaidschan komplett vom Öl abhängig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aserbaidschan und seine Ressourcen
- Geschichtliche Entwicklung
- Rolle der Ressourcen
- Das Russische Reich und die Sowjetzeit
- Das unabhängige Aserbaidschan
- "Holländische Krankheit"
- Bezug auf Aserbaidschan
- Vergleich
- Venezuela
- Gegenbeispiel Norwegen
- Ausblick: Perspektiven für die Entwicklung Aserbaidschans
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen für den scheinbaren Widerspruch zwischen Ressourcenreichtum und wirtschaftlicher Unterentwicklung in Aserbaidschan. Im Mittelpunkt steht die Analyse der "Holländischen Krankheit" als zentrale Ursache für die wirtschaftlichen Probleme des Landes.
- Die geschichtliche Entwicklung Aserbaidschans und die Rolle des Erdöls.
- Die Auswirkungen der "Holländischen Krankheit" auf die aserbaidschanische Wirtschaft.
- Ein Vergleich Aserbaidschans mit anderen ölproduzierenden Ländern (Venezuela und Norwegen).
- Die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung Aserbaidschans.
- Die Frage, ob Erdöl für Aserbaidschan eher Fluch oder Segen darstellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Ressourcenfluchs ein und präsentiert Aserbaidschan als aktuelles Beispiel eines Landes, das trotz seines Erdölreichtums unter wirtschaftlichen Problemen leidet. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen dieses Phänomens und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die "Holländische Krankheit" konzentriert.
Aserbaidschan und seine Ressourcen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte Aserbaidschans, beginnend mit seiner wechselvollen Vergangenheit unter verschiedenen Herrschaftsformen bis hin zur Sowjetzeit und der erlangten Unabhängigkeit. Es analysiert die Rolle des Erdöls in verschiedenen historischen Phasen, von der Ausbeutung im 19. Jahrhundert bis zu seiner Bedeutung in der modernen aserbaidschanischen Wirtschaft. Der Fokus liegt auf der Abhängigkeit des Landes vom Erdölsektor und den daraus resultierenden wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen. Die Kapitelteile zu den einzelnen historischen Epochen werden dabei zu einem zusammenhängenden Bild der Entwicklung Aserbaidschans und seines Verhältnisses zum Erdöl synthetisiert.
"Holländische Krankheit": Dieses Kapitel erklärt das Phänomen der "Holländischen Krankheit" und ihre Auswirkungen auf Aserbaidschan. Es analysiert die "Symptome" der Krankheit im Land und vergleicht die Situation Aserbaidschans mit anderen ölproduzierenden Ländern wie Venezuela und Norwegen. Der Vergleich dient dazu, sowohl Parallelen als auch Unterschiede aufzuzeigen und die Komplexität des Problems zu verdeutlichen. Durch die Einordnung Aserbaidschans in einen größeren Kontext und den Vergleich mit anderen Ländern wird die Tragweite des Problems und seine Bedeutung im globalen Kontext unterstrichen.
Schlüsselwörter
Aserbaidschan, Erdöl, Ressourcenfluch, Holländische Krankheit, Wirtschaftsentwicklung, politische Stabilität, Korruption, Vergleich, Venezuela, Norwegen, Unabhängigkeit, Sowjetunion, Ressourcenabhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aserbaidschan - Ressourcenreichtum und wirtschaftliche Entwicklung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Ressourcenreichtum Aserbaidschans (vor allem Erdöl) und seiner wirtschaftlichen Unterentwicklung. Im Mittelpunkt steht die Analyse der „Holländischen Krankheit“ als zentrale Ursache für die wirtschaftlichen Probleme des Landes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die geschichtliche Entwicklung Aserbaidschans und die Rolle des Erdöls darin. Sie analysiert die Auswirkungen der „Holländischen Krankheit“ auf die aserbaidschanische Wirtschaft und vergleicht Aserbaidschan mit anderen ölproduzierenden Ländern (Venezuela und Norwegen). Weitere Themen sind die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung Aserbaidschans und die Frage, ob Erdöl für Aserbaidschan Fluch oder Segen ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Aserbaidschan und seinen Ressourcen (inkl. historischer Entwicklung), ein Kapitel zur „Holländischen Krankheit“ mit Ländervergleichen und einen Ausblick auf die zukünftigen Perspektiven Aserbaidschans.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik des Ressourcenfluchs ein, stellt Aserbaidschan als Fallbeispiel vor und formuliert die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen der wirtschaftlichen Probleme trotz Erdölreichtum. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit mit Fokus auf die „Holländische Krankheit“.
Was beinhaltet das Kapitel „Aserbaidschan und seine Ressourcen“?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte Aserbaidschans von verschiedenen Herrschaftsformen bis zur Sowjetzeit und Unabhängigkeit. Es analysiert die Rolle des Erdöls in verschiedenen historischen Phasen und die daraus resultierenden wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen. Es synthetisiert die einzelnen historischen Epochen zu einem zusammenhängenden Bild der Entwicklung Aserbaidschans und seines Verhältnisses zum Erdöl.
Worin besteht der Fokus des Kapitels zur „Holländischen Krankheit“?
Dieses Kapitel erklärt das Phänomen der „Holländischen Krankheit“ und ihre Auswirkungen auf Aserbaidschan. Es analysiert die „Symptome“ im Land und vergleicht die Situation mit Venezuela und Norwegen, um Parallelen und Unterschiede aufzuzeigen und die Komplexität des Problems zu verdeutlichen. Der Vergleich unterstreicht die Tragweite des Problems im globalen Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aserbaidschan, Erdöl, Ressourcenfluch, Holländische Krankheit, Wirtschaftsentwicklung, politische Stabilität, Korruption, Vergleich, Venezuela, Norwegen, Unabhängigkeit, Sowjetunion, Ressourcenabhängigkeit.
Welche Länder werden im Vergleich zu Aserbaidschan herangezogen?
Venezuela und Norwegen dienen als Vergleichsländer, um die Auswirkungen der „Holländischen Krankheit“ in unterschiedlichen Kontexten zu beleuchten und Parallelen sowie Unterschiede zu Aserbaidschans Situation aufzuzeigen.
Welche zentrale Forschungsfrage wird in dieser Arbeit behandelt?
Die zentrale Frage ist, warum Aserbaidschan trotz seines Erdölreichtums unter wirtschaftlichen Problemen leidet und welche Ursachen hierfür verantwortlich sind, wobei der Fokus auf der „Holländischen Krankheit“ liegt.
Was ist der Ausblick der Arbeit?
Der Ausblick gibt Perspektiven für die zukünftige Entwicklung Aserbaidschans im Hinblick auf die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem Umgang mit den Erdölressourcen ergeben.
- Quote paper
- Slava Obodzinskiy (Author), 2009, Die „Holländische Krankheit“ am Beispiel Aserbaidschans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161079