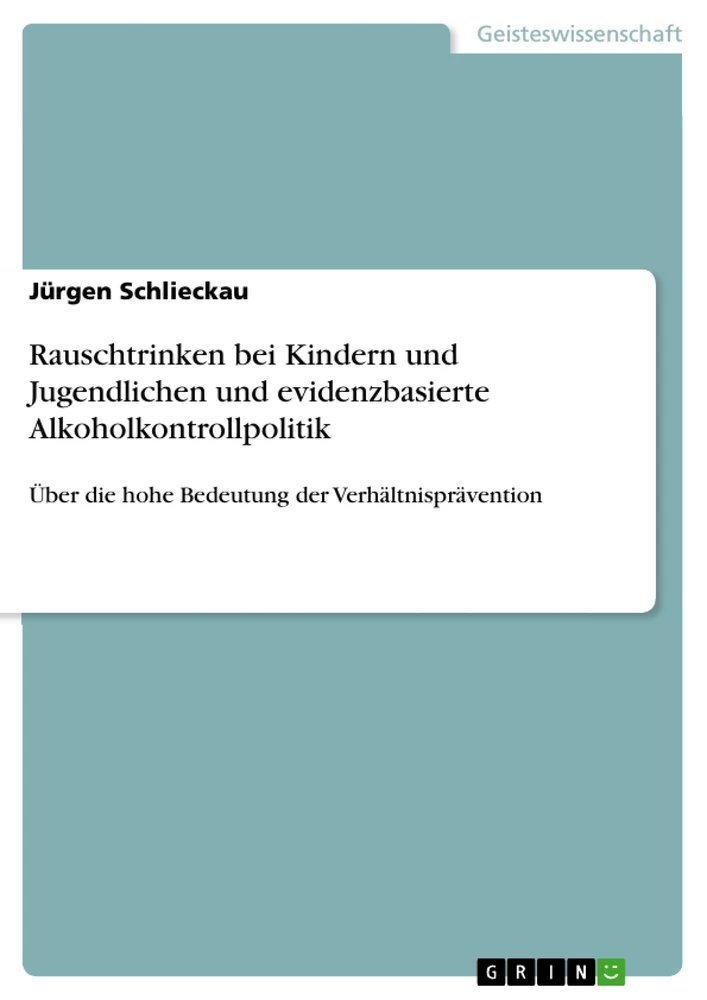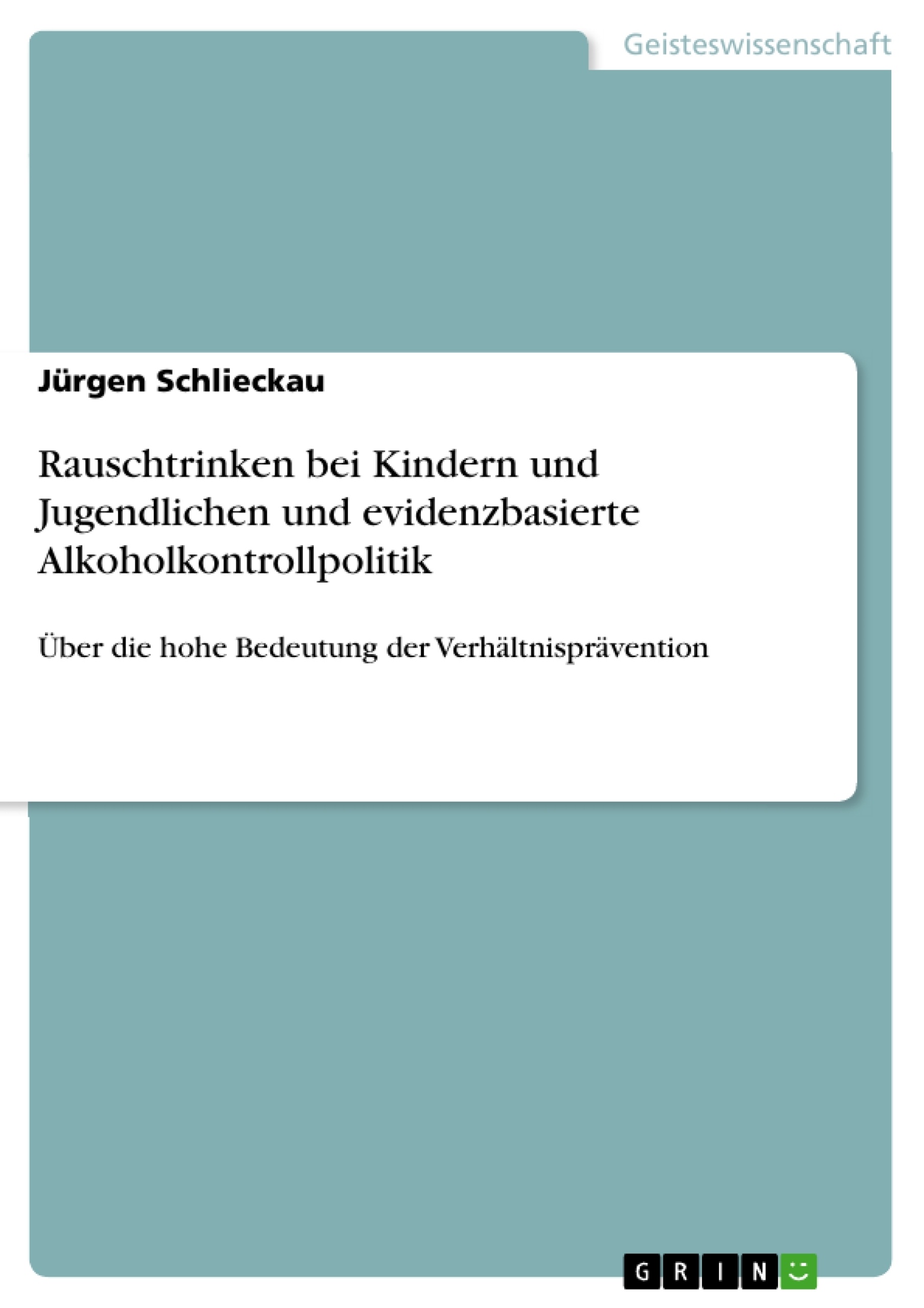Das allgemeine Desinteresse an der Problematik des Alkoholmissbrauchs steht in einem eigentümlichen Missverhältnis zur hohen gesellschaftlichen Schadensbilanz durch Alkohol. „Kein anderes Konsumgut, nicht einmal Tabak, hat so viele negative Auswirkungen auf den Körper“ (Babor et al. 2005, Alkohol - Kein gewöhnliches Konsumgut,35). Alkoholkonsum ist schon in der mittleren Adoleszenz weit verbreitet. Das Phänomen des frühen kindlichen und jugendlichen Rauschtrinkens kann nicht getrennt von den aktuellen Rahmenbedingungen der Gesellschaft betrachtet werden. Es gibt enge Zusammenhänge zwischen dem Rauschtrinken von Jugendlichen und Erwachsenen, der Haltung der Bürgerinnen und Bürger zum Alkoholkonsum, der praktizierten Alkoholkontrollpolitik und der zunehmenden Ökonomisierung aller Bereiche der Gesellschaft.
„Der Unterschied zwischen guter und schlechter Alkoholpolitik ist nicht abstrakt, sondern oft eine Frage von Leben oder Tod“ (Babor et al. 2005,277). Die meisten Schäden durch Alkohol könnten vermieden werden, wenn es gelänge, den durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum, zu senken. Dazu sind verhältnispräventive Strategien erforderlich.
Neben der Höhe des Gesamtalkoholkonsums sind die Trinkkonsummuster für alkoholassoziierte gesundheitliche und soziale Probleme bedeutsam (ebd., 66 und 100). Exzessiver Alkoholkonsum und Rauschtrinken sind besonders problematisch.
Das Buch bietet als Nachschlagewerk eine immense Fülle an aktuellen Informationen. Der Anhang ist wesentlich umfangreicher als der Textteil gehalten. Er soll dem wissenschaftlich interessierten Leser helfen, weitere Recherchen zu betreiben und über die Verzeichnisse der aktuellen Fachliteratur, Fachzeitschriften und Internetadressen Informationen schneller zu finden.
Ziel ist die Förderung eines tieferen Verständnisses für die Alkoholpolitik in Deutschland und die Förderung einer neuen „Kultur des Hinschauens“. Zielgruppen sind Politiker/innen, Praktiker/innen in Schule, Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Suchthilfe und Medizin und interessierte Bürger/innen.
Jürgen Schlieckau ist Diplom-Pädagoge, Sozialtherapeut und Pädagogischer Leiter in der Dietrich Bonhoeffer Klinik, Fachkrankenhaus für abhängigkeitskranke Jugendliche und junge Erwachsene in Ahlhorn. Er ist Autor und Co-Autor einer Reihe von Fachbeiträgen zu Fragen der Erziehung und Kommunikation, der Prävention, des Alkohol- und Drogenmissbrauchs bei Kindern und Jugendlichen und der Behandlung von jungen Abhängigkeitskranken.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Synopse der gesundheitspolitischen Aussagen zur Prävention
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch untersucht Rauschtrinken bei Kindern und Jugendlichen und analysiert evidenzbasierte Strategien der Alkoholkontrollpolitik. Es zielt darauf ab, wirksame Präventionsmaßnahmen zu beleuchten und deren Umsetzung zu fördern.
- Ausmaß und Folgen von jugendlichem Alkoholkonsum
- Evidenzbasierte Alkoholprävention
- Verhältnisprävention vs. Verhaltensprävention
- Gesundheitspolitische Aussagen zur Prävention in Parteiprogrammen
- Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort hebt die Notwendigkeit einer evidenzbasierten Alkoholprävention hervor und betont die Bedeutung verhältnispräventiver Maßnahmen, die oft im Gegensatz zu verhaltenspräventiven Maßnahmen, wie Aufklärungskampagnen, stehen. Es wird die Notwendigkeit von gesetzlichen Regelungen im Umgang mit Alkohol betont, die sich sowohl in Deutschland als auch international als wirksam erwiesen haben. Die Autorin unterstreicht die Bedeutung der Aufklärung sowohl über die Risiken des Alkoholkonsums als auch über die Wirksamkeit von verhältnispräventiven Maßnahmen. Das Vorwort betont, dass wirksame Prävention beide Ansätze – Verhältnis- und Verhaltensprävention – berücksichtigen muss, wobei die verhältnispräventiven Maßnahmen auf strukturelle Veränderungen setzen und bevölkerungsweit wirken, während verhaltenspräventive Maßnahmen vor allem individuelle Verhaltensweisen beeinflussen. Die Aufklärungskampagnen werden als wichtiges Instrument zur Vorbereitung der Öffentlichkeit auf möglicherweise unpopuläre, aber notwendige Interventionen wie gesetzliche Regelungen gesehen.
Synopse der gesundheitspolitischen Aussagen zur Prävention in den Parteiprogrammen (2007 bis 2009) der im Bundestag vertretenen Parteien: Diese Synopse bietet einen Überblick über die gesundheitspolitischen Aussagen verschiedener Parteien zu Prävention im Zeitraum von 2007 bis 2009. Sie zeigt die allgemeine Übereinstimmung der Parteien hinsichtlich der Bedeutung von Prävention, deckt aber gleichzeitig Unterschiede in der Schwerpunktsetzung und den favorisierten Strategien auf. Die Auszüge aus den Parteiprogrammen verdeutlichen die unterschiedlichen Ansätze und die Komplexität der Debatte um wirksame Präventionsmaßnahmen im Kontext von Alkoholmissbrauch. Die Synopse dient als Grundlage zur Diskussion über den politischen Diskurs und dessen Auswirkung auf die Entwicklung von Präventionsstrategien.
Schlüsselwörter
Rauschtrinken, Jugendliche, Alkoholkonsum, Alkoholprävention, Evidenzbasierte Politik, Verhältnisprävention, Verhaltensprävention, Gesundheitspolitik, Parteiprogramme, Gesetzliche Regelungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Buches einfügen] - Eine Analyse der Alkoholprävention
Was ist der Gegenstand des Buches?
Das Buch untersucht das Rauschtrinken bei Kindern und Jugendlichen und analysiert evidenzbasierte Strategien der Alkoholkontrollpolitik. Es beleuchtet wirksame Präventionsmaßnahmen und deren Umsetzung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind das Ausmaß und die Folgen jugendlichen Alkoholkonsums, evidenzbasierte Alkoholprävention, der Vergleich von Verhältnis- und Verhaltensprävention, gesundheitspolitische Aussagen zur Prävention in Parteiprogrammen und die Wirksamkeit verschiedener Präventionsmaßnahmen.
Was wird im Vorwort erläutert?
Das Vorwort betont die Notwendigkeit einer evidenzbasierten Alkoholprävention und den Stellenwert verhältnispräventiver Maßnahmen im Gegensatz zu verhaltenspräventiven Maßnahmen. Es hebt die Bedeutung gesetzlicher Regelungen und die Notwendigkeit der Aufklärung über Risiken und die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen hervor. Die Notwendigkeit, beide Ansätze (Verhältnis- und Verhaltensprävention) zu kombinieren, wird unterstrichen.
Worum geht es in der Synopse der gesundheitspolitischen Aussagen?
Die Synopse gibt einen Überblick über die gesundheitspolitischen Aussagen der im Bundestag vertretenen Parteien zur Alkoholprävention von 2007 bis 2009. Sie zeigt Übereinstimmungen und Unterschiede in der Schwerpunktsetzung und den favorisierten Strategien der Parteien auf und dient als Grundlage zur Diskussion des politischen Diskurses und dessen Einfluss auf die Entwicklung von Präventionsstrategien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter sind: Rauschtrinken, Jugendliche, Alkoholkonsum, Alkoholprävention, Evidenzbasierte Politik, Verhältnisprävention, Verhaltensprävention, Gesundheitspolitik, Parteiprogramme, Gesetzliche Regelungen.
Welche Arten der Prävention werden im Buch verglichen?
Das Buch vergleicht Verhältnisprävention (strukturelle Veränderungen) und Verhaltensprävention (individuelle Verhaltensweisen) und betont die Notwendigkeit, beide Ansätze zu kombinieren für eine erfolgreiche Alkoholprävention.
Welche Rolle spielen Parteiprogramme im Buch?
Die Parteiprogramme der Jahre 2007 bis 2009 werden analysiert, um die gesundheitspolitischen Aussagen der Parteien zur Alkoholprävention zu vergleichen und den politischen Diskurs in diesem Bereich zu beleuchten.
Wie wird die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen bewertet?
Das Buch untersucht die Wirksamkeit verschiedener Präventionsmaßnahmen auf der Basis von Evidenz, um effektive Strategien zur Alkoholprävention zu identifizieren. Die Bewertung bezieht sich auf den Erfolg und die Umsetzung der Maßnahmen.
- Arbeit zitieren
- Jürgen Schlieckau (Autor:in), 2010, Rauschtrinken bei Kindern und Jugendlichen und evidenzbasierte Alkoholkontrollpolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161095