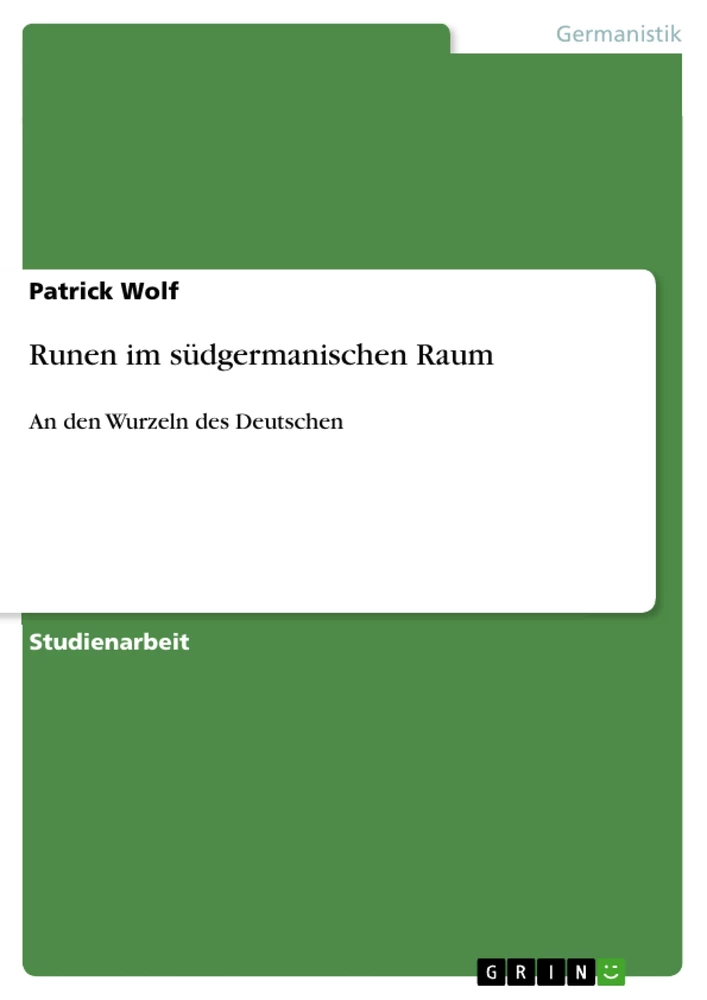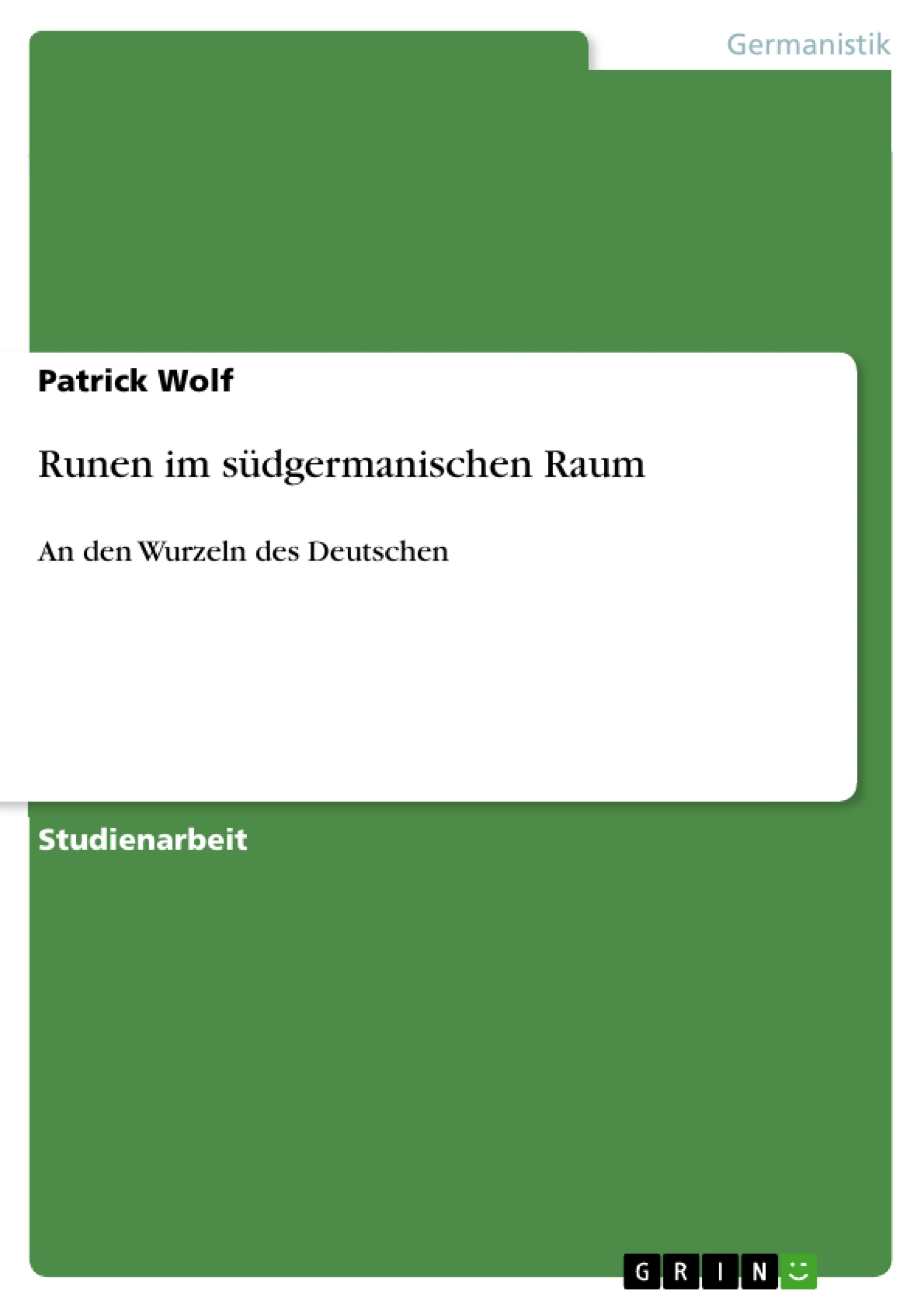Die Auseinandersetzung mit den „Quellen des Deutschen“ führt nicht nur zum Germanischen, der Vorstufe der ersten mehr oder weniger einheitlichen deutschen Sprache, sondern auch zu einem entscheidenden Wendepunkt in der vordeutschen Geschichte. Mit dem Ende der Merowingerzeit und dem Beginn der Karolingerzeit erfolgt die Christianisierung Mitteleuropas und damit ein kultureller Wandel. Neben vielen heidnischen Bräuchen1 wie der Grabbeilage verschwindet mit der Adaption des lateinischen Alphabets die Runenschrift aus dem südgermanischen Kulturraum.
Während die Verwendung der Runen in England bis ins 10. Jahrhundert und in Skandinavien gar bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts fortdauerte, starben sie in Mitteleuropa verhältnismäßig früh aus, noch vor 700 n. Chr. Dennoch ist dieses Zeichensystem mit ca. 80 Einzelbelegen im südgermanischen Raum durchaus als relevantes Dokument voralthochdeutscher Sprachkultur zu werten. Thema dieser Arbeit sollen die Runen im südgermanischen, dem späteren deutschen Raum sein.
In der ersten Hälfte der Arbeit wird in das Thema Runen allgemein eingeführt, angefangen beim Ursprung der Runen, über das alte Futhark zu seinen Weiterentwicklungen in das neue Futhark und das angelsächsische Futhorc. Die zweite Teil soll sich eingehender mit der Runenkultur im südgermanischen Raum beschäftigen. Themen sind die dortige Anwendung der Runen und ihre Ausbreitung. Hier werden einige konkrete Beispiele anhand von Einzelbelegen genannt werden.
Ich möchte mich dabei weder mit dem mythischen und mystischen Aspekt der Runen, welcher ihnen zweifelsohne innewohnt, beschäftigen, noch mit dem „Imageschaden“, welchen die Runen durch verfälschende Darstellung und vereinnahmenden Gebrauch seitens der Nationalsozialisten während des Dritten Reichs erlitten, sondern mich einem Brückenschlag zwischen germanischer und frühdeutscher Kultur nähern. Schließlich kann kein kultureller Wandel von heute auf morgen stattgefunden haben. Die Grauzonen der Überschneidung germanischer und römischer Kultur, das heißt gleichzeitig des heidnischen und christlichen Glaubens, ein wenig stärker zu kontrastieren, soll Ziel dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Ursprung
- Begriff „Rune“
- Herleitung der Runenschrift
- Die Runenreihen
- Älteres Futhark
- Jüngeres Futhark
- Jüngeres Futhark in Skandinavien
- Futhorc im angelsächsischen Raum
- Runen im südgermanischen (deutschen) Raum
- Ausbreitung der Runen in Mitteleuropa
- Anwendungsgebiete der Runenschrift
- Personennamen, Futhark-Inschriften
- Brakteaten, Pseudorunen
- Religiös motivierte Runenritzungen
- Römisch-Germanischer Kontakt
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Runenschrift im südgermanischen Raum und deren Bedeutung für die frühdeutsche Sprach- und Kulturgeschichte. Sie beleuchtet den Übergang von der germanischen zur frühdeutschen Kultur unter Berücksichtigung des Einflusses der römischen Kultur und der Christianisierung. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung der Runen im süddeutschen Raum und ihrer allmählichen Ablösung durch das lateinische Alphabet.
- Der Ursprung und die Entwicklung der Runenschrift.
- Die verschiedenen Runenreihen (älteres und jüngeres Futhark, Futhorc).
- Die Verbreitung der Runen im südgermanischen Raum.
- Die Anwendung der Runen in verschiedenen Kontexten (Personennamen, Brakteaten, religiöse Inschriften).
- Der Einfluss des römischen Reiches und die Christianisierung auf den Rückgang der Runenschrift.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Runen im südgermanischen Raum ein und beschreibt den kulturellen Wandel mit der Christianisierung Mitteleuropas und dem damit verbundenen Rückgang der Runenschrift. Die Arbeit konzentriert sich auf die Runen als relevantes Dokument voralthochdeutscher Sprachkultur und vermeidet die Behandlung mythologischer oder nationalsozialistischer Aspekte. Das Ziel ist es, die Grauzonen der Überschneidung germanischer und römischer Kultur zu beleuchten.
Zum Ursprung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem gegenwärtigen Forschungsstand zum Ursprung des Begriffs „Rune“ und der Herkunft der Runenschrift. Es diskutiert verschiedene Theorien zur Bedeutung des Wortes „Rune“, einschließlich der Interpretation als „Geheimnis“ und möglicher Verbindungen zum Baum der Eberesche. Weiterhin werden verschiedene Theorien zur Herkunft der Schrift selbst behandelt, unter anderem die italisch-etruskische und die lateinische These.
Die Runenreihen: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Runenreihen, beginnend mit dem älteren Futhark und seinen Weiterentwicklungen im jüngeren Futhark und dem angelsächsischen Futhorc. Es bietet einen Überblick über die Entwicklung und die jeweiligen Besonderheiten der verschiedenen Reihen. Die Kapitel werden die verschiedenen Entwicklungsstufen der Runenschrift und ihre geographische Verbreitung im Detail darstellen.
Runen im südgermanischen (deutschen) Raum: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Anwendung der Runenschrift im südgermanischen Raum, ihrer Ausbreitung und den verschiedenen Anwendungsgebieten, wie Personennamen, Brakteaten und religiösen Inschriften. Es analysiert konkrete Beispiele und Einzelbelege, um ein umfassendes Bild der Runenkultur in diesem Raum zu zeichnen. Der Schwerpunkt liegt auf den konkreten Funden und ihrer Interpretation im Kontext der damaligen Kultur.
Römisch-Germanischer Kontakt: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss des römischen Reiches und der römischen Kultur auf die Runenschrift und den germanischen Raum. Es wird den kulturellen Austausch und die Interaktion beider Kulturen beleuchten und analysieren, wie diese den Gebrauch der Runenschrift beeinflusst haben.
Schlüsselwörter
Runen, Runenschrift, älteres Futhark, jüngeres Futhark, Futhorc, südgermanischer Raum, Frühmittelalter, Germanen, Christianisierung, Römisch-Germanischer Kontakt, Sprachkultur, voralthochdeutsch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Runenschrift im südgermanischen Raum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Runenschrift im südgermanischen Raum und ihre Bedeutung für die frühdeutsche Sprach- und Kulturgeschichte. Sie beleuchtet den Übergang von der germanischen zur frühdeutschen Kultur unter Berücksichtigung des Einflusses der römischen Kultur und der Christianisierung. Der Fokus liegt auf der Anwendung der Runen im süddeutschen Raum und ihrer allmählichen Ablösung durch das lateinische Alphabet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Ursprung und die Entwicklung der Runenschrift, die verschiedenen Runenreihen (älteres und jüngeres Futhark, Futhorc), die Verbreitung der Runen im südgermanischen Raum, die Anwendung der Runen in verschiedenen Kontexten (Personennamen, Brakteaten, religiöse Inschriften) und den Einfluss des römischen Reiches und der Christianisierung auf den Rückgang der Runenschrift.
Welche Runenreihen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht das ältere Futhark, das jüngere Futhark (inklusive der skandinavischen und angelsächsischen Varianten, Futhorc) und deren Entwicklung und geographische Verbreitung.
Wo liegt der geographische Schwerpunkt der Untersuchung?
Der geographische Schwerpunkt liegt auf dem südgermanischen (deutschen) Raum. Die Arbeit analysiert die Anwendung der Runenschrift in diesem Gebiet und konkrete Funde im Kontext der damaligen Kultur.
Wie wird der römisch-germanische Kontakt behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des römischen Reiches und der römischen Kultur auf die Runenschrift und den germanischen Raum. Der kulturelle Austausch und die Interaktion beider Kulturen und deren Einfluss auf den Gebrauch der Runenschrift werden beleuchtet.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist im Haupttext enthalten und nicht in diesem FAQ aufgeführt. Die Arbeit konzentriert sich auf konkrete Funde und deren Interpretation im Kontext der damaligen Kultur. Mythologische oder nationalsozialistische Aspekte werden vermieden.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Runenschrift als relevantes Dokument voralthochdeutscher Sprachkultur zu untersuchen und die Grauzonen der Überschneidung germanischer und römischer Kultur zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Runen, Runenschrift, älteres Futhark, jüngeres Futhark, Futhorc, südgermanischer Raum, Frühmittelalter, Germanen, Christianisierung, Römisch-Germanischer Kontakt, Sprachkultur, voralthochdeutsch.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der Einleitung, des Kapitels zum Ursprung der Runen, der Kapitel zu den Runenreihen und ihrer Anwendung im südgermanischen Raum, sowie des Kapitels zum römisch-germanischen Kontakt.
- Arbeit zitieren
- Patrick Wolf (Autor:in), 2008, Runen im südgermanischen Raum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161172