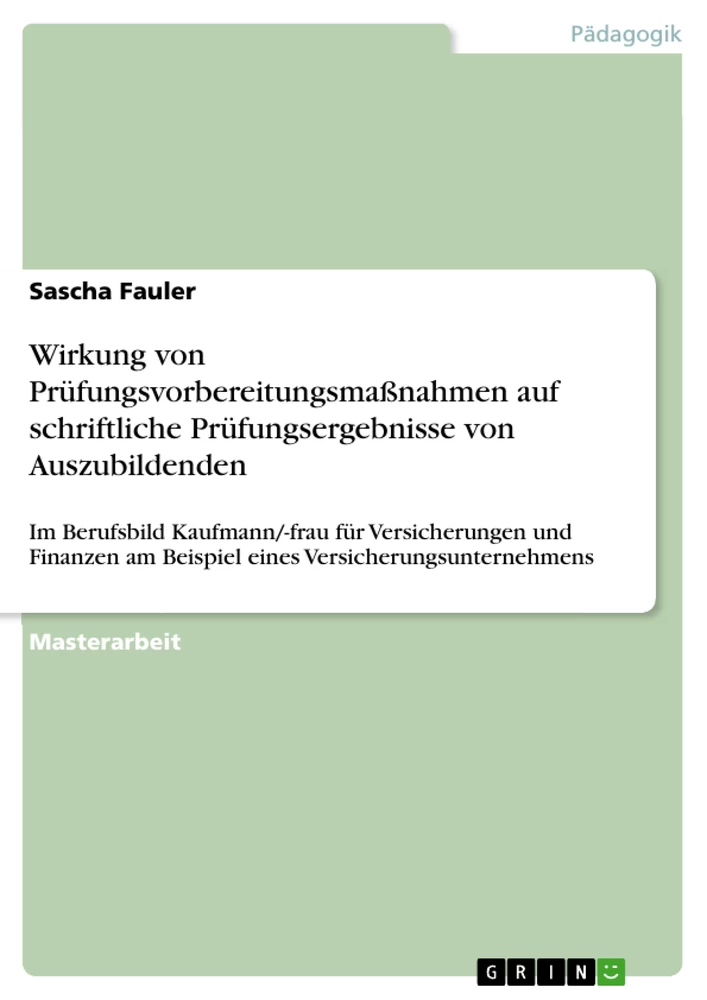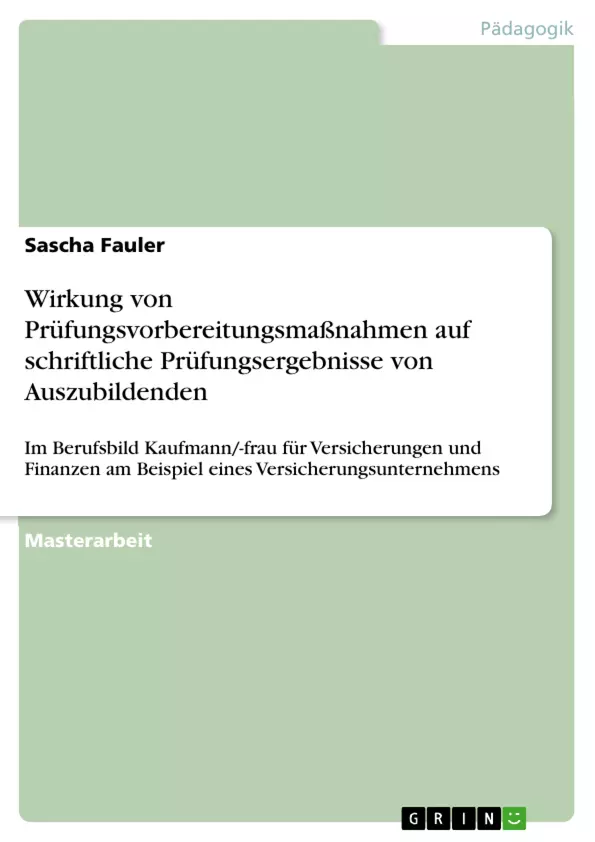In großen Unternehmen, genauso wie in Versicherungsgesellschaften, trifft man insgesamt oft eine stark schulisch ausgerichtete Begleitung der Auszubildenden hin zur Prüfung an. Diesem Umstand steht nachfolgend beschriebene Entwicklung entgegen: Auszubildende sollen durch die Berufsausbildung umfassende Handlungskompetenz und reflexive Handlungsfähigkeit erwerben und so an Souveränität gewinnen. (vgl. Zimmer 2009, 22-23) Hintergrund dessen ist ein Abrücken von einer lebenslangen Berufsausübung hin zum Erwerb des Vermögens, sich an nicht genau prognostizierbare Entwicklungen der Arbeitswelt anpassen zu können. (vgl. Buckert/Kluge 2006, 14; vgl. Dehnbostel 2009, 199) Damit Auszubildende Erfahrungen sammeln können (vgl. Thillosen 2005, 13), die Voraussetzung für den Erwerb einer umfassenden Handlungskompetenz und reflexiven Handlungsfähigkeit sind, ist es notwendig, diesen gewisse Freiheiten im Lernprozess einzuräumen, sprich ihnen die Voraussetzungen für ein aufgabenorientiertes, ganzheitliches, selbst gesteuertes Lernen zu bieten. (vgl. Käppeli 2001, 117; vgl. Zimmer 2009, 33; vgl. Dehnbostel 1996, 62-63) Diese manifestieren sich in den Ausbildungsbedingungen und -infrastrukturen, der Lernbegleitung und den Ausbildungsmethoden/Lernformen. (vgl. Dehnbostel 2008, 6-7)
Es stellt sich also die Frage, ob andere Methoden zur Prüfungsvorbereitung möglicherweise besser wirken als konventioneller Unterricht. Deshalb wurde vorliegend untersucht, wie sich die Prüfungsvorbereitung in Form eines begleiteten Selbstlernprozesses im Gegensatz zur traditionellen Prüfungsvorbereitungsmethode, dem Unterricht, in den Prüfungsergebnissen der Auszubildenden auswirkt und welche Ursachen dies hat.
Zum Vergleich zweier der beiden Abschlussprüfungsvorbereitungsmethoden hinsichtlich ihrer Wirkung auf schriftliche Abschlussprüfungsergebnisse wurde ein Experiment, durchgeführt. (vgl. Klauer 2005, 14 ff.)
Um Erklärungsansätze für Ursachen möglicher differierender Erfolge in der simulierten Abschlussprüfung bei den gleich vorbenoteten Probandengruppen zu gewinnen, schließt sich eine qualitative Untersuchung in Form von fokussierten Interviews mit den Probanden an.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung mit Problemstellung
- 2. Grundlagen der Untersuchung
- 2.1 Stand der Berufspädagogik in der betrieblichen Berufsausbildung
- 2.2 Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen
- 2.3 Das Versicherungsunternehmen als Ausbildender
- 2.4 Abschlussprüfung
- 2.4.1 Sinn und Zweck von Abschlussprüfungen
- 2.4.2 Abschlussprüfung im Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen
- 2.4.3 Schriftliche Abschlussprüfung im Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen
- 2.5 Vorbereitung auf die Abschlussprüfung
- 2.5.1 Sinn und Zweck von Vorbereitungen auf die schriftliche Abschlussprüfung
- 2.5.2 Möglichkeiten und Formen der Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung
- 2.5.3 Thesen zur Wirkung ausgewählter Formen zur Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung
- 3. Untersuchung der Wirkung von Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf schriftliche Prüfungsergebnisse
- 3.1 Grundlagen der Forschung im Bezug auf den Untersuchungsgegenstand
- 3.1.1 Pädagogische Forschung
- 3.1.2 Begriff der quantitativen und qualitativen Forschung
- 3.1.3 Verbindung qualitativer und quantitativer Forschung
- 3.1.4 Ausgewählte Methoden
- 3.1.5 Vor- und Nachteile der ausgewählten Methoden
- 3.1.6 Gütekriterien der qualitativen und quantitativen Forschung
- 3.2 Entwicklung und Fortgang des Forschungsvorhabens (Projekt)
- 3.2.1 Planung des Forschungsvorhabens
- 3.2.2 Durchführung des Forschungsvorhabens
- 3.2.3 Auswertungen des Forschungsvorhabens
- 3.3 Ergebnisse der Untersuchung
- 3.3.1 Quantitative Ergebnisse
- 3.3.2 Qualitative Ergebnisse
- 3.1 Grundlagen der Forschung im Bezug auf den Untersuchungsgegenstand
- 4. Bedeutung der Untersuchungsergebnisse
- 4.1 Abgleich der Untersuchungsergebnisse mit den Wirkungsthesen
- 4.1.1 Abgleich der quantitativen Ergebnisse mit den Wirkungsthesen
- 4.1.2 Abgleich der qualitativen Ergebnisse mit den Wirkungsthesen
- 4.2 Schlussfolgerungen aus den Untersuchungsergebnissen
- 4.3 Empfehlungen zur Gestaltung von Vorbereitungsmaßnahmen auf schriftliche Prüfungen
- 4.1 Abgleich der Untersuchungsergebnisse mit den Wirkungsthesen
- 5. Wirtschaftliche Aspekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Wirkung verschiedener Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf die schriftlichen Prüfungsergebnisse von Auszubildenden im Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Ziel ist es, den Einfluss unterschiedlicher Lernmethoden auf den Lernerfolg zu analysieren und Empfehlungen für die Gestaltung effektiver Prüfungsvorbereitungen zu geben.
- Wirkung verschiedener Prüfungsvorbereitungsmethoden
- Analyse des Lernerfolgs im Kontext der Berufsausbildung
- Entwicklung von Empfehlungen für effektive Prüfungsvorbereitung
- Zusammenhang zwischen Lernmethoden und Prüfungsergebnissen
- Bewertung quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung mit Problemstellung: Die Einleitung beschreibt die Problemstellung der Arbeit, nämlich die Frage nach der Wirksamkeit verschiedener Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf die Lernergebnisse von Auszubildenden. Es wird der Forschungsstand skizziert und die Forschungsfrage präzisiert. Die Arbeit begründet die Relevanz des Themas im Kontext der betrieblichen Ausbildung und legt die methodischen Vorgehensweisen dar.
2. Grundlagen der Untersuchung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden zunächst der Stand der Berufspädagogik in der betrieblichen Ausbildung, das Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen sowie das Versicherungsunternehmen als Ausbildungsbetrieb beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Abschlussprüfung, inklusive Sinn und Zweck, Aufbau und den Anforderungen der schriftlichen Prüfung. Abschließend werden verschiedene Möglichkeiten und Formen der Prüfungsvorbereitung vorgestellt und Thesen zur Wirkung dieser Maßnahmen formuliert. Diese Thesen bilden die Grundlage für die empirische Untersuchung.
3. Untersuchung der Wirkung von Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf schriftliche Prüfungsergebnisse: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es werden die gewählten Forschungsmethoden (quantitativ und qualitativ) detailliert dargestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Die Planung, Durchführung und Auswertung des Forschungsvorhabens werden Schritt für Schritt erläutert. Es werden die Gütekriterien der verwendeten Methoden berücksichtigt und deren Einhaltung begründet. Die Kapitel gliedert sich in die Beschreibung der angewandten Methoden, die Entwicklung des Forschungsdesigns und die Darstellung der Ergebnisse.
4. Bedeutung der Untersuchungsergebnisse: Dieses Kapitel wertet die Ergebnisse der Untersuchung aus und diskutiert deren Bedeutung. Die quantitativen und qualitativen Ergebnisse werden im Hinblick auf die im zweiten Kapitel formulierten Thesen analysiert. Es werden Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen für die Gestaltung zukünftiger Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen abgeleitet. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Ergebnisse und deren Implikationen für die Praxis.
5. Wirtschaftliche Aspekte: Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftlichen Aspekte der Prüfungsvorbereitung. Es werden die Kosten der verschiedenen Vorbereitungsmaßnahmen betrachtet und deren Wirtschaftlichkeit im Verhältnis zum Lernerfolg bewertet. Dies erlaubt eine ganzheitliche Betrachtung der Effektivität und Effizienz der Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Prüfungsvorbereitung, Lernerfolg, Berufsausbildung, Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, quantitative Forschung, qualitative Forschung, Lernmethoden, Wirksamkeit, betriebliche Bildung, Abschlussprüfung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Wirkung von Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf schriftliche Prüfungsergebnisse
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Wirkung verschiedener Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf die schriftlichen Prüfungsergebnisse von Auszubildenden zum Kaufmann/zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Das Ziel ist die Analyse des Einflusses unterschiedlicher Lernmethoden auf den Lernerfolg und die Ableitung von Empfehlungen für effektive Prüfungsvorbereitungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung mit Problemstellung, 2. Grundlagen der Untersuchung, 3. Untersuchung der Wirkung von Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf schriftliche Prüfungsergebnisse, 4. Bedeutung der Untersuchungsergebnisse und 5. Wirtschaftliche Aspekte. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Forschungsfrage, beginnend mit der Einleitung und der Problemstellung, über die theoretischen Grundlagen und die Methodik der empirischen Untersuchung bis hin zur Auswertung der Ergebnisse und deren wirtschaftlicher Relevanz.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Schwerpunkte sind die Wirkung verschiedener Prüfungsvorbereitungsmethoden, die Analyse des Lernerfolgs im Kontext der Berufsausbildung, die Entwicklung von Empfehlungen für effektive Prüfungsvorbereitung, der Zusammenhang zwischen Lernmethoden und Prüfungsergebnissen sowie die Bewertung quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert quantitative und qualitative Forschungsmethoden. Die Methodik wird detailliert im Kapitel 3 beschrieben, inklusive der Vor- und Nachteile der gewählten Ansätze und der Berücksichtigung von Gütekriterien. Die konkrete Vorgehensweise umfasst Planung, Durchführung und Auswertung des Forschungsvorhabens.
Wie werden die Ergebnisse ausgewertet?
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt sowohl quantitativ als auch qualitativ. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf im zweiten Kapitel formulierte Thesen analysiert. Kapitel 4 zieht Schlussfolgerungen aus den Untersuchungsergebnissen und leitet Empfehlungen für die Gestaltung zukünftiger Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen ab.
Welche wirtschaftlichen Aspekte werden betrachtet?
Kapitel 5 beleuchtet die Kosten der verschiedenen Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen und deren Wirtschaftlichkeit im Verhältnis zum Lernerfolg. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung der Effektivität und Effizienz der Maßnahmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prüfungsvorbereitung, Lernerfolg, Berufsausbildung, Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, quantitative Forschung, qualitative Forschung, Lernmethoden, Wirksamkeit, betriebliche Bildung, Abschlussprüfung.
Welche Grundlagen werden in der Arbeit behandelt?
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar. Es umfasst den Stand der Berufspädagogik in der betrieblichen Ausbildung, das Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, das Versicherungsunternehmen als Ausbildungsbetrieb, die Abschlussprüfung (Sinn, Zweck, Aufbau, Anforderungen der schriftlichen Prüfung) und verschiedene Möglichkeiten und Formen der Prüfungsvorbereitung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung beschreibt und die Forschungsfrage präzisiert. Es folgt ein Kapitel mit den theoretischen Grundlagen. Das dritte Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung inklusive Methodik und Ergebnisse. Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und Schlussfolgerungen gezogen (Kapitel 4). Abschließend werden wirtschaftliche Aspekte beleuchtet (Kapitel 5).
- Arbeit zitieren
- Sascha Fauler (Autor:in), 2010, Wirkung von Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen auf schriftliche Prüfungsergebnisse von Auszubildenden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161254