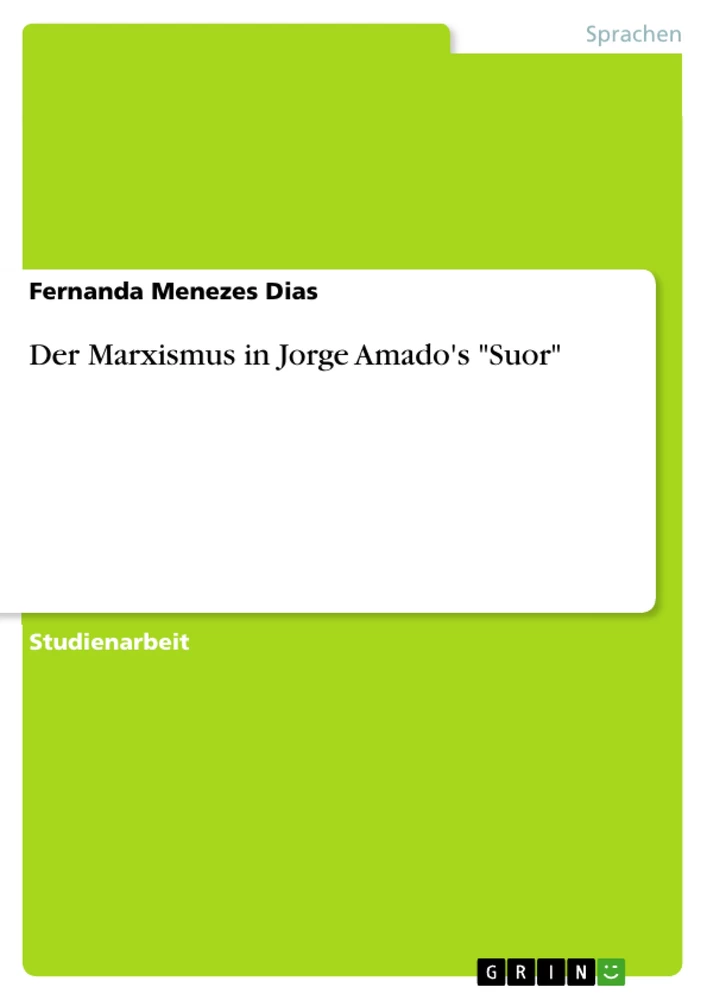In dieser Arbeit soll das Thema Marxismus im Roman Suor1 von Jorge Amado dargestellt werden. Suor ist einer von fünf Büchern des Bahia-Zyklus, die alle zwischen 1933 und 1937 erschienen sind. Schauplatz ist die Kakaoprovinz Bahia im Nordosten des Landes. Erzählt wird vom Stadt- und Landleben und das alles stets aus einer kommunistischen Perspektive heraus. Dabei nutzte Amado, selbst ein jahrzehntelanger, aktiver Anhänger des Marxismus, vor allem seine ersten Bücher als Forum für sozialistische Ideen.
Es soll nicht die Aufgabe dieser Hausarbeit sein, den Marxismus oder die Art und Weise wie er von Amado im Buch dargestellt wird zu beurteilen. Viel eher soll Suor selbst im Mittelpunkt stehen und darüber hinaus vorhandene Parallelen zum Marxismus gezogen werden. Letzteres ist in seinen Grundzügen dargestellt und je nach Gewichtung im Roman, näher erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Der Marxismus
- Der historische und dialektische Materialismus
- Politische Ökonomie
- Vom Sozialismus zum Kommunismus
- Sour und der Marxismus
- Die Ladeira do Pelourinho 68 als Mikrokosmos
- Die prägnantesten Stellen
- Jorge Amado und die Rolle des Erzählers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung des Marxismus im Roman „Suor“ von Jorge Amado. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Parallelen zwischen Amado's Werk und den Grundprinzipien des Marxismus, ohne jedoch den Marxismus selbst zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet die zentralen Elemente des Marxismus und zeigt auf, wie diese im Roman zum Ausdruck kommen.
- Die Bedeutung des historischen Materialismus im Roman
- Die Rolle der Klassenkämpfe in Amado's Werk
- Die Darstellung der ökonomischen Strukturen in „Suor“
- Der Einfluss des dialektischen Materialismus auf die narrative Struktur
- Die politische Botschaft des Romans im Kontext des Marxismus
Zusammenfassung der Kapitel
Der Marxismus
Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Prinzipien des Marxismus, insbesondere den historischen und dialektischen Materialismus. Die Ausführungen konzentrieren sich auf Marx' Theorie der Klassenkämpfe, die Entwicklung der Gesellschaft durch verschiedene Produktionsverhältnisse und die Beziehung zwischen ökonomischem Unterbau und ideologischem Überbau. Die Kapitel fokussieren auf die key concepts des Marxismus, ohne in detaillierte Analysen der einzelnen Theorien einzugehen.
Sour und der Marxismus
Dieser Teil der Arbeit analysiert die Anwendung des Marxismus im Roman „Suor“. Er beleuchtet die Darstellung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse in der Kakaoprovinz Bahia, sowie die Rolle des Proletariats und der Bourgeoisie im Roman. Zusätzlich werden die prägnantesten Stellen im Buch, die Bezug auf marxistische Konzepte nehmen, herausgestellt. Das Kapitel diskutiert die Art und Weise, wie Amado die marxistischen Ideen in seine Erzähltechnik einbaut und wie diese die Handlung und die Figuren prägen.
Jorge Amado und die Rolle des Erzählers
Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle des Erzählers in „Suor“ und wie er den marxistischen Standpunkt des Romans vermittelt. Die Ausführungen beleuchten die Art und Weise, wie Amado die Perspektive des Proletariats in die Erzählung integriert und wie diese Perspektive die Sichtweise des Lesers beeinflusst. Der Fokus liegt auf der Analyse der narrativen Strategien, die Amado einsetzt, um den marxistischen Blickwinkel zu transportieren.
Schlüsselwörter
Marxismus, Historischer Materialismus, Dialektischer Materialismus, Klassenkampf, Politische Ökonomie, Proletariat, Bourgeoisie, Kakaoprovinz Bahia, soziale und ökonomische Verhältnisse, Erzähltechnik, Perspektive, politische Botschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welches Thema behandelt Jorge Amados Roman „Suor“?
Der Roman beschreibt das harte Leben der Arbeiter in der Kakaoprovinz Bahia und nutzt dies als Forum für sozialistische und marxistische Ideen.
Wie wird der Marxismus im Buch dargestellt?
Die Arbeit analysiert Parallelen zum historischen und dialektischen Materialismus sowie die Darstellung von Klassenkämpfen aus einer kommunistischen Perspektive.
Was symbolisiert die „Ladeira do Pelourinho 68“?
Dieses Haus fungiert im Roman als Mikrokosmos, der die sozialen und ökonomischen Verhältnisse der brasilianischen Gesellschaft widerspiegelt.
Welche Rolle spielt Jorge Amado als Erzähler?
Amado integriert die Perspektive des Proletariats direkt in die Erzählstruktur, um seine politische Botschaft und marxistische Weltsicht zu transportieren.
In welchem historischen Kontext entstand das Werk?
„Suor“ gehört zum Bahia-Zyklus, der zwischen 1933 und 1937 erschien, einer Zeit, in der Amado ein aktiver Anhänger des Marxismus war.
- Quote paper
- Magister Artium Fernanda Menezes Dias (Author), 2007, Der Marxismus in Jorge Amado's "Suor", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161328