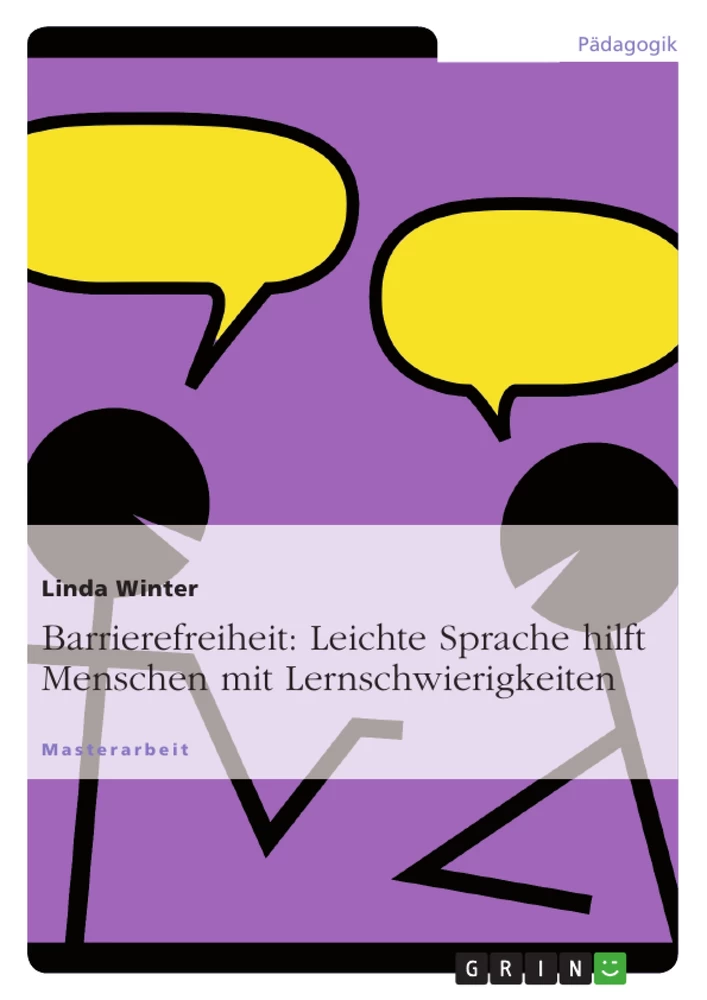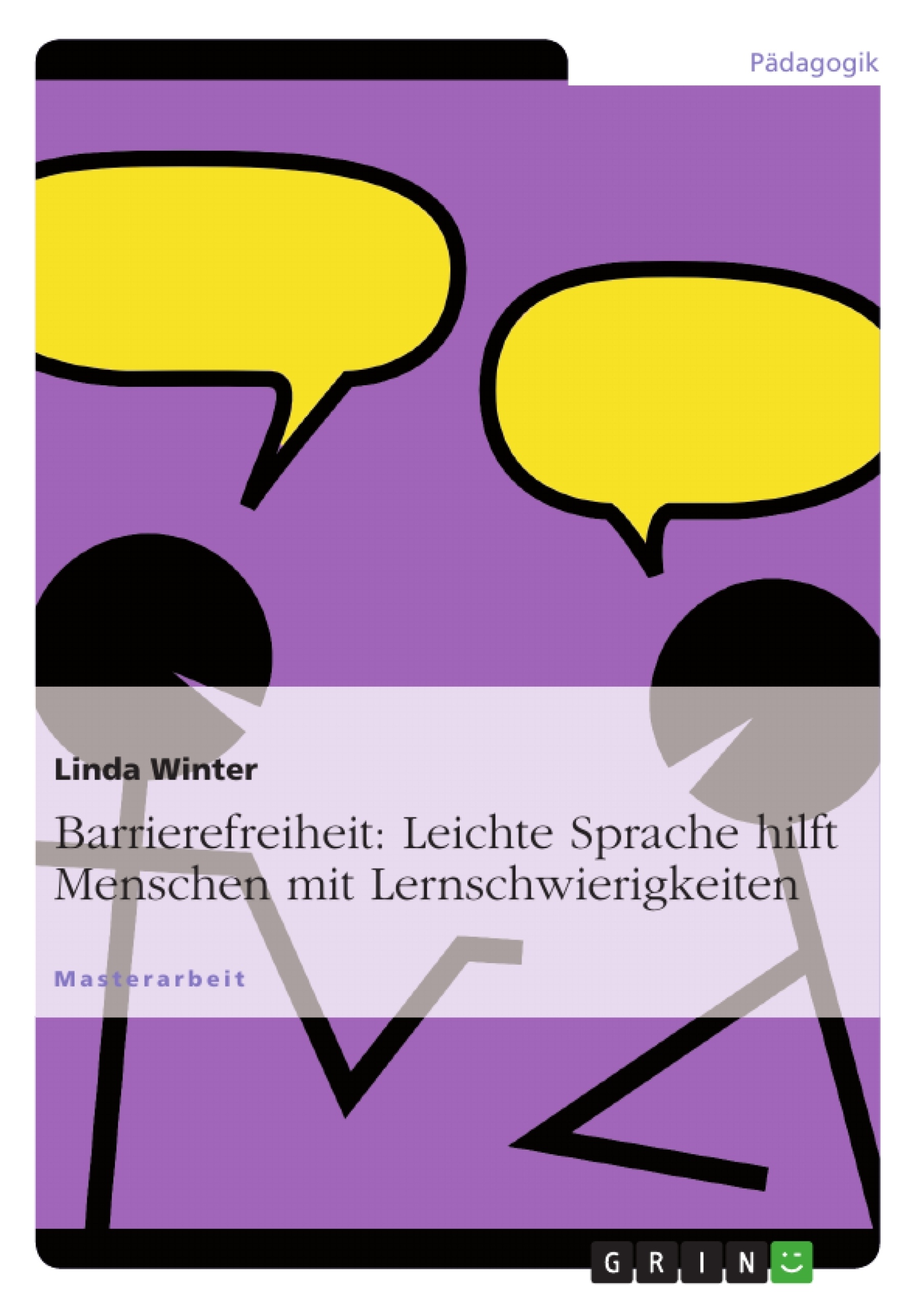„Wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten keine guten [leicht verständlichen] Informationen bekommen, schließt man sie aus. Sie können dann bei vielen Dingen nicht mitmachen. Sie sind dann davon abhängig, dass andere Menschen für sie entscheiden.“
Wer in die Geschichte des Personenkreises von Menschen mit Behinderung zurückblickt, dem wird deutlich, dass ihnen lange Zeit das Recht, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, abgesprochen wurde – es fand eine Besonderung in sämtlichen Bereichen ihres Lebens (Sonderschulen, Werkstätten, etc.) statt. Heute hat man erkannt: Auch Menschen mit Behinderung können, wollen und sollen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilnehmen – das neue Leitparadigma lautet Teilhabe.
Doch wie lässt sich Teilhabe, insbesondere in Bezug auf Menschen mit Lernschwierigkeiten, verwirklichen? Eine Lösung bietet das von u. a. Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelte Konzept der Leichten Sprache, das durch die Aufbereitung von Nachrichten, Informationen und Kommunikation in eine zielgruppenorientierte verständliche Form einem Ausschluss entgegenwirken und Teilhabe ermöglichen will.
Das Thema „Leichte Sprache“ ist in der deutschen Gesellschaft jedoch weitestgehend unbekannt. Selbst Menschen mit Lese- und Verständnisproblemen (z. B. Menschen mit Lernschwierigkeiten, ältere Menschen, Analphabeten, Menschen mit Migrationshintergrund oder mit einer Hörschädigung), die von einem leichten Sprachgebrauch profitieren könnten, wissen kaum um diese Idee. Man sollte meinen, dass insbesondere (sonder-)pädagogische Fachkräfte, die z. B. in ihrem späteren Berufsleben mit der Personengruppe „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ in Kontakt treten, das Konzept Leichte Sprache kennen müssten – dem ist jedoch selten so. Dabei ist der Ermöglichung von Teilhabe an Kommunikation und Information, besonders in unserer heutigen Informationsgesellschaft,höchste Priorität einzuräumen.
Die vorliegende Arbeit verfolgt vor diesem Hintergrund zunächst die Intention, die hinter der Leichten Sprache stehenden Ideen und Regelungen darzustellen und eine Sensibilisierung für das Konzept als Mittel zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe zu erreichen.
In dieser Abschlussarbeit wird zudem – unter (sonder-)pädagogischem Blickwinkel – der Frage nachgegangen, welche Bedingungen unter dem Aspekt „Leichte Sprache“ zu schaffen sind, um Menschen mit Lernschwierigkeiten eine barrierefreie Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Personenkreis ,,Menschen mit Lernschwierigkeiten"
- 3. Gesellschaftliche Teilhabe und Behinderung
- 3.1 Begriffsklärung „Teilhabe“
- 3.2 Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten – Dabei sein ist nicht alles
- 3.3 Gesellschaftliche Modelle von Behinderung und ihre Auswirkung auf Teilhabe
- 3.4 Gesetze zur Teilhabe
- 3.4.1 Zum Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik
- 3.4.2 Das Behindertengleichstellungsgesetz
- 3.5 Barrierefreie Teilhabe
- 3.5.1 Von der Barrierefreiheit zum „Design für alle“
- 3.5.2 Barrierefreie Information und Kommunikation
- 4. Das Konzept Leichte Sprache
- 4.1 Leichte Sprache in der Theorie
- 4.1.1 Begriffsklärung „Leichte Sprache“
- 4.1.2 Ursprung und Verbreitung
- 4.1.3 Methoden und Regelungen
- 4.1.3.1 Leserfaktor
- 4.1.3.2 Inhalt
- 4.1.3.3 Textgestaltung
- 4.2 Leichte Sprache in der praktischen Umsetzung
- 4.2.1 Schritte zur Erstellung eines leicht lesbaren Dokuments
- 4.2.2 Zur Rolle der Verständniskontrolle durch Menschen mit Lernschwierigkeiten
- 4.2.3 Praxisbeispiel zu Leichter Sprache anhand einer eigenen Übersetzung
- 4.2.4 Reflexion der eigenen Übersetzung
- 4.3 Grenzen und Probleme hinsichtlich Leichter Sprache
- 4.1 Leichte Sprache in der Theorie
- 5. Ausblick – Barrierefreie Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten
- 5.1 Leichte Sprache als Recht
- 5.1.1 Strukturelle Konsequenzen
- 5.1.2 Konsequenzen im Bereich Arbeit
- 5.1.3 Gesellschaftliche Konsequenzen
- 5.2 Welches Rüstzeug benötigen professionelle Mitarbeiter zur Verwirklichung barrierefreier Teilhabe
- 5.1 Leichte Sprache als Recht
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Möglichkeiten von Leichter Sprache als Werkzeug zur barrierefreien Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten an der Gesellschaft. Ziel der Arbeit ist es, das Konzept der Leichten Sprache im Detail zu erläutern und seine Anwendungsmöglichkeiten im Kontext der gesellschaftlichen Teilhabe zu beleuchten.
- Begriffserklärung und Entstehung von Leichter Sprache
- Anwendung und Umsetzung der Leichten Sprache in verschiedenen Bereichen
- Barrierefreie Teilhabe und ihre Bedeutung für Menschen mit Lernschwierigkeiten
- Rechtliche Rahmenbedingungen und die Bedeutung von Leichter Sprache für die Inklusion
- Herausforderungen und Grenzen bei der Anwendung von Leichter Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 widmet sich der Definition und Beschreibung des Personenkreises „Menschen mit Lernschwierigkeiten“. Kapitel 3 beleuchtet das Konzept der gesellschaftlichen Teilhabe im Allgemeinen und im Besonderen für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es werden verschiedene gesellschaftliche Modelle von Behinderung und deren Auswirkungen auf die Teilhabe diskutiert. Zudem werden relevante Gesetze und das Konzept der barrierefreien Teilhabe erläutert. Kapitel 4 führt in das Konzept der Leichten Sprache ein. Es werden der Ursprung, die Verbreitung und die Methoden der Leichten Sprache detailliert beschrieben. Ein Praxisbeispiel für die Umsetzung von Leichter Sprache wird vorgestellt. Kapitel 5 befasst sich mit den Perspektiven und dem Potenzial der Leichten Sprache für die barrierefreie Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es werden die Auswirkungen auf verschiedene Bereiche wie Strukturen, Arbeit und die Gesellschaft im Allgemeinen betrachtet. Zudem werden die notwendigen Kompetenzen von Fachkräften für die Umsetzung barrierefreier Teilhabe analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Leichte Sprache, barrierefreie Teilhabe, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Inklusion, gesellschaftliche Modelle von Behinderung, Rechtsgrundlagen, Praxisbeispiel, Übersetzung, Verständniskontrolle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist „Leichte Sprache“?
Leichte Sprache ist ein Konzept zur Aufbereitung von Informationen in eine besonders verständliche Form, um Menschen mit Lernschwierigkeiten Teilhabe an Kommunikation zu ermöglichen.
Wer profitiert von Leichter Sprache?
Primär Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Gehörlose oder funktionale Analphabeten.
Welche Regeln gelten für die Erstellung von Texten in Leichter Sprache?
Regeln betreffen den Inhalt (einfache Wörter), die Grammatik (kurze Sätze, keine Passivformen) und die Textgestaltung (große Schrift, Bilder zur Unterstützung).
Warum ist eine „Verständniskontrolle“ wichtig?
Texte in Leichter Sprache sollten von Menschen aus der Zielgruppe geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Informationen wirklich barrierefrei ankommen.
Welchen rechtlichen Hintergrund hat das Konzept?
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und die UN-Behindertenrechtskonvention fordern Barrierefreiheit in der Information als Voraussetzung für Inklusion.
- Quote paper
- Linda Winter (Author), 2010, Barrierefreiheit: Leichte Sprache hilft Menschen mit Lernschwierigkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161331