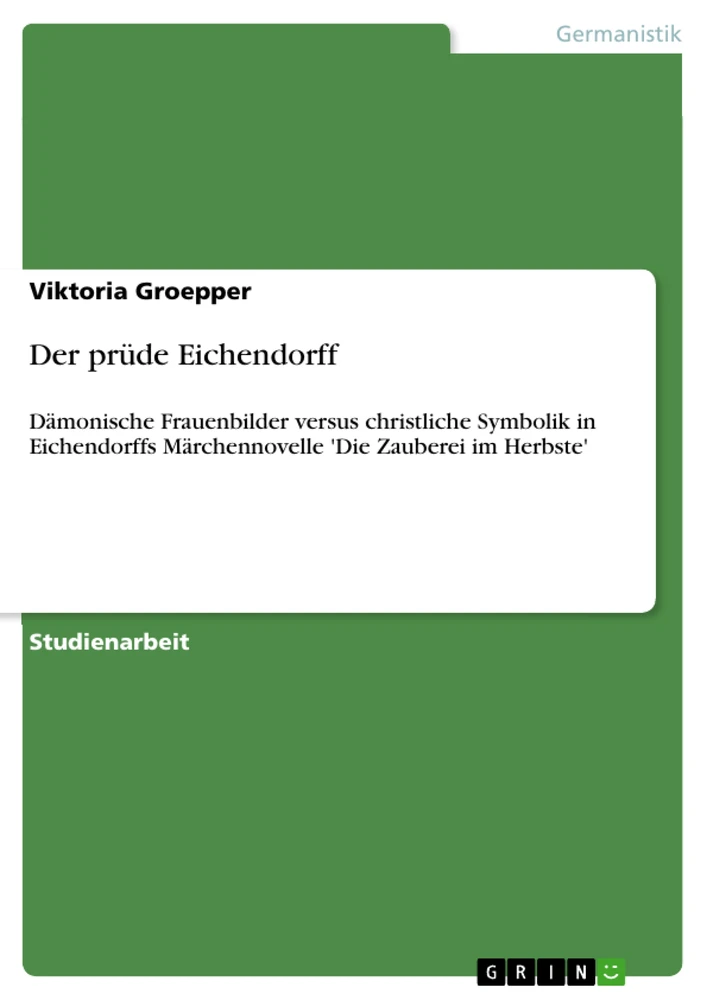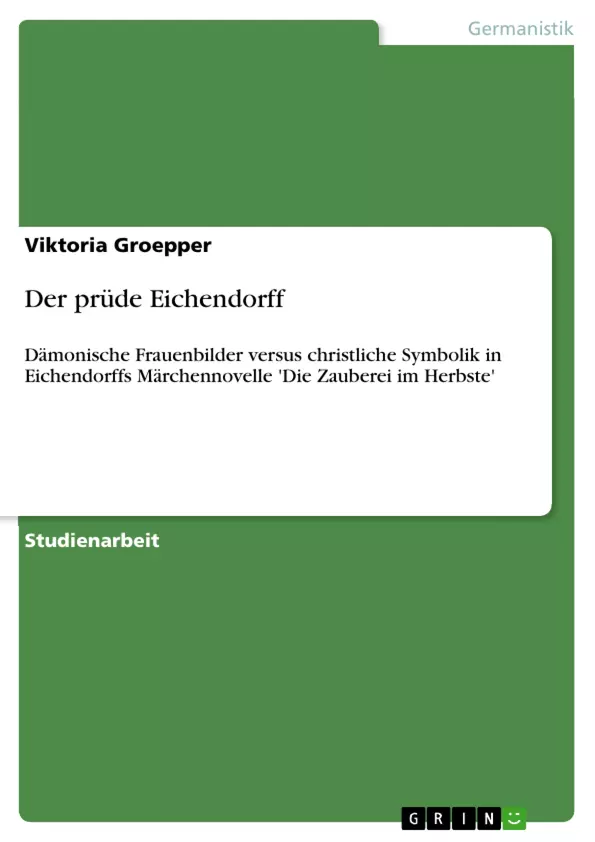„…gleich einem Schiffer, der bestimmt weiß, wo er hinsteuern soll, und sich von dem wunderbaren Lied der Sirenen unterwegs nicht irremachen läßt.“
Der bekannte Lyriker und Schriftsteller Joseph von Eichendorff greift in diesen Zeilen das alte Motiv der Loreley auf, der verführerischen Wassernixe, welche den symbolischen ‚Schiffer‘ durch ihren Gesang vom Weg abkommen lässt und ihn letzten Endes in sein Verderben führt. Auffallend häufig thematisiert Eichendorff dämonische Frauengestalten in seiner Dichtung und in seinen Erzählungen: „[Es wird] das Thema angeschlagen, das nur in wenigen der erzählenden Werke Eichendorffs völlig fehlt: die verführerische Macht der durch eine dämonische Frauengestalt verkörperten, vom göttlichen Schöpfungsgrund emanzipierten Natur.“ , so auch in seiner frühesten Prosaarbeit, Die Zauberei im Herbste. Dabei entwickelt der Autor eine starke Gegensätzlichkeit von erotischen, oft naturverbundenen, eher mythischen Frauengestalten, und dem idealisierten Frauenbild des Christentums: die reine Jungfrau, deren Bestimmung sich in der Ehe und dem Zeugen von Nachkommen erfüllt. Letztere erweckt beim Leser immer wieder die Assoziation mit Maria, dem christlichen Idealbild einer Frau, welche ihren Sohn Jesus ‘unbefleckt‘ empfangen hat...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kurzer Abriss der Dämonisierung der Frau in der christlichen Religion und in Eichendorffs Werk im Allgemeinen
- 3. Die stark antithetische Symbolik in Eichendorffs Werk
- 4. Das Zauberfräulein versus Berta
- 4.1 Berta - Inbegriff von Reinheit und Unschuld?
- 4.2 Das Zauberfräulein – Dämonin oder Göttin Venus?
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Joseph von Eichendorffs frühe Märchennovelle „Die Zauberei im Herbste“ auf die gegensätzliche Symbolik von dämonischen Frauengestalten und christlicher Motivik. Es wird analysiert, wie Eichendorff die Verlockung der Erotik beschreibt und gleichzeitig dämonisiert, reflektierend über die Spannungen zwischen sexueller Leidenschaft und dem idealisierten Frauenbild des Christentums.
- Dämonisierung der Frau in der christlichen Religion und in Eichendorffs Werk
- Antithetische Symbolik in „Die Zauberei im Herbste“
- Kontrast zwischen dem „Zauberfräulein“ und Berta
- Eichendorffs ambivalente Darstellung von Erotik und Glaube
- Autobiographische Aspekte der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie Eichendorffs Beschäftigung mit dem Motiv der verführerischen Frauengestalt aufgreift und den zentralen Gegensatz zwischen dämonischen Frauenbildern und dem christlichen Idealbild der Frau in seiner Novelle „Die Zauberei im Herbste“ herausstellt. Sie erwähnt die autobiographischen Aspekte der Erzählung und die Ambivalenz des jungen Eichendorffs in Bezug auf seine Lebensentscheidungen, spiegelnd in der fehlenden Erlösung des Protagonisten.
2. Kurzer Abriss der Dämonisierung der Frau in der christlichen Religion und in Eichendorffs Werk im Allgemeinen: Dieses Kapitel beleuchtet die historische und religiöse Perspektive der Dämonisierung weiblicher Figuren und Sexualität, insbesondere im Kontext des christlichen Glaubens. Es verweist auf den Gegensatz von Gut und Böse, Reinheit und Sünde, und deutet die psychoanalytische Interpretation der Novelle an, die die Angst vor dem Weiblichen und die Verdrängung sexueller Wünsche betont. Die sieben Todsünden werden als Beispiel für die Verbindung von Triebhaftigkeit und Bösem genannt.
3. Die stark antithetische Symbolik in Eichendorffs Werk: (Der Text liefert keine explizite Kapitelzusammenfassung für Kapitel 3, daher kann hier nur eine Platzhalterzusammenfassung erstellt werden.) Dieses Kapitel würde vermutlich eine detaillierte Analyse der symbolischen Elemente in Eichendorffs Werk bieten, die den Gegensatz zwischen den dämonischen und christlichen Motiven verdeutlicht. Es würde sich wahrscheinlich auf spezifische Symbole und Bilder konzentrieren, die in der Novelle verwendet werden, um die Dualität von Gut und Böse darzustellen.
4. Das Zauberfräulein versus Berta: Dieses Kapitel würde den Vergleich zwischen den beiden weiblichen Figuren, dem „Zauberfräulein“ und Berta, ausführlich untersuchen. Es würde die jeweiligen Eigenschaften, Symbole und Rollen analysieren, um den Kontrast zwischen der verführerischen, dämonischen Gestalt des Zauberfräuleins und dem Bild der reinen und unschuldigen Berta herauszuarbeiten. Die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten der Figuren würden beleuchtet, und ihre Bedeutung im Kontext der Gesamtgeschichte erklärt.
Schlüsselwörter
Joseph von Eichendorff, Die Zauberei im Herbste, Dämonisierung der Frau, christliche Symbolik, antithetische Symbolik, Zauberfräulein, Berta, Erotik, Glaube, Autobiographie, Psychoanalyse, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen zu Eichendorffs "Die Zauberei im Herbste"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Joseph von Eichendorffs Novelle „Die Zauberei im Herbste“ unter besonderer Berücksichtigung der gegensätzlichen Symbolik von dämonischen Frauengestalten und christlicher Motivik. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung von Eichendorffs Darstellung der Verlockung und gleichzeitigen Dämonisierung der Erotik sowie der Spannung zwischen sexueller Leidenschaft und dem idealisierten Frauenbild des Christentums.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Dämonisierung der Frau in der christlichen Religion und in Eichendorffs Werk, die antithetische Symbolik in der Novelle, den Kontrast zwischen dem „Zauberfräulein“ und Berta, Eichendorffs ambivalente Darstellung von Erotik und Glaube und autobiographische Aspekte der Novelle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und stellt den zentralen Gegensatz der Novelle heraus. Kapitel 2 beleuchtet die historische und religiöse Perspektive der Dämonisierung weiblicher Figuren und Sexualität. Kapitel 3 (analysiert die antithetische Symbolik in Eichendorffs Werk). Kapitel 4 vergleicht die Figuren des „Zauberfräuleins“ und Berta ausführlich. Kapitel 5 (Ausblick) fehlt eine Zusammenfassung im Originaltext.
Wie werden die Figuren des „Zauberfräuleins“ und Berta dargestellt?
Kapitel 4 analysiert den Kontrast zwischen dem „Zauberfräulein“, dargestellt als verführerische, dämonische Gestalt, und Berta, die als Inbegriff von Reinheit und Unschuld präsentiert wird. Die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten der Figuren und ihre Bedeutung im Kontext der Gesamtgeschichte werden beleuchtet.
Welche Rolle spielt die christliche Symbolik?
Die Arbeit untersucht, wie Eichendorff die christliche Symbolik einsetzt, um den Gegensatz zwischen dem idealisierten Frauenbild des Christentums und der dämonisierten weiblichen Figur zu betonen. Die Spannung zwischen Glaube und sexueller Leidenschaft wird dabei als zentrales Thema behandelt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Joseph von Eichendorff, Die Zauberei im Herbste, Dämonisierung der Frau, christliche Symbolik, antithetische Symbolik, Zauberfräulein, Berta, Erotik, Glaube, Autobiographie, Psychoanalyse, Ambivalenz.
Gibt es autobiografische Aspekte in der Novelle?
Ja, die Arbeit deutet auf autobiografische Aspekte in der Novelle hin und erwähnt die Ambivalenz des jungen Eichendorffs in Bezug auf seine Lebensentscheidungen, die sich in der fehlenden Erlösung des Protagonisten spiegeln.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Analyse, die symbolische Elemente, Charakterisierungen und die thematische Struktur der Novelle untersucht. Es wird auch auf psychoanalytische Interpretationsansätze verwiesen.
- Citation du texte
- Viktoria Groepper (Auteur), 2010, Der prüde Eichendorff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161339