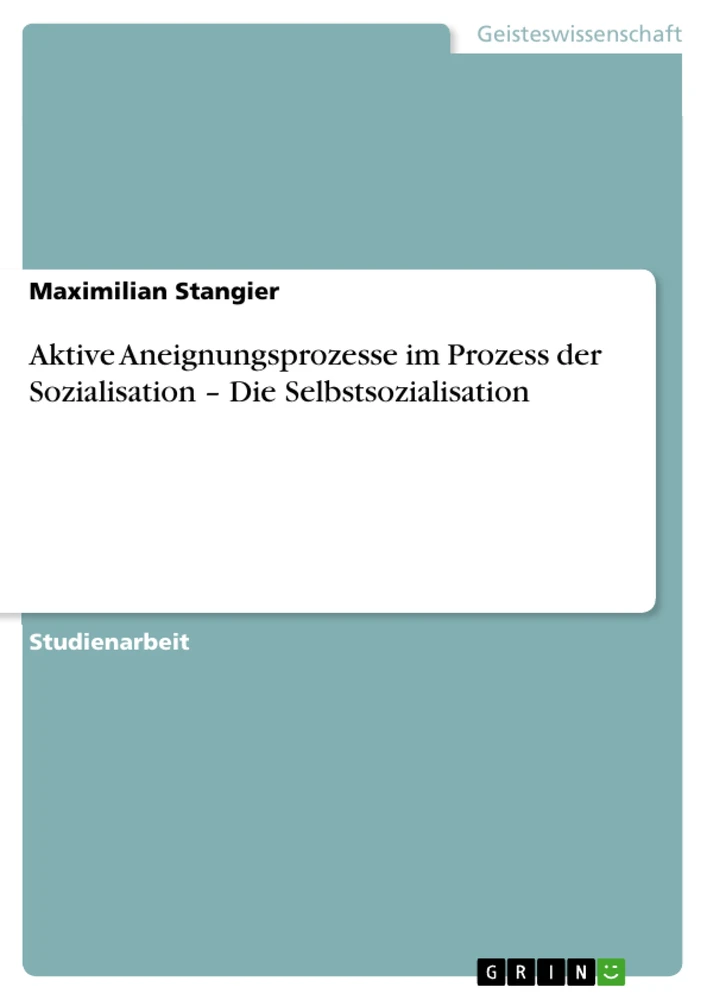Jeden Tag aufs Neue muss ein soziales Wesen ein gewaltiges Maß an auf ihn einstürmenden Reizen aufnehmen, welche verarbeitet, antizipiert und interpretiert werden wollen, um Leben in gesellschaftlichem Rahmen möglich zu machen. Der Mensch leistet dies indem er in einem Prozess zu einem sozial funktionierenden und berechenbaren Rollenträger wird und so Teil der Gesellschaft sein kann. In dem Prozess der sozial – Werdung bildet sich jenes heraus, was wir als Identität verstehen. Ihre Entstehung, extrinsischen Einflüsse, sowie Prozesse der Vergesellschaftung sollen Ansatzpunkte dieser Arbeit sein.
In dem Seminar zur (Selbst-)Sozialisation befassten wir uns weiterführend mit dem Stellenwert der Eigenleistungen des Menschen im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Angeboten, welche unter Verwendung von Schlagworten wie Selbstorganisation, Selbststeuerung, Selbstmanagement, Selbstkontrolle, Selbstregulation sowie Eigenverantwortung geführt werden. Den Schwerpunkt bildete die Betrachtung der aktiven Aneignungsprozesse der Sozialisation, betitelt als Selbstsozialisation. Das Präfix „Selbst-“ wird den Begriffen Sozialisation und Bildung häufig dann vorangestellt, wenn es darum geht, die Selbsttätigkeit und Eigenaktivität des Individuums in den Vordergrund zu rücken. Im pädagogischen Kontext sind es aktuell beispielsweise Konzepte der Selbstwirksamkeit oder auch des Empowerment (als Ablösung des Begriffs der Selbsthilfe), die diskutiert werden.
Den Prozess der Sozialisation beschreibend wurden im Seminar Kinder und Jugendliche besonders hervorgehoben. Sie erleben den Prozess des Erwachsenwerdens zwischen zwei Polen: die Fremdsozialisation, durch pädagogisches Wirken auf der einen, die Selbstsozialisation auf der anderen Seite. „Das Verhältnis von Fremd- und Selbstsozialisation ist vorstellbar als ein Kontinuum, dessen Endpunkte (Fremdsozialisation – Selbstsozialisation) nur als Konstrukte existieren: Es gibt weder reine Selbst- noch reine Fremdsozialisation. Verschiedene soziokulturelle Kontexte bergen jeweils unterschiedliche Selbst- und Fremdsozialisationspotenziale“ (Müller 2004, S.2). Die Herausbildung des Menschen als soziales Wesen findet nun zwischen diesen Polen statt.
Die Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, sich dem theoretischen Begriff der Selbstsozialisation mit einem Umweg über die gängigsten Sozialisationstheorien zu nähern, um dann Anhand eines Essays von Jürgen Zinnecker (2000) ausführlich den Begriff selbst zu erörtern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Identität, Sozialisation und Gesellschaft.
- 2.1 Was ist Identität.........
- 2.2 Was ist Sozialisation
- 2.3 Sozialisationstheorien....
- 2.3.1 Psychologische Bezugstheorien ......
- 2.3.2 Sozialökologische Sichtweise.
- 2.3.3 Rein soziologisch orientierte Theorien
- 2.3.4 Konstruktivistische Sichtweise von Sozialisation......
- 3. Selbstsozialisation
- 3.1 Bedeutungsräume ….....
- 3.2 Begriffsfassung – Umfeld und Gegenpol….………………….
- 3.3 Historischer Exkurs und pädagogische Bedeutung..\n
- 4. Handlungstheorie .....
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der Selbstsozialisation im Kontext der Sozialisationstheorien. Die Arbeit analysiert die Rolle der Eigenleistungen des Menschen im Prozess der Sozialisation und untersucht, wie diese durch die Selbsttätigkeit und Eigenaktivität des Individuums geprägt werden. Dabei wird der Schwerpunkt auf die aktive Aneignungsprozesse der Sozialisation gelegt, die als Selbstsozialisation bezeichnet werden.
- Die Bedeutung von Identität und Sozialisation in der Gestaltung des menschlichen Lebens
- Die verschiedenen Theorien der Sozialisation und ihre Perspektiven auf die Selbstsozialisation
- Die Rolle der Eigenleistungen des Menschen im Prozess der Sozialisation
- Die Analyse von Selbstsozialisationsprozessen im Kontext von Fremdsozialisation
- Die Bedeutung von Selbstsozialisation für die Herausbildung des Menschen als soziales Wesen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit, die Selbstsozialisation, vor und führt den Leser in die zentralen Fragestellungen ein. Kapitel 2 beleuchtet die Begriffe Identität und Sozialisation und erörtert verschiedene Theorien der Sozialisation, um einen theoretischen Rahmen für die Betrachtung der Selbstsozialisation zu schaffen. Kapitel 3 widmet sich dem Kern des Themas, der Selbstsozialisation, und erörtert die Bedeutung, Begriffsfassung und den historischen Kontext. Das Kapitel 4 fokussiert auf die Handlungstheorie und zeigt die Bedeutung von Eigenaktivität im Sozialisationsprozess auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Identität, Sozialisation, Selbstsozialisation, Fremdsozialisation, Handlungstheorie, Eigenaktivität, Selbststeuerung und Selbstorganisation. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Theorien, die sich mit diesen Begriffen befassen, und analysiert den Einfluss der Selbstsozialisation auf die Entwicklung des Individuums im Kontext der Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Selbstsozialisation?
Selbstsozialisation betont die Eigenaktivität und Selbststeuerung des Individuums im Prozess des Sozialwerdens, im Gegensatz zur reinen Einwirkung durch Erziehung (Fremdsozialisation).
Gibt es eine reine Selbst- oder Fremdsozialisation?
Nein, beide existieren nur als theoretische Konstrukte. Die Realität findet auf einem Kontinuum zwischen diesen beiden Polen statt, wobei soziokulturelle Kontexte das jeweilige Potenzial bestimmen.
Wie hängen Identität und Sozialisation zusammen?
Identität bildet sich im Prozess der Sozialisation heraus, indem der Mensch Reize verarbeitet und lernt, als sozial funktionierender Rollenträger in der Gesellschaft zu agieren.
Welche Rolle spielt die Handlungstheorie für dieses Konzept?
Die Handlungstheorie bildet die Grundlage, da sie den Menschen als aktives Subjekt betrachtet, das durch sein eigenes Handeln seine soziale Umwelt mitgestaltet und sich aneignet.
Was bedeutet "Empowerment" im pädagogischen Kontext?
Empowerment beschreibt Konzepte zur Förderung der Selbstwirksamkeit, bei denen die Eigenverantwortung und die Fähigkeit zur Selbsthilfe des Individuums gestärkt werden.
- Citar trabajo
- Maximilian Stangier (Autor), 2008, Aktive Aneignungsprozesse im Prozess der Sozialisation – Die Selbstsozialisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161443