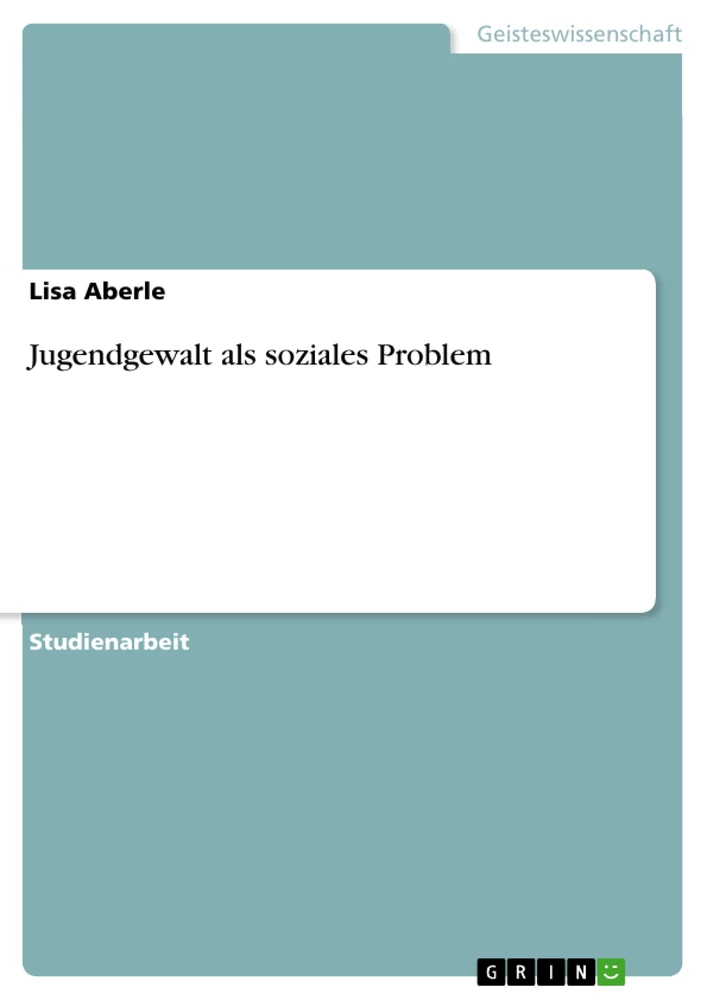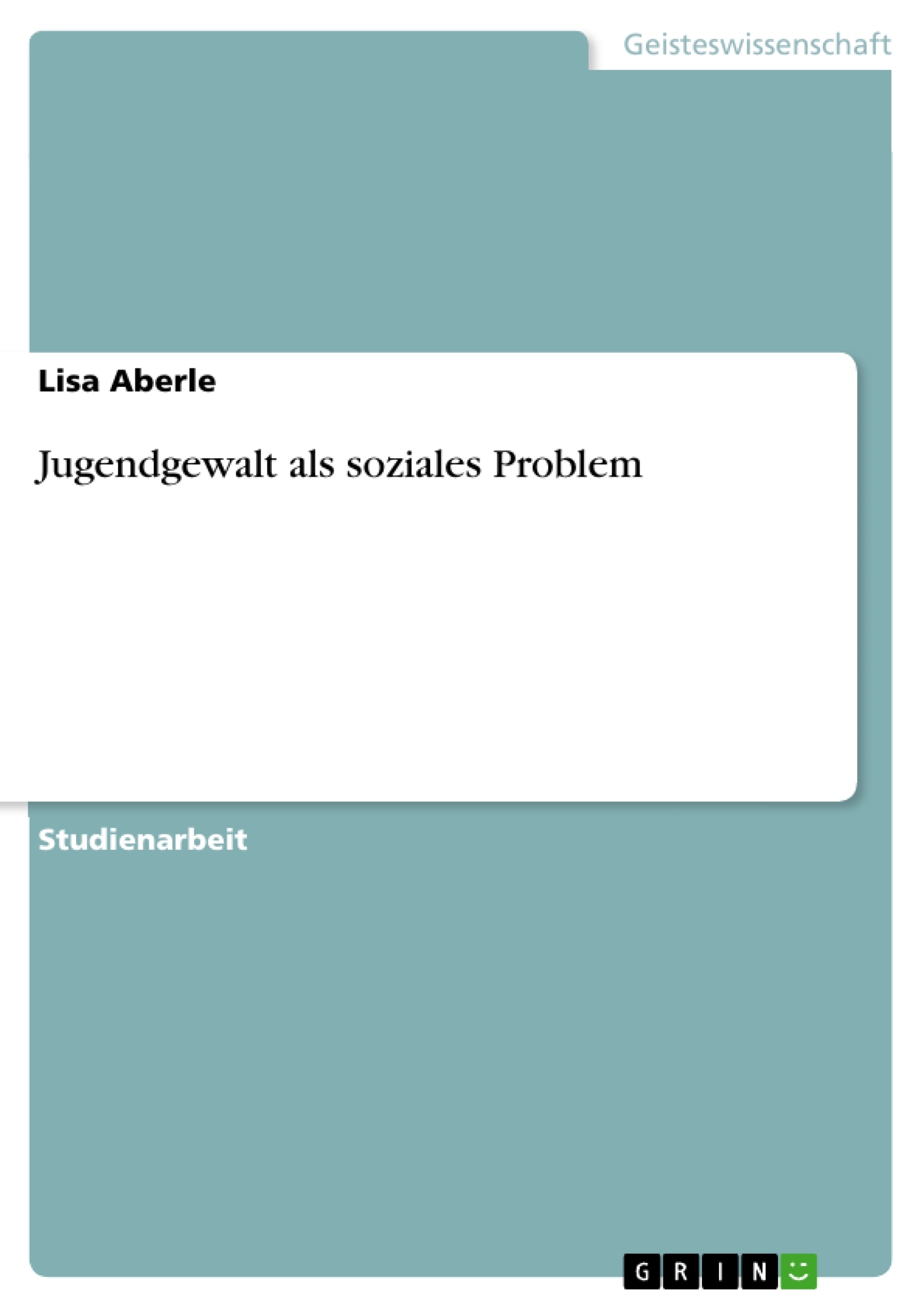Seit ein paar Jahren scheint es, als wäre Jugendgewalt zu einem Dauerbrenner im Internet, in den Zeitungen oder in Fernsehreportagen geworden. Man kommt nicht daran vorbei, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Im Mittelpunkt der Massenmedien stehen meist ungewöhnliche und spektakuläre Einzelfälle, die Eindruck vermitteln, dass die Brutalität der Jugend in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen hat und die TäterInnen immer jünger geworden sind. Die sozialen Ursachen von Jugendgewalt werden dabei häufig nicht beleuchtet und ebenso wenig veröffentlicht.
(...)
Der Fokus der vorliegenden Arbeit im Kontext der Diskussion über Problemjugendliche ist auf Jugendgewalt gerichtet. Antisoziales, gewalttätiges und aggressives Verhalten nimmt unter den umfassenden Kategorien von Problemverhalten im Jugendalter eine zentrale Bedeutung in den Medien ein, da die Sicherheit der Gesellschaft bedroht ist.
(...)
Im 2. Kapitel soll zunächst definiert werden, was unter den Begriffen ‚soziales Problem‘ (2.1) und ‚Gewalt‘ (2.2) – insbesondere der Jugendgewalt – verstanden wird. Welche Kriterien für die Definition einer Sache als ‚soziales Problem‘ existieren und welcher Gewaltbegriff im Rahmen dieser Studienarbeit für geeignet erscheint. Es folgt dann die explizite Darstellung der Jugendgewalt als soziales Problem (2.3).
In Kapitel 3 soll am Beispiel des Fall Brunners beschrieben werden, wie das Thema Jugend-gewalt, den öffentlichen Diskurs beherrscht. Zunächst soll die Diskrepanz zwischen Schein (3.1) und Realität (3.2) dieser Thematik herausgearbeitet werden, um dann in einem nächs-ten Schritt darzustellen, welche verschiedenen Akteure im öffentlichen Diskurs an dieser Diskrepanz interessiert bzw. nicht interessiert sind (3.3).
Im 4. Kapitel sollen die theoretischen Hintergründe zu Ursachen und Bedingungen von Ju-gendgewalt anhand des Labeling- Approach Ansatzes (4.1), ein soziologischen Erklärungs-ansatz für abweichendes Verhalten dargestellt werden, um dann konkret den Fall Brunner an Hand des Modells für abweichende Karriere nach Quensel (4.2) darzulegen.
In Kapitel 5 wird der Umgang mit dem Problem Jugendgewalt beleuchtet. Zunächst werden Interventionen auf Seiten der Justiz (Jugendstrafvollzug) kurz erläutert und bewertet (5.1), um dann im Bereich der Pädagogik die konfrontative Pädagogik mit ihrer speziellen Methode des Anti-Aggressivitäts-Training charakterisiert, um dann ebenfalls auf Möglichkeiten und Grenzen einzugehen (5.2).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definitionen
- 2.1 Was ist ein soziales Problem?
- 2.2 Was ist Gewalt? - Unter besonderer Berücksichtigung von Jugendgewalt
- 2.3 Jugendgewalt als soziales Problem
- 3 Jugendgewalt im öffentlichen Diskurs
- 3.1 Jugendgewalt im Spiegel der Medien
- 3.2 Exemplarisch am Fall Brunner
- 3.3 Die verschiedenen Akteure im öffentlichen Diskurs um Jugendgewalt
- 4 Theoretische Hintergründe zu Ursachen und Bedingungen von Jugendgewalt
- 4.1 Labeling-Approach als soziologischer Erklärungsansatz abweichenden Verhaltens
- 4.2 Modell für abweichende Karriere nach Quensel
- 5 Probleminterventionen zwischen Justiz und Pädagogik
- 5.1 Jugendgewalt und Justiz
- 5.1.1 Begriffsklärung und rechtliche Grundlagen
- 5.1.2 Jugendstrafe als Entwicklungsintervention
- 5.1.3 Möglichkeiten und Grenzen des Jugendstrafvollzugs
- 5.2 Jugendgewalt und Pädagogik
- 5.2.1 Die konfrontative Pädagogik
- 5.2.2 Das Anti-Aggressivitäts-Training
- 5.2.3 Möglichkeiten und Grenzen konfrontativer Pädagogik
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht Jugendgewalt als soziales Problem. Ziel ist es, die Definition von Jugendgewalt als soziales Problem zu klären, den öffentlichen Diskurs um dieses Thema zu analysieren und theoretische Erklärungsansätze sowie Interventionen der Justiz und Pädagogik zu beleuchten. Die Arbeit verzichtet auf eine abschließende Bewertung der Effektivität der Maßnahmen.
- Definition von Jugendgewalt als soziales Problem
- Der öffentliche Diskurs um Jugendgewalt und dessen Akteure
- Soziologische Erklärungsansätze für Jugendgewalt
- Interventionen der Justiz im Umgang mit Jugendgewalt
- Pädagogische Ansätze zur Gewaltprävention und -intervention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Jugendgewalt als ein gesellschaftliches Problem vor, das in den Medien stark präsent ist, aber oft ohne Berücksichtigung der sozialen Ursachen. Sie verweist auf die historische Perspektive des Umgangs mit "Problemjugendlichen" und betont die Bedeutung der Jugendgewalt als ein zentrales Problemverhalten in der Lebensphase Jugend, besonders im Hinblick auf Gewaltdelikte junger Männer. Die Arbeit fokussiert sich auf die Definition von Jugendgewalt als soziales Problem, den öffentlichen Diskurs, theoretische Erklärungsansätze und Interventionen der Justiz und Pädagogik.
2 Definitionen: Dieses Kapitel widmet sich der begrifflichen Klärung von "sozialem Problem" und "Gewalt", insbesondere Jugendgewalt. Es werden die Kriterien für die Definition eines sozialen Problems erörtert und ein geeigneter Gewaltbegriff für die vorliegende Arbeit festgelegt. Schließlich wird Jugendgewalt explizit als soziales Problem dargestellt, wobei die Komplexität des Begriffs "Problemjugendlicher" und die wechselseitige Beziehung zwischen Normalität und Abweichung hervorgehoben werden.
3 Jugendgewalt im öffentlichen Diskurs: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Jugendgewalt im öffentlichen Diskurs, insbesondere in den Medien. Es wird die Diskrepanz zwischen der medialen Wahrnehmung und der Realität thematisiert, wobei der Fall Brunner als Beispiel für die mediale Inszenierung von Jugendgewalt dient. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der verschiedenen Akteure im öffentlichen Diskurs und deren jeweiliges Interesse an dieser Thematik.
4 Theoretische Hintergründe zu Ursachen und Bedingungen von Jugendgewalt: Dieses Kapitel beleuchtet theoretische Erklärungsansätze für Jugendgewalt. Der Labeling-Approach wird als soziologischer Erklärungsansatz für abweichendes Verhalten vorgestellt und angewendet, gefolgt von einer detaillierten Betrachtung des Falles Brunner anhand des Modells für abweichende Karriere nach Quensel.
5 Probleminterventionen zwischen Justiz und Pädagogik: Der Umgang mit Jugendgewalt wird aus justiz- und pädagogischer Perspektive betrachtet. Der Jugendstrafvollzug als Intervention der Justiz wird kurz erläutert und bewertet, während im pädagogischen Bereich die konfrontative Pädagogik mit dem Anti-Aggressivitäts-Training im Detail dargestellt wird, einschließlich einer Betrachtung der Möglichkeiten und Grenzen beider Ansätze.
Schlüsselwörter
Jugendgewalt, soziales Problem, öffentlicher Diskurs, Medien, Labeling-Approach, abweichendes Verhalten, Jugendstrafvollzug, konfrontative Pädagogik, Anti-Aggressivitäts-Training, Fall Brunner.
Häufig gestellte Fragen zur Studienarbeit: Jugendgewalt als soziales Problem
Was ist der Gegenstand der Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht Jugendgewalt als soziales Problem. Sie beleuchtet die Definition von Jugendgewalt, analysiert den öffentlichen Diskurs, untersucht theoretische Erklärungsansätze und betrachtet Interventionen der Justiz und Pädagogik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition von Jugendgewalt als soziales Problem, den öffentlichen Diskurs um Jugendgewalt und dessen Akteure, soziologische Erklärungsansätze für Jugendgewalt (wie den Labeling-Approach), Interventionen der Justiz im Umgang mit Jugendgewalt (inkl. Jugendstrafvollzug), und pädagogische Ansätze zur Gewaltprävention und -intervention (wie konfrontative Pädagogik und Anti-Aggressivitäts-Training). Der Fall Brunner dient als exemplarisches Beispiel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Definitionen (soziales Problem, Gewalt, Jugendgewalt), Jugendgewalt im öffentlichen Diskurs (inkl. Medien und Fall Brunner), theoretische Hintergründe zu Ursachen und Bedingungen von Jugendgewalt (Labeling-Approach, Modell abweichende Karriere nach Quensel), Probleminterventionen zwischen Justiz und Pädagogik (Jugendstrafvollzug, konfrontative Pädagogik, Anti-Aggressivitäts-Training), und Fazit.
Welche Definitionen von Jugendgewalt und sozialen Problemen werden verwendet?
Die Arbeit klärt die Begriffe "soziales Problem" und "Gewalt", insbesondere Jugendgewalt. Es werden Kriterien für die Definition eines sozialen Problems erörtert und ein Gewaltbegriff für die Arbeit festgelegt. Jugendgewalt wird explizit als soziales Problem dargestellt, wobei die Komplexität des Begriffs "Problemjugendlicher" berücksichtigt wird.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Erklärung von Jugendgewalt herangezogen?
Die Arbeit verwendet den Labeling-Approach als soziologischen Erklärungsansatz für abweichendes Verhalten und das Modell für abweichende Karriere nach Quensel. Diese Ansätze werden zur Analyse der Ursachen und Bedingungen von Jugendgewalt herangezogen, exemplifiziert am Fall Brunner.
Welche Interventionen der Justiz und Pädagogik werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Jugendstrafvollzug als Intervention der Justiz und die konfrontative Pädagogik (inkl. Anti-Aggressivitäts-Training) als pädagogischen Ansatz. Die Möglichkeiten und Grenzen beider Ansätze werden diskutiert.
Welche Rolle spielen Medien im Kontext der Jugendgewalt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Jugendgewalt in den Medien und thematisiert die Diskrepanz zwischen medialer Wahrnehmung und Realität. Der Fall Brunner wird als Beispiel für die mediale Inszenierung von Jugendgewalt verwendet.
Welchen Schluss zieht die Arbeit?
Die Arbeit verzichtet auf eine abschließende Bewertung der Effektivität der Maßnahmen. Das Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Analyse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendgewalt, soziales Problem, öffentlicher Diskurs, Medien, Labeling-Approach, abweichendes Verhalten, Jugendstrafvollzug, konfrontative Pädagogik, Anti-Aggressivitäts-Training, Fall Brunner.
- Citation du texte
- Lisa Aberle (Auteur), 2010, Jugendgewalt als soziales Problem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161544