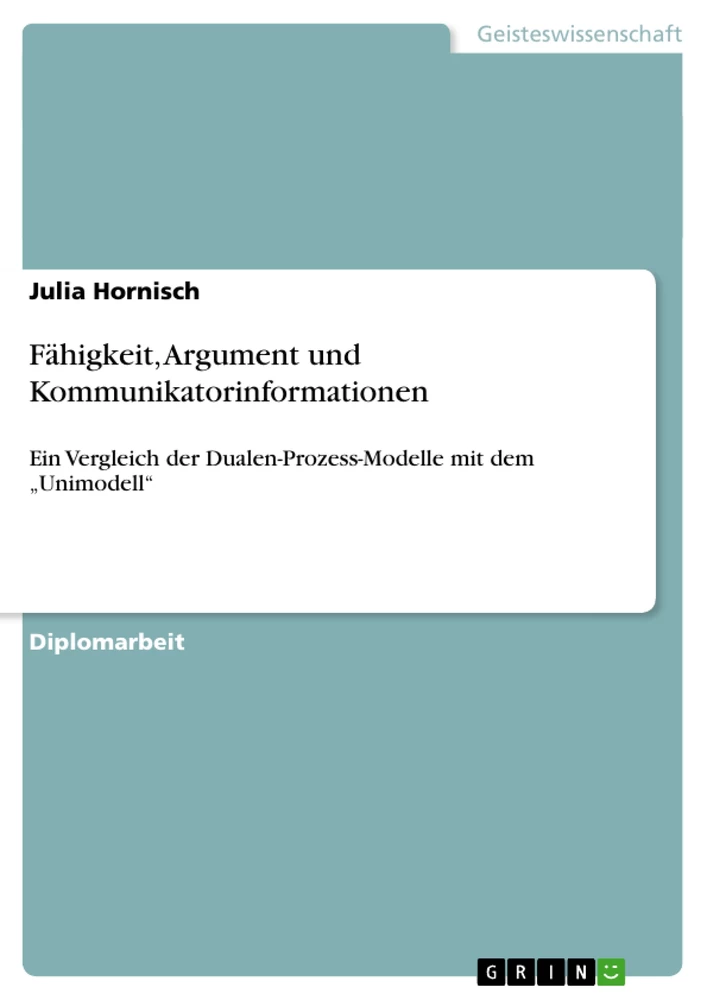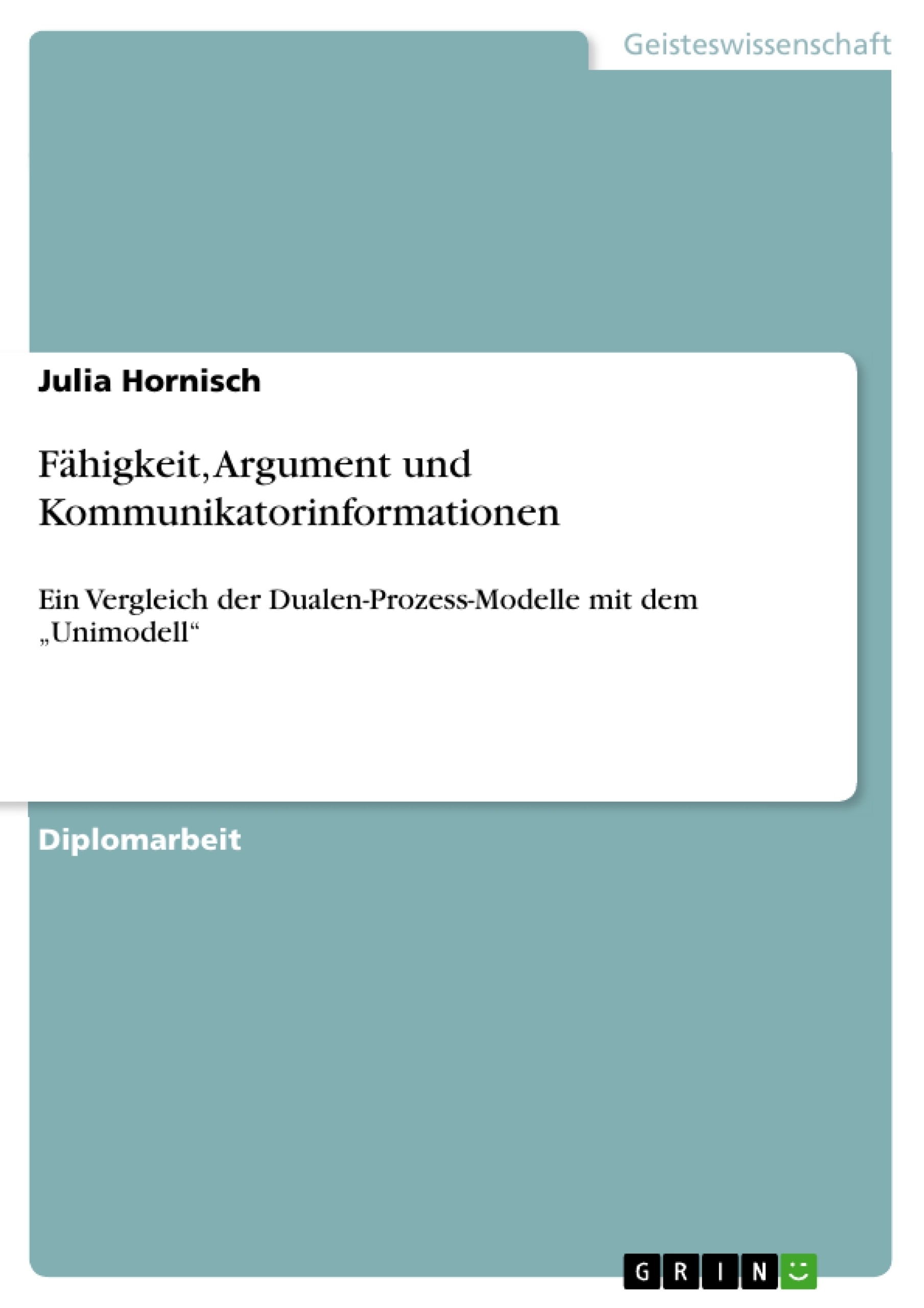Das Einstellungskonzept gehört zu den bedeutsamsten Konzepten der zeitgenössischen Sozialpsychologie. Wie ein roter Faden ziehen sich dabei vor allem die Dualen-Prozess-Modelle durch viele Ansätze zu diesem Thema. Diese Modelle nehmen an, dass neben der Verarbeitung von Überzeugungsbotschaft zusätzliche Randinformationen einen Einfluss auf die Einstellungsänderung haben können. In einem neueren Forschungsansatz wird die Notwendigkeit der Zweiteilung dieser Prozesse in Frage gestellt. Kruglanski et al. gehen in ihrem "Unimodell" davon aus, dass sowohl inhaltliche Argumente als auch periphere Hinweisreize funktional äquivalente Evidenzen darstellen, die über einen syllogistischen Schlussfolgerungsprozess zur Einstellungsänderung führen.
Die Autoren kritisieren, dass die Forschungsarbeiten zu den Dualen-Prozess-Modellen methodische Konfundierungen aufweisen, die sich als zwei unterschiedliche Verarbeitungsrouten interpretieren lassen.
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit: Die Reihenfolge, Länge, Anzahl und Komplexität der unabhängigen Variablen umzukehren und auf der Basis dieser Umkehrung die Dualen-Prozess-Modelle und den Ansatz des Unimodells zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- 1 Einstellungsdefinitionen
- 1.1 Theoretische Konzepte
- 1.2 Empirische Befunde
- 2 Entstehung und Veränderung von Einstellungen
- 2.1 Theoretische Konzepte
- 2.2 Empirische Befunde
- 3 Das Informationsverarbeitungsparadigma
- 3.1 Theoretische Konzepte
- 3.2 Empirische Befunde
- 4 Das Modell der kognitiven Reaktionen
- 4.1 Theoretische Konzepte
- 4.2 Empirische Befunde
- 5 Duale-Prozess-Modelle
- 5.1 Das Elaborationswahrscheinlichkeitsmodell
- 5.1.1 Theoretische Konzepte
- 5.1.2 Empirische Befunde
- 5.2 Das Heuristisch-Systematische Modell
- 5.2.1 Theoretische Konzepte
- 5.2.2 Empirische Befunde
- 5.1 Das Elaborationswahrscheinlichkeitsmodell
- 6 Das Unimodell
- 6.1 Theoretische Konzepte
- 6.2 Empirische Befunde
- 7 Grundlagen für die empirische Arbeit
- 7.1 Die Untersuchung von Petty, Cacioppo & Goldman (1981)
- 7.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1 Einstellungsdefinitionen
- Empirischer Teil
- 1 Hypothesen
- 2 Methoden
- 2.1 Wahl des Untersuchungsthemas
- 2.2 Voruntersuchung
- 2.3 Hauptuntersuchung
- 2.3.1 Stichprobe
- 2.3.2 Design
- 2.3.3 Ablauf
- 2.3.4 Untersuchungsmaterial
- 2.3.5 Operationalisierung der unabhängigen Variablen
- 2.3.6 Operationalisierung der abhängigen Variablen
- 3 Ergebnisse
- 3.1.1 Fähigkeit
- 3.1. Manipulationschecks
- 3.1.2 Qualität des Arguments
- 3.1.3 Expertise des Kommunikators
- 3.1.4 Glaubwürdigkeit des Kommunikators
- 3.1.5 Konsens
- 3.2 Einstellungen
- 3.3 Kognitive Reaktionen
- 3.4 Explorative Analysen
- 3.4.1 Einstellungen und Need for Cognition
- 3.4.2 Einstellungen und Relevanz des Themas ,,Medikament gegen Kopfschmerzen“
- 3.5 Korrelative Analysen
- 3.6 Urteilsicherheit
- Diskussion
- 1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 2 Die Perspektive der Dualen-Prozess-Modelle
- 3 Implikationen für den Unimodell-Ansatz
- 4 Fazit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Fähigkeit, Argument und Kommunikatorinformationen zu verarbeiten, die Einstellungsbildung beeinflusst. Die Arbeit analysiert und vergleicht verschiedene Modelle der Einstellungsbildung, insbesondere duale-Prozess-Modelle und das Unimodell. Die zentralen Themen und Schwerpunkte der Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen:- Definition und Konzepte von Einstellungen
- Entstehung und Veränderung von Einstellungen
- Das Informationsverarbeitungsparadigma
- Duale-Prozess-Modelle der Einstellungsbildung
- Das Unimodell der Einstellungsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage dar. Im theoretischen Teil werden zunächst verschiedene Definitionen und Konzepte von Einstellungen erläutert, bevor die Entstehung und Veränderung von Einstellungen näher betrachtet werden. Anschließend wird das Informationsverarbeitungsparadigma vorgestellt, das als Grundlage für die Analyse der Modelle der Einstellungsbildung dient. In diesem Abschnitt werden verschiedene Modelle, wie das Modell der kognitiven Reaktionen und duale-Prozess-Modelle, wie das Elaborationswahrscheinlichkeitsmodell und das Heuristisch-Systematische Modell, ausführlich beschrieben. Der theoretische Teil schließt mit der Darstellung des Unimodells ab. Der empirische Teil beinhaltet die Darstellung der Hypothesen und Methoden der Untersuchung. Hier wird die Stichprobe, das Design, der Ablauf und das Untersuchungsmaterial der Studie detailliert beschrieben. Die Ergebnisse der Untersuchung werden anschließend präsentiert, wobei die Effekte der unabhängigen Variablen (Fähigkeit, Argumentqualität, Kommunikatorexpertise, Kommunikatorglaubwürdigkeit und Konsens) auf die Einstellungen der Probanden analysiert werden. Der Diskussionsteil fasst die Ergebnisse der Studie zusammen und setzt diese in Bezug zu den theoretischen Modellen der Einstellungsbildung. Es wird erörtert, welche Implikationen die Ergebnisse für die verschiedenen Modelle haben, insbesondere für das Unimodell.Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Einstellungsforschung, darunter Einstellungen, Einstellungsbildung, Informationsverarbeitung, duale-Prozess-Modelle, das Unimodell, Argumentation, Kommunikatorinformationen, Fähigkeit und Empirische Befunde.Häufig gestellte Fragen
Was sind Duale-Prozess-Modelle in der Sozialpsychologie?
Diese Modelle (wie ELM oder HSM) nehmen an, dass Einstellungsänderungen entweder über eine zentrale Route (inhaltliche Argumente) oder eine periphere Route (Randreize) erfolgen.
Was unterscheidet das Unimodell von den Dualen-Prozess-Modellen?
Das Unimodell von Kruglanski geht davon aus, dass es nur einen funktionalen Prozess gibt: Sowohl Argumente als auch Hinweisreize sind Evidenzen, die über syllogistische Schlüsse verarbeitet werden.
Welche Rolle spielt die Expertise des Kommunikators?
Sie wird oft als peripherer Hinweisreiz betrachtet, kann aber laut Unimodell als vollwertige Information in den Entscheidungsprozess einfließen.
Was bedeutet "Need for Cognition" in diesem Kontext?
Es beschreibt die individuelle Neigung einer Person, Freude an anstrengenden kognitiven Tätigkeiten zu haben, was die Art der Informationsverarbeitung beeinflusst.
Was war das Ziel der empirischen Untersuchung in dieser Arbeit?
Durch die Umkehrung von Reihenfolge und Komplexität der Variablen wurde geprüft, ob die Annahmen der Dualen-Prozess-Modelle oder des Unimodells die Einstellungsänderung besser erklären.
- Citation du texte
- Julia Hornisch (Auteur), 2004, Fähigkeit, Argument und Kommunikatorinformationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161550