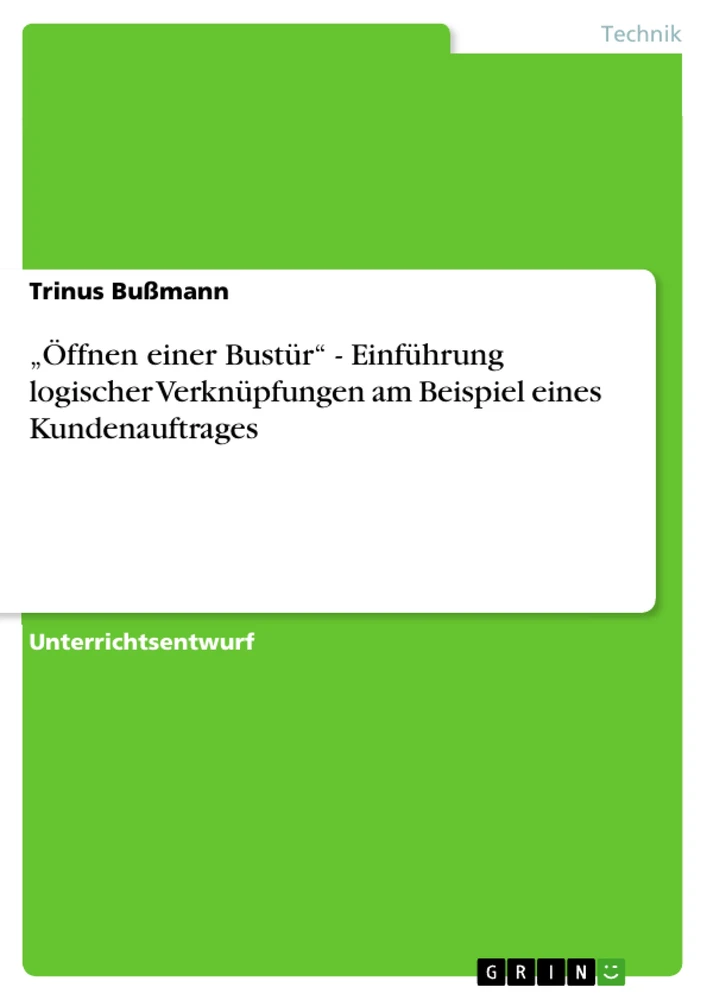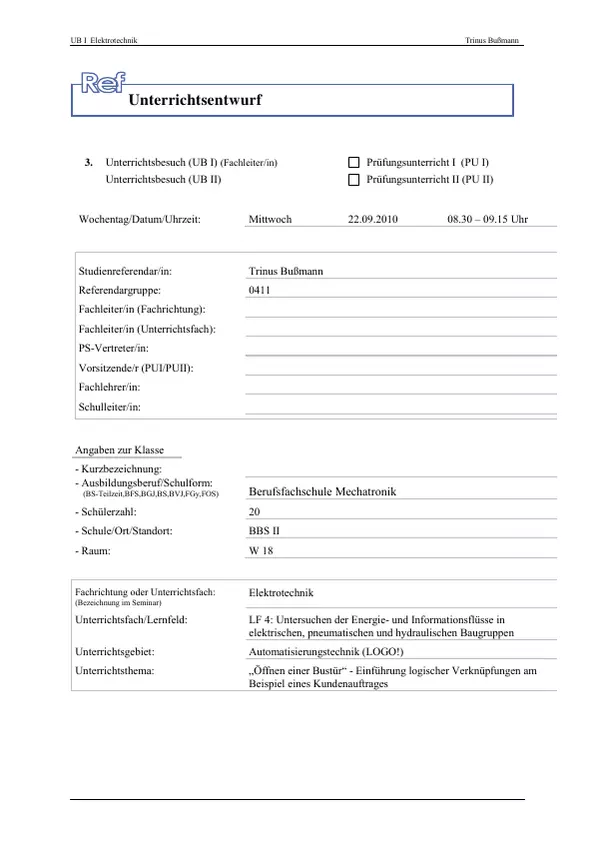Die BFEMA 11 ist eine geteilte Klasse. Elf Schülerinnen und Schüler absolvieren eine einjährige Vollzeitschulform Berufsfachschule Mechatronik. Die Berufsfachstufe vermittelt eine theoretisch-fachliche und allgemeine Ausbildung. Zudem wird eine praktische Ausbildung von 160 Zeitstunden durchgeführt.
Mit dem erworbenen Abschluss ist der Eintritt in die Fachstufe einer Berufsausbildung möglich. Der erweiterte Sekundarabschluss I kann mit einem bestimmten Gesamtnotendurchschnitt erworben werden.1
Neun Schüler absolvieren die Berufsschule Mechatronik in Teilzeitform. Sie sind zwei Tage die Woche in der Berufsschule und drei Tage im Betrieb.
An der heutigen Stunde nehmen die elf Schülerinnen und Schüler der Vollzeitschulform teil, da die anderen Schüler im Ausbildungsbetrieb sind. Aus diesem Grunde nehme ich auch nur zu diesen Schülerinnen und Schüler Bezug.
Der heutige Teil der Klasse besteht aus sechs Schülerinnen und fünf Schüler2. Die Altersstruktur ist als heterogen zu bezeichnen. Dies spiegelt sich auch im Leistungsvermögen der Schüler wieder (vgl. Anlage VI).
Schüler wie z.B. x, x und x verfolgen den Unterricht aufmerksam und hinterfragen Themenabschnitte. Sie weisen eine Vielzahl von guten Wortbeiträgen auf und treiben die Gruppenarbeiten, sowie das Gruppenpuzzle voran. Andere Schüler wie z.B. x, x und x beteiligen sich kaum eigeninitiativ am Unterricht. x ist in die Klasse gewechselt und muss sich erst noch einfinden. Sie wird aber von den Mitschülern unterstützt.
Die geringe Klassenstärke ermöglicht eine gute Beobachtung und Betreuung der einzelnen Schüler.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Analyse des Bedingungsfeldes
- 1.1 Angaben zur Lerngruppe
- 1.2 Kompetenzen der Lerngruppe
- 1.3 Der Referendar
- 1.4 Organisatorische Rahmenbedingungen
- 2 Didaktisch-methodische Konzeption
- 2.1 Didaktische Überlegungen
- 2.1.1 Analyse der curricularen Vorgaben
- 2.2 Methodische Konzeption
- 2.2.1 Makrostruktur
- 2.2.2 Mikrostruktur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, den Schülern der Berufsfachschule Mechatronik die Grundlagen logischer Verknüpfungen im Kontext der Automatisierungstechnik (LOGO!) zu vermitteln. Dies geschieht anhand eines praxisnahen Beispiels: dem Öffnen einer Bustür. Der Fokus liegt auf der Anwendung des erworbenen Wissens in einer Gruppenarbeitssituation.
- Einführung in logische Verknüpfungen
- Anwendung der LOGO!-Software
- Lösungsfindung in Gruppenarbeit
- Praxisbezug durch Kundenauftrag
- Förderung von Methodenkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
1 Analyse des Bedingungsfeldes: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Lerngruppe (BFEMA11), bestehend aus elf Vollzeit- und neun Teilzeit-Schülern. Es analysiert die heterogene Leistungsstruktur der Schüler, die vorhandenen fachlichen und methodischen Kompetenzen, sowie die soziale Dynamik innerhalb der Klasse. Die Beschreibung des Referendars und der organisatorischen Rahmenbedingungen (Raum, Ausstattung) rundet den Überblick ab und liefert wichtige Kontextinformationen für den Verständnis des anschließenden Unterrichtsverlaufs. Der Fokus liegt auf dem heterogenen Leistungsniveau der Schüler und den damit verbundenen didaktischen Herausforderungen.
2 Didaktisch-methodische Konzeption: Dieses Kapitel legt die didaktische und methodische Grundlage des Unterrichts dar. Die didaktischen Überlegungen verorten den Unterricht im Rahmenlehrplan und begründen die Wahl des Themas „Öffnen einer Bustür“. Die methodische Konzeption beschreibt die Makro- und Mikrostruktur des Unterrichts, wobei die Gruppenarbeit im Zentrum steht. Es wird detailliert auf die einzelnen Phasen des Gruppenpuzzles eingegangen, die Wahl der Methoden (Kundenauftrag, Spielkarten zur Gruppeneinteilung) wird begründet und alternative Vorgehensweisen werden erwogen. Der Fokus liegt auf der Begründung der gewählten didaktischen und methodischen Entscheidungen im Kontext der Lerngruppe und des Lehrplans.
Schlüsselwörter
Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, LOGO!, Logische Verknüpfungen, Gruppenpuzzle, Kundenauftrag, Berufsfachschule Mechatronik, Didaktik, Methodik, Gruppenarbeit, Kompetenzentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf: Berufsfachschule Mechatronik
Was ist der Gegenstand dieses Unterrichtsentwurfs?
Der Unterrichtsentwurf beschreibt eine Unterrichtsstunde für Schüler der Berufsfachschule Mechatronik zum Thema "Logische Verknüpfungen" im Kontext der Automatisierungstechnik, veranschaulicht am Beispiel des Öffnens einer Bustür. Der Fokus liegt auf der Anwendung des Wissens in Gruppenarbeit.
Welche Themen werden behandelt?
Der Entwurf behandelt die Einführung in logische Verknüpfungen, die Anwendung der LOGO!-Software, Lösungsfindung in Gruppenarbeit, Praxisbezug durch einen Kundenauftrag und die Förderung der Methodenkompetenz der Schüler.
Wie ist der Entwurf strukturiert?
Der Entwurf gliedert sich in zwei Hauptkapitel: "Analyse des Bedingungsfeldes" und "Didaktisch-methodische Konzeption". Das erste Kapitel beschreibt die Lerngruppe, deren Kompetenzen, den Referendar und die organisatorischen Rahmenbedingungen. Das zweite Kapitel erläutert die didaktischen und methodischen Überlegungen, die Makro- und Mikrostruktur des Unterrichts, insbesondere die Gruppenarbeit (Gruppenpuzzle) und die Begründung der gewählten Methoden.
Welche Lerngruppe wird adressiert?
Der Entwurf richtet sich an eine heterogene Lerngruppe der Berufsfachschule Mechatronik (BFEMA11), bestehend aus elf Vollzeit- und neun Teilzeit-Schülern mit unterschiedlichen Leistungsniveaus.
Welche Methode wird im Unterricht eingesetzt?
Die zentrale Methode ist die Gruppenarbeit in Form eines Gruppenpuzzles. Zusätzlich werden ein Kundenauftrag und Spielkarten zur Gruppeneinteilung eingesetzt. Die Wahl der Methoden wird im Entwurf detailliert begründet und alternative Vorgehensweisen werden erwogen.
Welche Software wird verwendet?
Die Software LOGO! wird im Unterricht zur Veranschaulichung der logischen Verknüpfungen eingesetzt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Entwurf?
Schlüsselwörter sind: Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, LOGO!, Logische Verknüpfungen, Gruppenpuzzle, Kundenauftrag, Berufsfachschule Mechatronik, Didaktik, Methodik, Gruppenarbeit, Kompetenzentwicklung.
Welche didaktischen Überlegungen liegen dem Entwurf zugrunde?
Die didaktischen Überlegungen verorten den Unterricht im Rahmenlehrplan und begründen die Wahl des Themas "Öffnen einer Bustür" als praxisnahes Beispiel. Besonderes Augenmerk liegt auf der Berücksichtigung des heterogenen Leistungsniveaus der Schüler.
Wie ist die methodische Konzeption aufgebaut?
Die methodische Konzeption beschreibt detailliert die Makro- und Mikrostruktur des Unterrichts, einschließlich der einzelnen Phasen des Gruppenpuzzles und der Begründung der gewählten Methoden.
Wo liegt der Fokus des Entwurfs?
Der Fokus liegt auf der Begründung der gewählten didaktischen und methodischen Entscheidungen im Kontext der Lerngruppe, des Lehrplans und der erfolgreichen Vermittlung der logischen Verknüpfungen durch praxisnahe Anwendung und Gruppenarbeit.
- Quote paper
- Dipl. Ing, Master of Education Trinus Bußmann (Author), 2010, „Öffnen einer Bustür“ - Einführung logischer Verknüpfungen am Beispiel eines Kundenauftrages, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161567