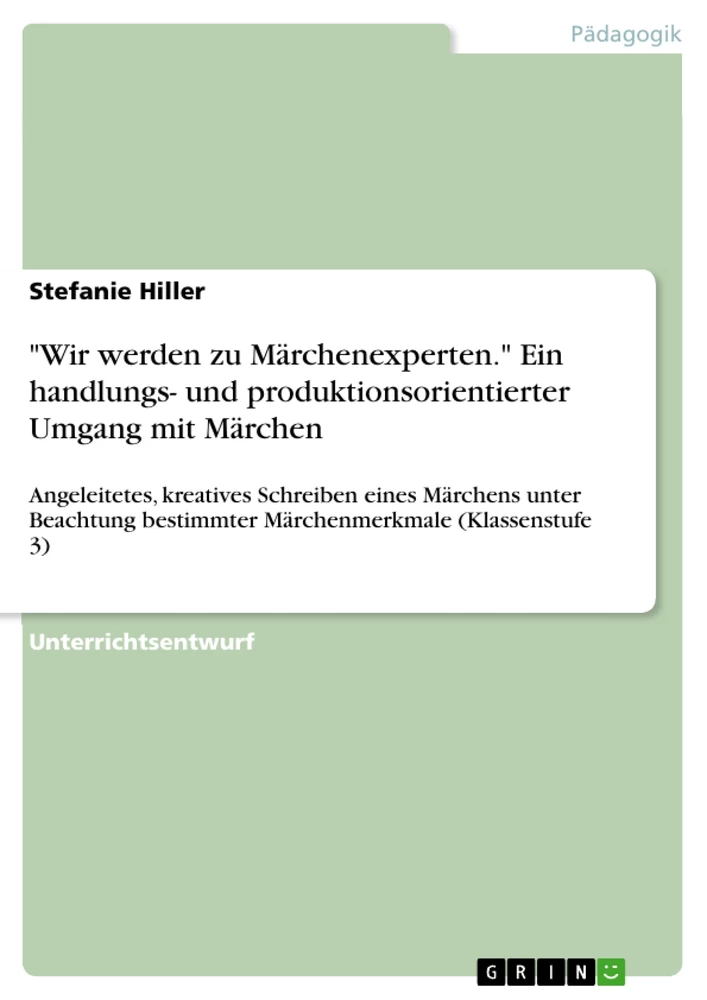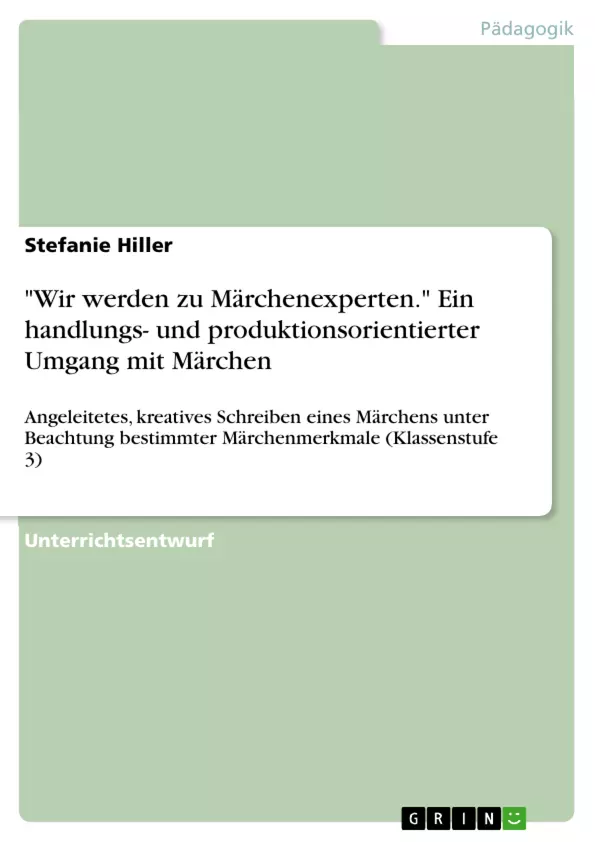Ein handlungs- und produktionsorientierter Umgang mit Märchen durch Lesen, Vorlesen und Schreiben von Märchen sowie der Auseinandersetzung mit typischen Märchenmerkmalen, damit das sinnentnehmende sowie literarische Lesen gefördert wird, das kreative Schreiben anhand von Märchenkriterien geübt wird und das Wissen über Märchen erweitert bzw. erworben wird.
Angeleitetes, kreatives Schreiben eines Märchens unter Beachtung bestimmter Märchenmerkmale, indem die Schülerinnen und Schüler das zuvor erarbeitete Märchenrezept weiter mit „Zutaten“ ausfüllen und das Märchen mit Hilfe des Rezeptes aufschreiben damit die Schreibkompetenz und Fantasie gefördert werden sowie die Märchenkriterien eigenständig angewandt und vertieft werden.
Inhaltsverzeichnis
- Aufbau der Reihe
- 1. Einheit: „Was wissen wir über Märchen?“
- 2. Einheit: „Unsere Märchenbuchausstellung“
- 3. Einheit: „Wir erstellen einen Steckbrief zu einer bekannten Märchenfigur.“
- 4. Einheit: „Wir nehmen das Märchen ganz genau unter die Lupe.“
- 5. Einheit: „Wir erstellen ein Märchenrezept.“
- 6. Einheit: „Wir schreiben ein Rezept für ein bekanntes Märchen.“
- 7. Einheit: „Wir schreiben unser eigenes Märchen mit Hilfe eines Märchenrezeptes.“
- 8. Einheit: „Wir arbeiten mit der Textlupe.“
- 9. Einheit: „Wer waren eigentlich die Gebrüder Grimm, Hans Christian Andersen, Willhelm Hauff und Ludwig Bechstein?“
- 10. Einheit: „Wir sind Märchenexperten und erstellen ein Märchenquiz für die Schülerzeitung.“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Reihe verfolgt das Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit der Gattung Märchen vertraut zu machen und sie zu befähigen, Märchentexte selbstständig zu lesen, zu verstehen und kreativ zu verfassen. Im Fokus der Reihe steht ein handlungs- und produktionsorientierter Umgang mit Märchen, der sowohl das sinnentnehmende als auch das literarische Lesen fördert.
- Vertiefung des Wissens über Märchen und deren Merkmale
- Förderung der Kreativität und Fantasie
- Entwicklung der Schreibkompetenz
- Vermittlung von Schreibstrategien und Überarbeitungstechniken
- Steigerung der Lesemotivation
Zusammenfassung der Kapitel
Die erste Einheit dient als Einstieg in die Reihe und soll die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu Märchen ermitteln. In der zweiten Einheit lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Märchen aus unterschiedlichen Quellen kennen, um ihren Wissensstand zu erweitern. Die dritte Einheit beschäftigt sich mit der Analyse von Märchenfiguren, wobei die Schülerinnen und Schüler einen Steckbrief zu einer bekannten Märchenfigur erstellen. In der vierten Einheit werden die Schülerinnen und Schüler mit den typischen Merkmalen von Märchen vertraut gemacht, indem sie verschiedene Märchen nach diesen Kriterien untersuchen. Die fünfte Einheit fokussiert auf die Erstellung eines Märchenrezeptes, welches den Aufbau und die Merkmale von Märchen vertieft. In der sechsten Einheit üben die Schülerinnen und Schüler die Anwendung des Märchenrezeptes anhand eines bekannten Märchens. Die siebte Einheit bildet den Höhepunkt der Reihe, in der die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Märchen mit Hilfe des Märchenrezeptes schreiben. In der achten Einheit verbessern die Schülerinnen und Schüler ihre Texte im Rahmen einer schriftlichen Revision.
Schlüsselwörter
Märchen, Märchenmerkmale, Erzählgattung, Kreativität, Schreibkompetenz, Lesemotivation, Textverständnis, Textproduktion, Überarbeitung, Märchenrezept, Gebrüder Grimm, Hans Christian Andersen, Willhelm Hauff, Ludwig Bechstein.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Märchenrezept"?
Ein Märchenrezept ist eine strukturierte Anleitung, die typische Merkmale und den Aufbau von Märchen zusammenfasst, um Schülern beim eigenen Verfassen zu helfen.
Welche Ziele verfolgt der produktionsorientierte Umgang mit Märchen?
Ziel ist die Förderung der Schreibkompetenz, der Fantasie sowie des sinnentnehmenden und literarischen Lesens.
Welche Märchenautoren werden im Unterricht behandelt?
Behandelt werden unter anderem die Gebrüder Grimm, Hans Christian Andersen, Wilhelm Hauff und Ludwig Bechstein.
Was ist eine "Textlupe"?
Die Textlupe ist eine Methode zur kooperativen Überarbeitung von Texten, bei der Schüler sich gegenseitig Rückmeldungen zu ihren Märchen geben.
Wie wird das Wissen über Märchenmerkmale vertieft?
Durch das Erstellen von Steckbriefen zu Märchenfiguren und die Analyse bekannter Texte auf typische "Zutaten" wie Magie oder Gut-Böse-Kontraste.
- Citation du texte
- Stefanie Hiller (Auteur), 2009, "Wir werden zu Märchenexperten." Ein handlungs- und produktionsorientierter Umgang mit Märchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161650