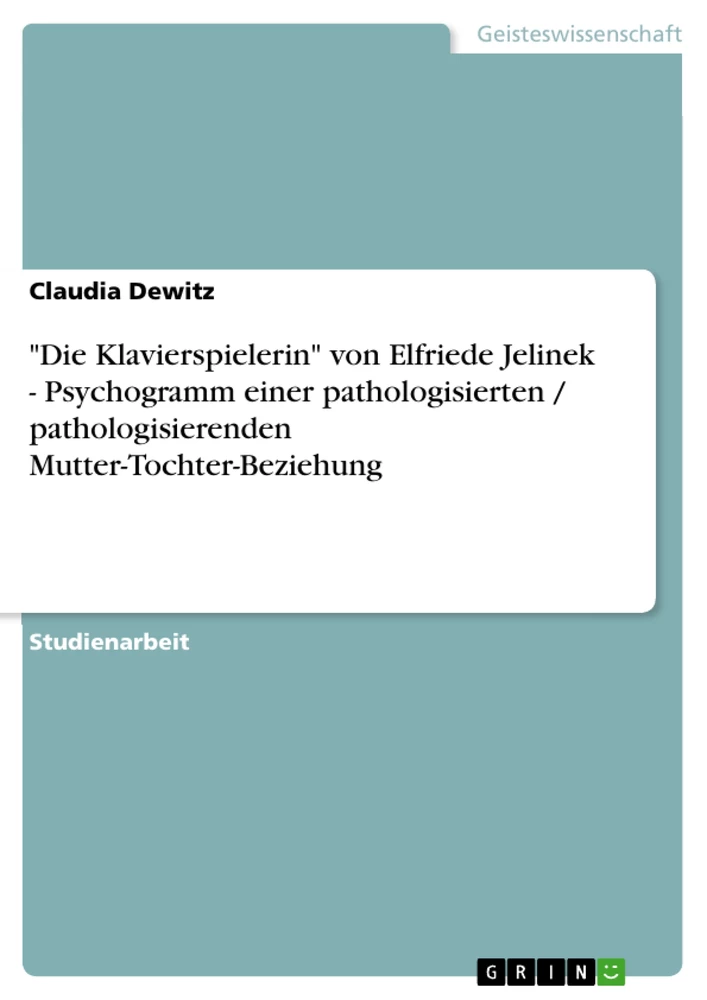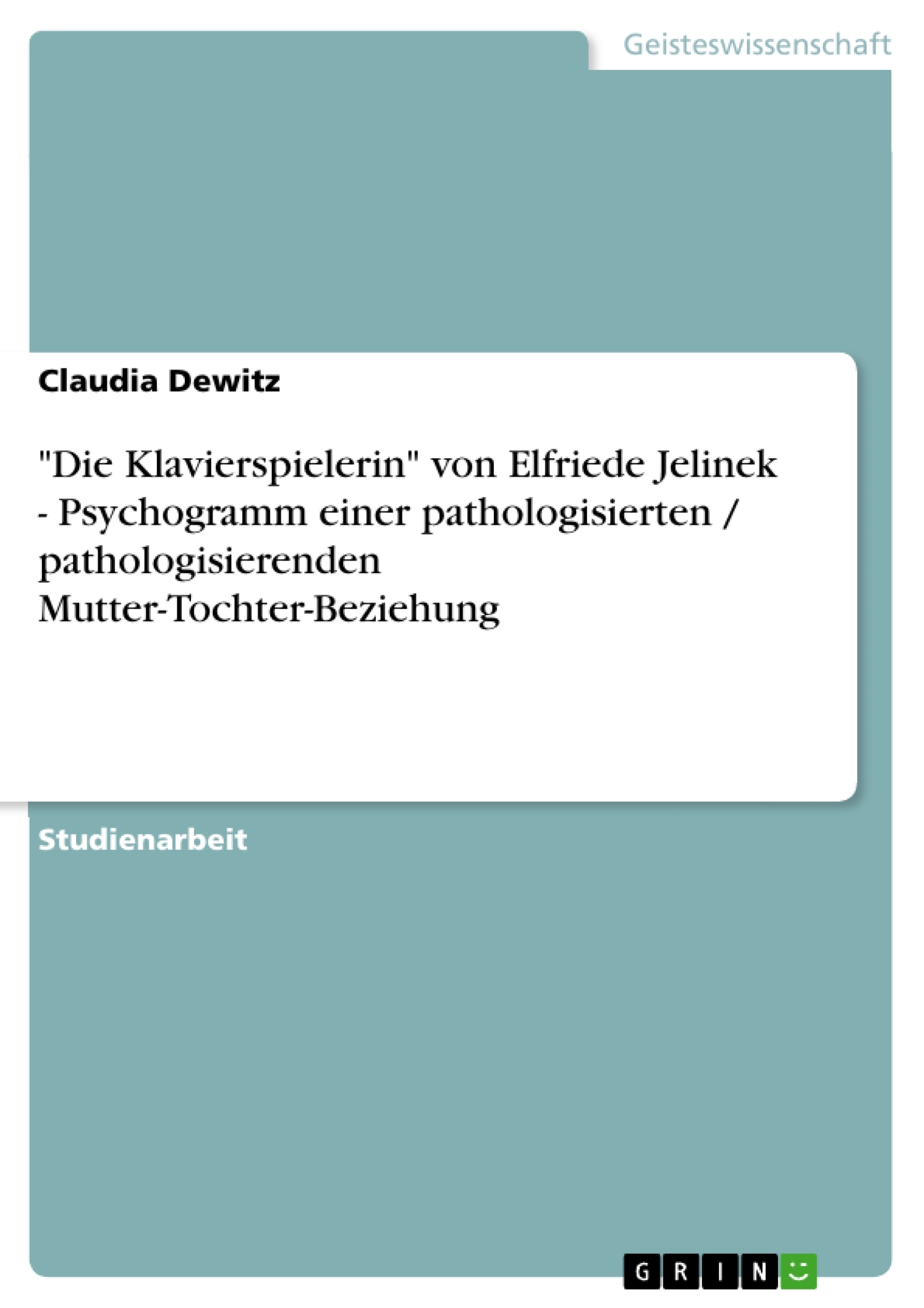Im Folgenden soll es um die Mutter-Tochter-Beziehung in Elfriede Jelineks autobiografisch gefärbtem Roman oder - wie sie es nannte - eingeschränkter Biografie Die Klavierspielerin gehen. Die Vater-Mutter-Kind-Szene ist defekt und wird ersetzt durch eine pathologisierte Mutter-Tochter-Beziehung. Thematisiert wird zudem die schwierige Verbindung zwischen der Klavierlehrerin Erika Kohut und ihrem Schüler Walter Klemmer – diese soll in hier allerdings nur am Rande von Interesse sein und nur im Hinblick auf Disfunktionalitäten, die sich aus der Beziehung zur Mutter Kohut ergeben, herangezogen werden.
Mutterschaft ist ein als kulturelles Konstrukt, das mit vielen Idealen und Mythen behaftet ist. Die Liebe zwischen Mutter und Kind gilt – dem Klischee folgend – als rein und bedingungslos. Die Mutter sorgt und umhegt ihr Kind uneigennützig, mit dem Ziel, ein kompetentes erwachsenes Kind in die Welt zu entlassen. Jedoch wie so häufig haben Idealvorstellung und gelebte Realität selten etwas gemein. „Der Text legt seine innere Dialektik offen: Ein feststehendes kulturelles Ideal steht gegen die hartnäckige Materialität des Lebens.“ Es gibt kein Schema F für Mutterschaft, denn Frauen an sich sind keine homogene Gruppe. Jede von ihnen hat eigene Erfahrungen gemacht und ist einen eigenen Individuationsprozess durchlaufen. Auch sind die Gründe für Schwangerschaft und Mutterschaft mannigfaltig verschieden. Nicht jede Frau sieht in der Geburt ihres Kindes die vollkommene Erfüllung ihrer selbst und nicht jede Frau sieht ihr Kind als einzigen Lebensinhalt. Im Falle von Erika Kohut und ihrer Mutter scheint es oberflächlich betrachtet so, als wäre die Mutter-Tochter-Beziehung eng. Da die Leserschaft jedoch von der Autorin gleich am Anfang des Romans vor Augen geführt wird, dass das Ideal der Mutterschaft nur zur Institutionalisierung mütterlicher Macht und der Erhaltung des Dependenzverhältnisses der Tochter zur Mutter herangezogen, ist es evident, dass Mutter und Tochter aneinander kleben und sich nicht lösen können und/oder wollen.
Ich möchte zeigen, dass Erika durch die Erziehung ihrer Mutter zu einem sozial inkompetenten Wesen herangezogen wird und ferner die Beziehung zwischen Mutter und Tochter generell als krankhaft dargestellt wird. „Die Mutter hat Erika schließlich zu dem gemacht, was sie jetzt ist.“ (K17)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erika Kohut - eine Tochter wird besessen...
- Kindheit und Jugend..
- Das Erwachsensein - wer oder was bin ich?
- Beziehungsunfähigkeit und Gefühlskälte..
- Die Mutter.
- Die Rolle ihres Lebens
- Mutter Kohut als Ehefrau.
- Identität: Mutterschaft..
- Zwei Damen gegen den Rest der Welt
- Reziproke Evokation – Eins bedingt das Andere...
- Der Mutterleib als letzte Zuflucht
- Bis das der Tod sie scheidet.
- Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Mutter-Tochter-Beziehung im Roman „Die Klavierspielerin“ von Elfriede Jelinek. Er untersucht die pathologische Dynamik dieser Beziehung und beleuchtet, wie die Mutter die Tochter durch ihre Erziehung zu einem sozial inkompetenten Wesen formt.
- Die Darstellung von Mutterschaft als kulturelles Konstrukt und die damit verbundenen Ideale und Mythen
- Die Analyse der toxischen Beziehung zwischen Erika Kohut und ihrer Mutter
- Die Auswirkungen der mütterlichen Kontrolle auf Erikas Entwicklung und ihre Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen
- Die Rolle der Musik im Leben Erikas und die symbolische Bedeutung des Klavierspielens
- Die Erforschung der sozialen und kulturellen Kontexte, die die Beziehung zwischen Mutter und Tochter beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Textes ein und beleuchtet die kulturelle Konstruktion von Mutterschaft. Die Autorin analysiert die Beziehung zwischen Erika und ihrer Mutter in Bezug auf das Idealbild der Mutterschaft und stellt die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität heraus.
Im zweiten Kapitel wird Erikas Kindheit und Jugend beleuchtet, wobei die Darstellung der Mutter als dominierende und kontrollierende Figur im Mittelpunkt steht. Die Autorin schildert, wie Erikas Leben von der Mutter durch Zwang und Kontrolle bestimmt wird und wie diese Eingriffe in Erikas Entwicklung zu einer sozial inkompetenten Persönlichkeit führen.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Erikas Erwachsenwerden und ihrer gescheiterten Beziehung zu Walter Klemmer. Die Autorin analysiert, wie die Beziehung zu ihrer Mutter Erikas Fähigkeit zur emotionalen Bindung und zu selbstständiger Lebensführung beeinträchtigt.
Kapitel vier untersucht die reziproke Evokation zwischen Mutter und Tochter. Es wird gezeigt, wie die beiden Figuren einander prägen und beeinflussen. Die Autorin stellt die ambivalente Beziehung zwischen Mutter und Tochter heraus und untersucht, wie die Tochter in den Fängen der Mutter gefangen ist.
Schlüsselwörter
Mutterschaft, Mutter-Tochter-Beziehung, pathologische Beziehung, kulturelles Konstrukt, soziale Kompetenz, Kontrolle, Dominanz, Identität, Musik, Klavierspielen, Elfriede Jelinek, „Die Klavierspielerin“
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Elfriede Jelineks „Die Klavierspielerin“?
Der Roman thematisiert die pathologische Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Erika Kohut und ihrer Mutter sowie die daraus resultierenden psychischen Störungen und Beziehungsunfähigkeiten.
Warum wird die Mutter-Tochter-Beziehung als „krankhaft“ beschrieben?
Die Beziehung ist durch extreme Kontrolle, emotionale Kälte und eine krankhafte Abhängigkeit (Dependenzverhältnis) geprägt, die Erikas Entwicklung zu einer eigenständigen Person verhindert.
Welche Rolle spielt die Musik im Leben von Erika Kohut?
Musik ist für Erika ein Instrument des mütterlichen Drills und der Disziplinierung, aber auch ein Raum, in dem sich ihre soziale Inkompetenz und ihre unterdrückten Emotionen widerspiegeln.
Was kritisiert Jelinek am kulturellen Konstrukt der Mutterschaft?
Sie demaskiert das Ideal der bedingungslosen Mutterliebe als Mythos, der oft zur Institutionalisierung mütterlicher Macht und zur Unterdrückung der Individualität des Kindes genutzt wird.
Was ist mit „reziproker Evokation“ in diesem Kontext gemeint?
Es beschreibt das wechselseitige Bedingen von Mutter und Tochter: Das Verhalten der einen provoziert und verstärkt das Verhalten der anderen, wodurch sie in einem destruktiven Kreislauf gefangen bleiben.
- Quote paper
- Claudia Dewitz (Author), 2009, "Die Klavierspielerin" von Elfriede Jelinek - Psychogramm einer pathologisierten / pathologisierenden Mutter-Tochter-Beziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161696