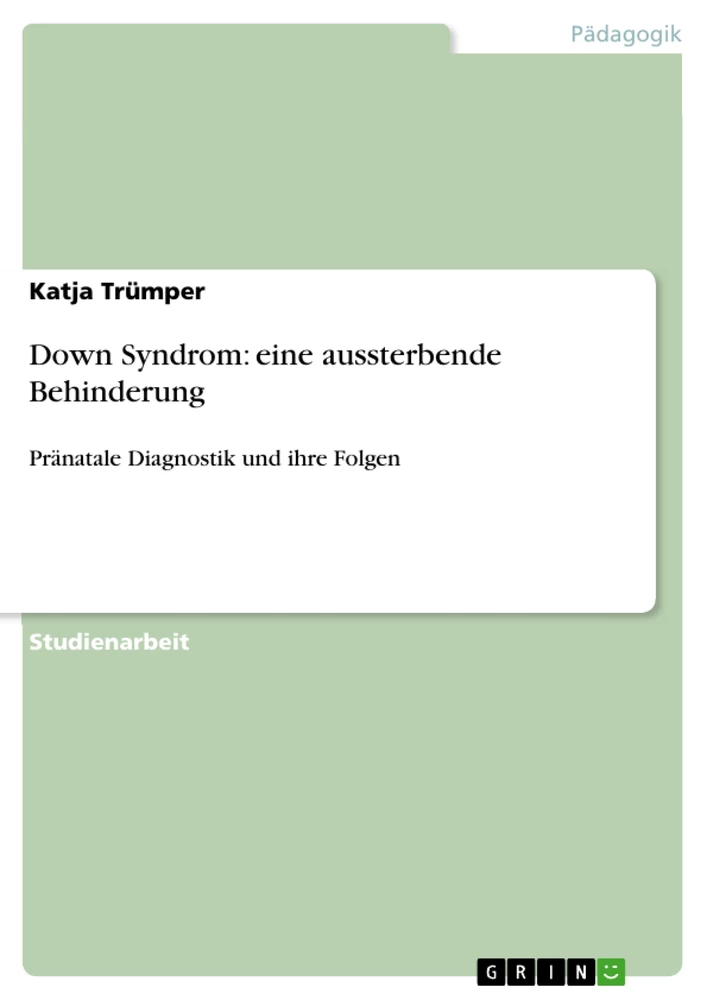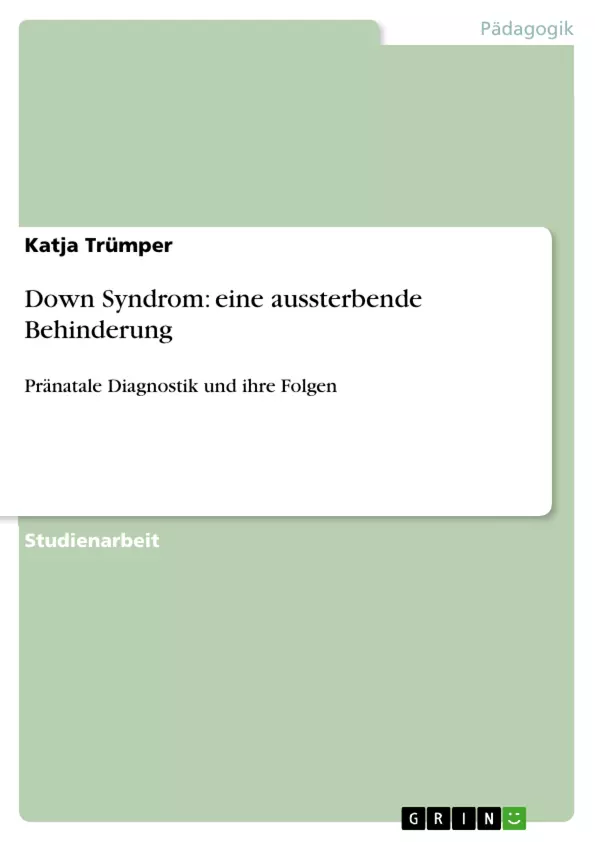Eine Frau erfährt, dass sie schwanger ist – gewünscht oder befürchtet. Mit einem Mal geschieht vieles gleichzeitig. Ängste, Hoffnungen und Zweifel kommen auf. Wer möchte nicht gesund sein und ein gesundes Kind zur Welt bringen? Die schwangere Frau geht zu einem Gynäkologen, bei dem verschiedene Untersuchungen durchgeführt werden. Die Frage, ob das Kind gesund ist, bleibt.
An diesem Punkt setzt die vorgeburtliche Untersuchung – Pränataldiagnostik genannt – ein. Durch verschiedene Untersuchungen wird die Lage, der Reifegrad und die Organausbildung des Fötus festgestellt. Sollten dort Auffälligkeiten auftreten, kann die Frau weitere pränatale Untersuchungen durchführen lassen, um zu erfahren, ob bei dem Fötus eine Beeinträchtigung vorliegt. Doch was geschieht, wenn in der Pränataldiagnostik eine Behinderung festgestellt wird? In was für einer Situation befinden sich die Betroffenen und welche Möglichkeiten haben sie?
In der vorliegenden Hausarbeit werde ich mich mit diesen Fragen beschäftigen und untersuchen, ob die Diagnose „Behinderung“ Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben von behinderten Menschen hat.
Ich werde mich auf die Behinderung „Down Syndrom“ konzentrieren. Die Gründe hierfür liegen zum einen in der guten Diagnostizierbarkeit während der Schwangerschaftsvorsorge und zum anderen in dem vergleichsweise „normalen“ Familienleben, welches trotz Down Syndrom möglich ist. Trotzdem entscheiden sich knapp 90% der Frauen in den Industrienationen bei der Diagnose Down Syndrom für eine medizinisch indizierte Abtreibung.
Unter dem Punkt 2 werde ich den Behinderungsbegriff „Down Syndrom“ erläutern, sowie die Ursachen und Symptome darstellen. Anschließend werde ich die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit Down Syndrom vorstellen. Grund dafür ist die Einigkeit unter Sonderpädagogen, dass Behinderung nicht eine Kategorie darstellt, die dem einzelnen behinderten Menschen zukommt, sondern vielmehr ein Resultat der Gesellschaft ist. Denn „krank ist, wer krank ist. Behindert ist, wer behindert wird und hinderlich ist.“
Der medizinische Fortschritt der pränatalen Diagnostik geht stetig voran. Die momentan üblichen vorgeburtlichen Untersuchungen mit ihren medizinischen, rechtlichen und praktischen Aspekten werde ich im dritten Punkt vorstellen. Unter Punkt 4 möchte ich einen Schritt weiter gehen und das Lebensrecht von Menschen mit Behinderung diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Down Syndrom
- 2.1. Begriffsdefinition
- 2.2. Symptome und Ursachen
- 2.3. gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit Down - Syndrom
- 3. Pränatale Diagnostik
- 3.1. Medizinische Aspekte
- 3.2. Rechtlicher Kontext
- 3.2.1. Rechtlicher Kontext der Pränataldiagnostik
- 3.2.2. Rechtlicher Kontext bei Schwangerschaftsabbruch
- 4. Lebensrecht von Menschen mit Behinderung
- 4.1. Ethischer Ansatz nach Singer
- 4.1. Die präferenz – utilitaristische Position Singers
- 4.2. Personenstatus nach Singer
- 4.3. Nichtfreiwillige Euthanasie
- 4.2. Kritische Stellungnahme zum Ansatz Singers
- 4.1. Ethischer Ansatz nach Singer
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob die Diagnose „Behinderung" Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben von behinderten Menschen hat. Dabei konzentriert sich die Arbeit auf die Behinderung „Down Syndrom“ und untersucht die Rolle der pränatalen Diagnostik in diesem Kontext. Die Arbeit analysiert, wie die Diagnose Down Syndrom die Entscheidungen von Schwangeren beeinflusst und welche ethischen Aspekte mit der pränatalen Diagnostik und der Abtreibung im Falle einer Behinderung verbunden sind.
- Begriffsdefinition und Symptome des Down Syndroms
- Gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit Down Syndrom
- Medizinische und rechtliche Aspekte der pränatalen Diagnostik
- Das Lebensrecht von Menschen mit Behinderung: Der ethische Ansatz von Peter Singer
- Kritische Auseinandersetzung mit Singers Argumenten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der pränatalen Diagnostik und deren Auswirkungen auf Menschen mit Behinderung ein. Sie stellt die Fragestellung der Arbeit und die Wahl des Down Syndroms als Schwerpunktthema dar.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Begriff „Down Syndrom", seinen Symptomen und Ursachen. Es beleuchtet die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit Down Syndrom und betrachtet die Behinderung nicht als Kategorie, sondern als Resultat der Gesellschaft.
Kapitel 3 beleuchtet die pränatale Diagnostik im Detail. Es stellt die medizinischen Aspekte der Diagnostik vor und untersucht den rechtlichen Kontext der Pränataldiagnostik und des Schwangerschaftsabbruchs.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Lebensrecht von Menschen mit Behinderung und stellt die umstrittenen Ansichten des Philosophen Peter Singer vor, der die Tötung von Menschen mit geistiger Behinderung rechtfertigt. Es werden Singers Argumente und seine präferenz-utilitaristische Position erläutert und kritisch betrachtet.
Schlüsselwörter
Down Syndrom, Pränatale Diagnostik, Schwangerschaftsabbruch, Lebensrecht, Behinderung, gesellschaftliche Akzeptanz, Peter Singer, Euthanasie, präferenz-utilitaristische Position, medizinische Aspekte, rechtlicher Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Down-Syndrom (Trisomie 21)?
Es ist eine genetische Besonderheit, bei der das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist, was zu charakteristischen körperlichen Merkmalen und kognitiven Beeinträchtigungen führt.
Welche ethischen Fragen wirft die Pränataldiagnostik auf?
Die Arbeit diskutiert, inwieweit die Früherkennung von Behinderungen zu einer Selektion führt und das Lebensrecht von Menschen mit Behinderung infrage stellt.
Wie hoch ist die Abbruchquote bei der Diagnose Down-Syndrom?
In Industrienationen entscheiden sich knapp 90 % der Frauen bei einer positiven Diagnose für einen medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruch.
Welche Position vertritt Peter Singer zum Lebensrecht?
Der Philosoph Peter Singer vertritt eine präferenz-utilitaristische Position, die das Lebensrecht an den Personenstatus knüpft, was in der Behindertenpädagogik stark kritisiert wird.
Ist ein normales Familienleben mit Down-Syndrom möglich?
Ja, die Arbeit betont, dass trotz der Beeinträchtigung ein erfülltes und vergleichsweise „normales“ Familienleben möglich ist, sofern gesellschaftliche Akzeptanz besteht.
- Citar trabajo
- Katja Trümper (Autor), 2008, Down Syndrom: eine aussterbende Behinderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161730