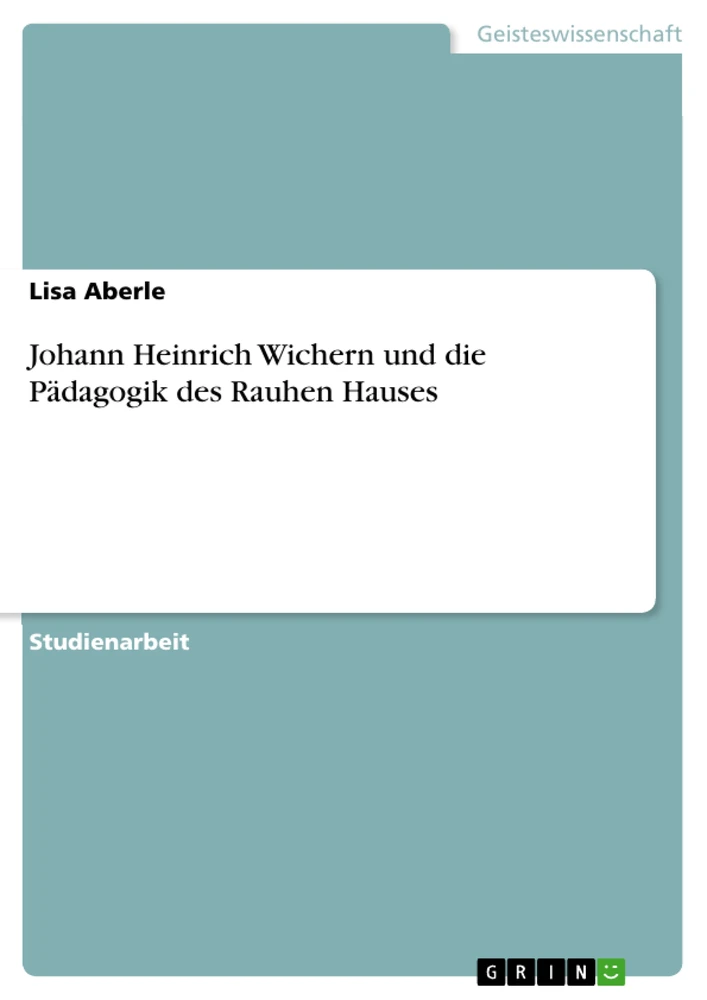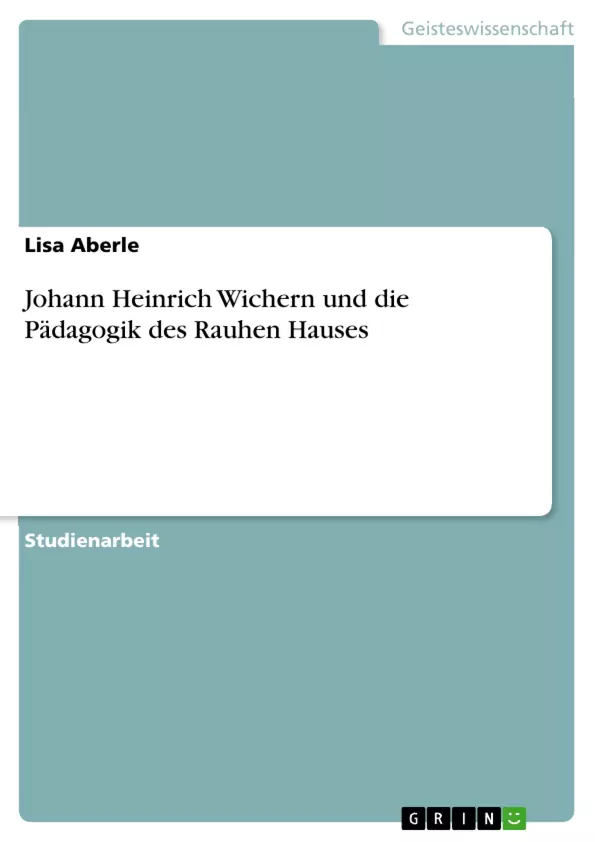Die folgende Hausarbeit soll ein Einblick in die Pädagogik von Johann Hinrich Wichern im Zusammenhang mit dem Rauhen Haus in Hamburg gewähren.
Ziel der Hausarbeit ist es, die wirtschaftlichen und gesellschaftliche Ereignisse zu Beginn des 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Pädagogik Wicherns zu bringen, um seine An-liegen und Leitgedanken besser verstehen und einordnen zu können.
Die zentralen Fragen dieser Arbeit sind daher, welche Bedingungen seiner Zeit Wicherns sozialreformerischen Initiativen beeinflussten, welchen zentralen Elementen die Pädagogik Wicherns unterlag und welche Impulse für die heutige Erziehungspraxis Wicherns pädagogi-sches Konzept bietet.
Der Schwerpunkt der Hausarbeit liegt zum einen bei der Biographie und dem geschichtlichen Hintergrund, zum anderen bei der Erläuterung der Pädagogik Wicherns anhand des Rauhen Hauses.
Im ersten Teil der Hausarbeit soll das Augenmerk auf die Entstehung der Pädagogik Wicherns im Hinblick auf seine Biographie und den geschichtlichen Kontext gerichtet wer-den.
Im zweiten Teil steht dann das Rauhe Haus als Erziehungskonzept Wicherns im Vorder-grund. Hier soll auf die Entstehung des Rauhen Hauses in Hamburg, auf die zentralen Ele-mente der Pädagogik Wicherns und auf die Organisation im Rauhen Haus eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung der Pädagogik Wicherns
- Die Biographie Wicherns
- Der geschichtliche Hintergrund
- Das Rauhe Haus als Erziehungskonzept Wicherns
- Das Rauhe Haus: Entstehung und Leitgedanke
- Die zentralen Elemente der Pädagogik Wicherns
- Die Organisation des Rauhen Hauses
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit bietet einen Einblick in die Pädagogik Johann Hinrich Wicherns im Kontext des Rauhen Hauses in Hamburg. Sie beleuchtet die historischen und sozialen Bedingungen, die Wicherns sozialreformerische Initiativen beeinflussten, analysiert die zentralen Elemente seiner Pädagogik und untersucht, welchen Einfluss sein pädagogisches Konzept auf die heutige Erziehungspraxis hat.
- Die Biographie Wicherns und die Entstehung seiner pädagogischen Ideen
- Der historische Hintergrund der Kinderarmut und Vernachlässigung im 19. Jahrhundert
- Die Entstehung und Organisation des Rauhen Hauses als Erziehungskonzept
- Die zentralen Elemente der Pädagogik Wicherns, wie z.B. die Bedeutung von Glaube, Arbeit und Gemeinschaft
- Die Relevanz des pädagogischen Konzepts Wicherns für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und Fragestellungen der Hausarbeit vor. Sie beschreibt das Interesse der Autorin an den Anfängen der Kinderhilfe und dem Umgang mit verwaisten und verwahrlosten Kindern im 19. Jahrhundert.
Die Entstehung der Pädagogik Wicherns
Die Biographie Wicherns
Dieser Abschnitt beleuchtet die wichtigsten Stationen in Wicherns Leben, insbesondere die Ereignisse, die für die Entwicklung seiner pädagogischen Ideen und die Gründung des Rauhen Hauses entscheidend waren. Schwerpunkte liegen auf Wicherns Jugend, seinem Studium und seinem frühen Engagement in der Sonntagsschule.
Der geschichtliche Hintergrund
Dieser Abschnitt untersucht die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen des 19. Jahrhunderts, die die Entstehung der Kinderarmut und die Notwendigkeit von Hilfemaßnahmen förderten. Er stellt den Kontext für Wicherns pädagogische Arbeit dar.
Das Rauhe Haus als Erziehungskonzept Wicherns
Das Rauhe Haus: Entstehung und Leitgedanke
Dieser Abschnitt beschreibt die Gründung des Rauhen Hauses, seine Entstehungsgeschichte und die Leitgedanken, die Wicherns pädagogisches Konzept prägten. Er beleuchtet die Beweggründe und die Visionen, die zur Einrichtung dieses Heims führten.
Die zentralen Elemente der Pädagogik Wicherns
Dieser Abschnitt analysiert die wichtigsten Elemente der Pädagogik Wicherns. Er betrachtet die Rolle von Glaube, Arbeit, Gemeinschaft und Erziehung im Rahmen des Rauhen Hauses.
Die Organisation des Rauhen Hauses
Dieser Abschnitt untersucht die praktische Organisation des Rauhen Hauses. Er beleuchtet die Strukturen, die Lebensbedingungen und die pädagogischen Methoden, die im Alltag Anwendung fanden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind die Pädagogik Johann Hinrich Wicherns, das Rauhe Haus in Hamburg, die Entstehung der Kinderhilfe im 19. Jahrhundert, die soziale Frage, Glaube und Erziehung, Gemeinschaft und Arbeit. Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den historischen Bedingungen, die Wicherns pädagogisches Konzept prägten, und analysiert die zentralen Elemente seiner Pädagogik im Kontext des Rauhen Hauses.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Johann Hinrich Wichern?
Wichern war ein bedeutender deutscher Theologe und Sozialreformer des 19. Jahrhunderts, der als Begründer der Inneren Mission und der modernen Rettungshausbewegung gilt.
Was ist das „Rauhe Haus“ in Hamburg?
Das Rauhe Haus wurde 1833 von Wichern gegründet und war ein Erziehungskonzept für verwahrloste Kinder, das auf dem Familienprinzip, Arbeit und christlichem Glauben basierte.
Was sind die zentralen Elemente der Pädagogik Wicherns?
Die zentralen Säulen sind die Gemeinschaft in familienähnlichen Gruppen, die Erziehung durch sinnvolle Arbeit, die Vermittlung christlicher Werte und die individuelle Förderung der Kinder.
Welchen geschichtlichen Hintergrund hatte Wicherns Arbeit?
Wichern reagierte auf die massive Kinderarmut und soziale Not im Zuge der Industrialisierung im frühen 19. Jahrhundert, die viele Kinder zur Verwahrlosung und Kriminalität trieb.
Bietet Wicherns Konzept heute noch Impulse für die Erziehungspraxis?
Ja, viele moderne Ansätze der Heimerziehung und Sozialpädagogik, wie die Orientierung an kleinen Wohngruppen und die Verbindung von Alltag und Lernen, lassen sich auf Wicherns Ideen zurückführen.
- Quote paper
- Lisa Aberle (Author), 2007, Johann Heinrich Wichern und die Pädagogik des Rauhen Hauses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161835