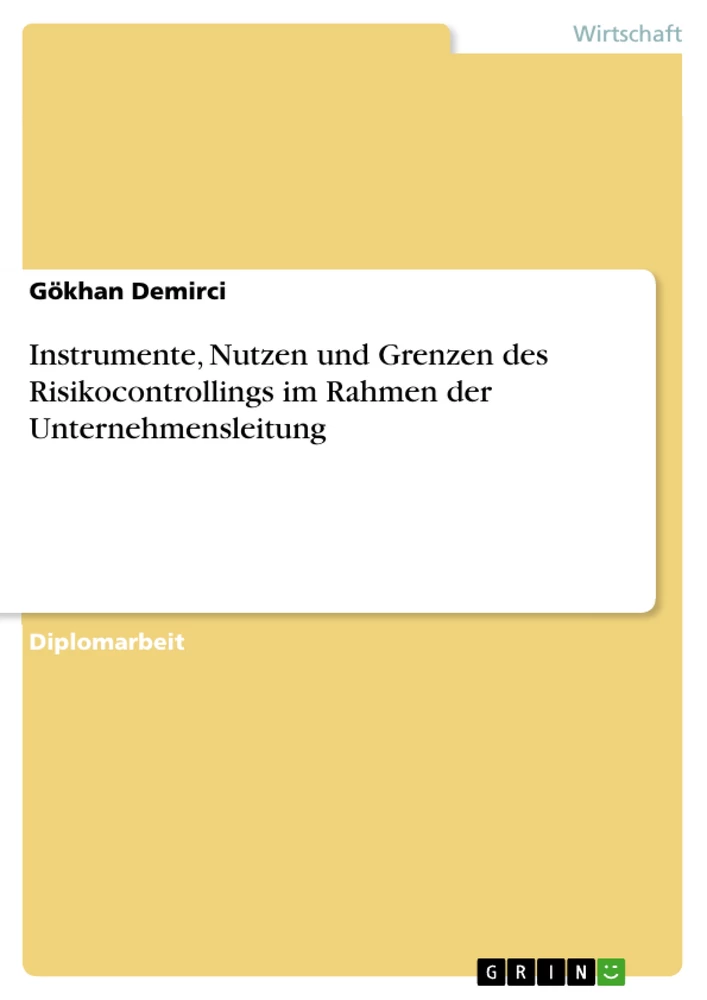In den vergangenen Jahren haben verschiedene Entwicklungen die globale Wirtschaft maßgeblich beeinflusst. Durch die Internationalisierung der Kapitalmärkte, die Ausrichtung auf den Shareholder Value, die Zunahme des dynamischen Wettbewerbs sowie die zahlreichen finanziellen Krisen – wie zuletzt in den Jahren 2008 und 2009 – mussten sich Unternehmen immer größer werdenden Herausfor-derungen stellen. So führten diese Entwicklungen zu einer zunehmenden Komplexität der Unternehmensstrukturen und damit auch der Risikoumwelt und Entscheidungen der Unternehmen.
Angesichts der Tatsache, dass Risiken untrennbar mit jeglichen unternehmerischen Handlungen verbunden sind, stellt sich für jedes Unternehmen das Erfordernis, den Risikoaspekt zu fokussieren und explizit in die Planungs- und Kontrollprozesse zu implementieren. Durch die o. g. diskontinuierlichen Entwicklungen und den ständig verändernden Risiken, sind besonders Nicht-Finanzunternehmen gezwungen, sich immer wieder flexibel anzupassen um die nachhaltige Sicherung ihrer Existenz zu gewährleisten. Die Notwendigkeit der Flexibilität besteht zum einen darin, dass im Vorfeld die Grundstruktur des Unternehmens auf eine grundsätzliche Risikobewältigung auszurichten ist. Zum anderen müssen die Prozessabläufe auf ad hoc eintretende Risikosituationen eingestellt sein.
Dem Risikocontrolling, als eine Querschnittsfunktion zwischen dem Controlling und dem Risikomanagement, kommt dabei zweifellos eine wichtige Rolle im Hinblick auf die unterstützende unternehmerische Handhabung von Risiken und Chancen zu. In der betriebswirtschaftlichen Literatur und in der Praxis herrscht allerdings eine Uneinheitlichkeit bezüglich der Umsetzung der oben angeführten Erfordernisse mit einer „richtigen“ Risikocontrolling-Konzeption. Häufig ist unklar, was unter dem Begriff Risikocontrolling verstanden wird. Weiterhin herrscht Uneinigkeit darüber, welche Funktionen das Risikocontrolling im Rahmen der Unternehmensleitung konkret wahrzunehmen hat. Ausgehend von den geschilderten Problemen zielt die vorliegende Arbeit darauf, eine nutzenstiftende RC-Konzeption zu konkretisieren.
Dabei beruht diese Arbeit auf dem führungsgestaltenden Koordinationsansatz nach den akademischen Vorreitern Horváth und Küpper. Das RC wird als eine koordinierende Unterstützungsfunktion im Rahmen der Unternehmensleitung verstanden, das zur Erfassung der Risikointerdependenzen sowohl unternehmsintern als auch unternehmensübergreifend eingesetzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des Risikocontrollings
- Begriff des Risikos in der Betriebswirtschaftslehre
- Risikopolitische Grundsätze
- Grundverständnis des Risikocontrollings
- Begriff und Wesen des Risikocontrollings
- Konzeptionelles Verständnis des Risikocontrollings
- Risikocontrolling und Risikomanagement
- Risikomanagementsystem und Risikocontrolling
- Gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen
- Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
- Einführung eines Risikomanagementsystems
- Risikoorientierter Lagebericht
- Ausweitung der Abschlussprüfung
- Deutscher Corporate Governance Kodex
- Sarbanes-Oxley Act
- Analyse ausgewählter Instrumente des Risikocontrollings
- Phasenspezifische Instrumente des Risikocontrollings
- Instrumente der Risikoidentifikation
- Brainstorming
- Risikochecklisten
- Frühaufklärungssysteme
- Instrumente der Risikoanalyse und Risikobewertung
- Value-at-Risk
- Cash Flow-at-Risk
- Sensitivitäts- und Szenarioanalyse
- Scoring Modelle
- Instrumente der Risikokontrolle und Risikodokumentation
- Risikoberichtswesen
- Risikoabweichungsanalyse
- Nutzen und Grenzen des Risikocontrollings
- Phasenübergreifende Instrumente des Risikocontrollings
- Risikoorientierte Budgetierung
- Risikoorientiertes Kennzahlensystem
- Nutzen und Grenzen des Risikocontrollings
- Fallbeispiel
- Risikocontrolling in operativen Geschäften
- Einsatz des Cash Flow-at-Risk
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Risikocontrolling im Rahmen der Unternehmensleitung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Risikocontrollings zu entwickeln, indem die relevanten Instrumente, Nutzen und Grenzen des Risikocontrollings untersucht werden.
- Begriff und Wesen des Risikocontrollings
- Instrumente der Risikoidentifikation, -analyse, -bewertung und -kontrolle
- Nutzen und Grenzen des Risikocontrollings in verschiedenen Phasen des Risikomanagementprozesses
- Gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen des Risikocontrollings
- Anwendungsbeispiel des Risikocontrollings in operativen Geschäften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert eine kurze Einführung in das Thema Risikocontrolling und erläutert die Relevanz des Themas für die Unternehmensleitung.
Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen des Risikocontrollings. Es wird der Begriff des Risikos in der Betriebswirtschaftslehre definiert, risikopolitische Grundsätze vorgestellt und ein grundlegendes Verständnis des Risikocontrollings vermittelt. Zudem werden die gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen des Risikocontrollings beleuchtet.
In Kapitel 3 werden ausgewählte Instrumente des Risikocontrollings analysiert. Es werden sowohl phasenspezifische als auch phasenübergreifende Instrumente betrachtet. Die Instrumente werden im Hinblick auf ihren Nutzen und ihre Grenzen bewertet.
Kapitel 4 präsentiert ein Fallbeispiel, in dem das Risikocontrolling in operativen Geschäften angewendet wird. Der Einsatz des Cash Flow-at-Risk als Instrument zur Risikobewertung wird illustriert.
Schlüsselwörter
Risikocontrolling, Risikomanagement, Risikoidentifikation, Risikoanalyse, Risikobewertung, Risikokontrolle, Value-at-Risk, Cash Flow-at-Risk, Frühaufklärungssysteme, Risikoberichtswesen, Risikoabweichungsanalyse, Risikoorientierte Budgetierung, Risikoorientiertes Kennzahlensystem, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Deutscher Corporate Governance Kodex, Sarbanes-Oxley Act
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe des Risikocontrollings in einem Unternehmen?
Risikocontrolling fungiert als koordinierende Unterstützungsfunktion für die Unternehmensleitung bei der Erfassung und Handhabung von Risiken und Chancen.
Welche Instrumente werden zur Risikoidentifikation genutzt?
Eingesetzt werden Methoden wie Brainstorming, Risikochecklisten und Frühaufklärungssysteme.
Was unterscheidet Risikocontrolling von Risikomanagement?
Risikocontrolling ist eine Querschnittsfunktion zum Controlling, die den Risikomanagementprozess durch Planung und Kontrolle unterstützt und koordiniert.
Was sind Value-at-Risk und Cash Flow-at-Risk?
Dies sind Instrumente der Risikoanalyse und -bewertung, die potenzielle Verluste oder Schwankungen im Cashflow statistisch messbar machen.
Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es für das Risikomanagement?
Wichtige Gesetze sind das KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich), der Deutsche Corporate Governance Kodex und der Sarbanes-Oxley Act.
Welche Grenzen hat das Risikocontrolling?
Grenzen liegen oft in der Datenqualität, der Vorhersehbarkeit extremer Krisen und der Komplexität interdependenter Risiken.
- Citation du texte
- Gökhan Demirci (Auteur), 2010, Instrumente, Nutzen und Grenzen des Risikocontrollings im Rahmen der Unternehmensleitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161880