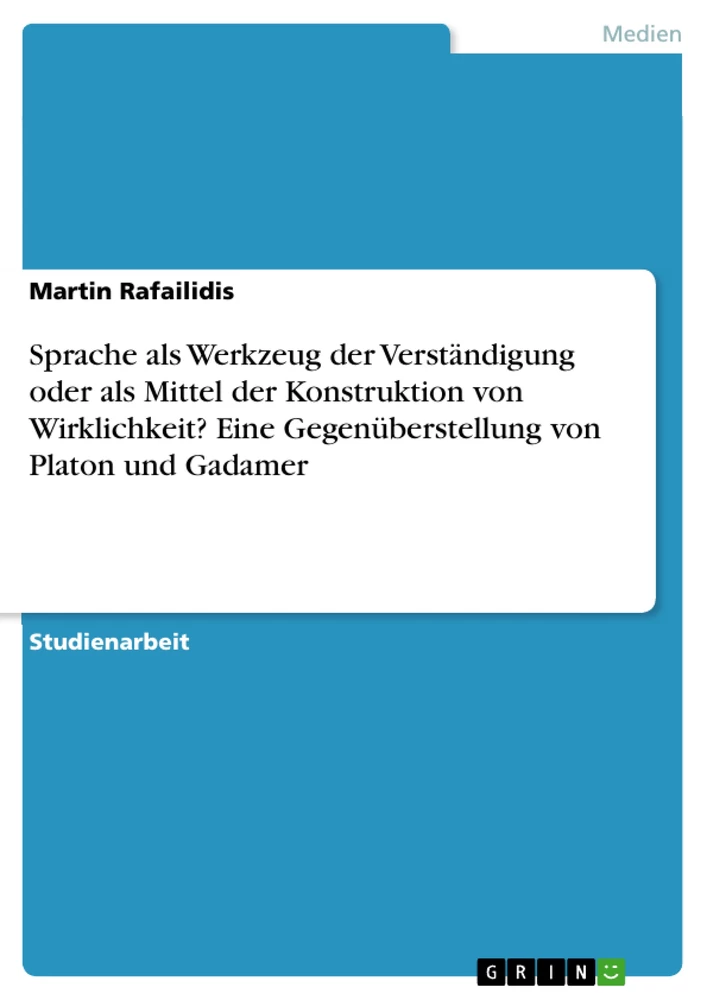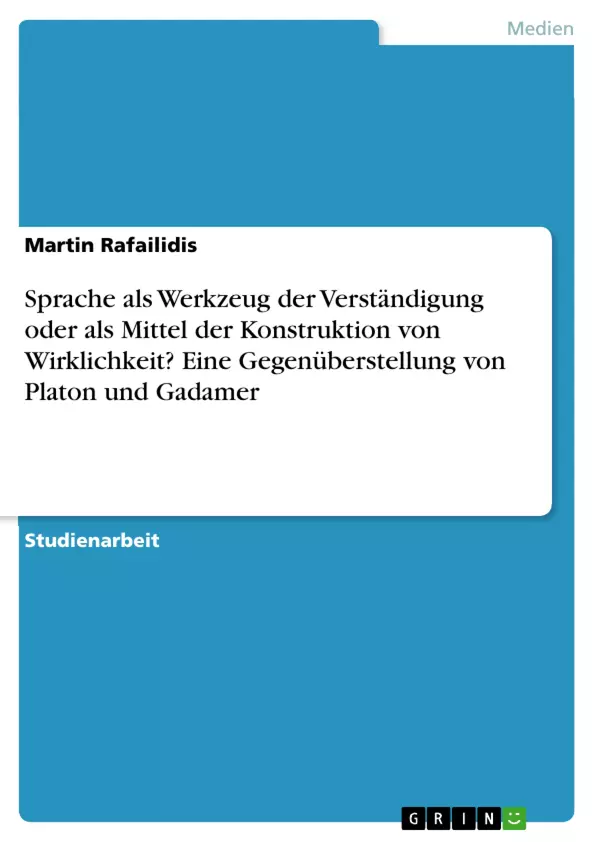Die Philosophie Platons kann in vielen Bereichen als der Grundstein unserer heutigen Welterklärung gesehen werden. Das erklärt auch die Plausibilität, die seine Argumente weit über zweitausend Jahre nach seinem Schaffen für uns heute noch haben. Genauso verhält es sich mit dem Bereich der Sprache. Nach Platon verwendet der Mensch die Sprache als „Werkzeug“ zum Benennen und um sich verständigen zu können. Dies scheint auf dem ersten Blick eine unumstößliche Tatsache zu sein, nach der sich auch in den Wissenschaften viele Modelle der Kommunikation und der Sprache richten. Dabei läuft man jedoch Gefahr die Sprache wie einen Gegenstand von den Menschen abzukoppeln, gerade so, als ob man sie, eben wie ein „Werkzeug“, aus der Hand legen könne. Dagegen spricht sich Hans-Georg Gadamer aus, indem er betont, daß man „immer schon von der Sprache umgriffen [ist]“ (Gadamer,1986, S.149). Man ist also immer schon „in Sprache“, was erhebliche Konsequenzen für unsere Vorstellung von „Realität“ hat. Aus der Sicht Gadamers ist Sprache kein Werkzeug, mit dem wir die gegebene Welt ordnen und mit ihr umgehen, sondern Sprache ist vielmehr überhaupt dafür verantwortlich, daß wir uns eine Welt vorstellen können.
In diesem Text sollen nach einigen biographischen Angaben genau diese beiden Vorstellungen der Sprache gegenübergestellt werden. Dabei versuche ich zunächst, den Argumentationsweg Platons anhand einer Textstelle aus dem „Kratylos“ nachzuzeichnen. Anschließend soll das Verständnis Gadamers in Bezug auf Sprache erläutert werden. Nach einem Vergleich der beiden Positionen versuche ich abschließend noch einen Bezug zu den weiterführenden Ergebnissen, auf die wir im Laufe des Seminars2 gekommen sind, herzustellen. Dabei soll auch meine eigene Position erkennbar werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie
- Platon
- Hans-Georg Gadamer
- Sprache und Wirklichkeit
- Sprache bei Platon
- Sprache bei Gadamer
- Vergleich Platon und Gadamer
- Erkenntnis
- Wahrheit
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit setzt sich zum Ziel, die unterschiedlichen Ansichten von Platon und Hans-Georg Gadamer zur Sprache und deren Bedeutung für die Konstruktion von Wirklichkeit zu vergleichen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob Sprache lediglich ein Werkzeug der Verständigung ist oder ob sie aktiv die Wirklichkeit mitgestaltet.
- Platons Vorstellung von Sprache als Werkzeug der Benennung und Verständigung
- Gadamers Auffassung von Sprache als konstitutive Kraft, die die Vorstellung von Wirklichkeit ermöglicht
- Der Einfluss der Ideenlehre Platons auf seine Sprachphilosophie
- Die hermeneutische Sichtweise Gadamers auf Sprache und Verstehen
- Die Relevanz beider Positionen für die heutige Sprachphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Gegenüberstellung von Platons und Gadamers Positionen zur Sprache. Anschließend werden biographische Informationen zu beiden Denkern gegeben, um den Kontext ihrer jeweiligen Ansichten zu beleuchten.
Der dritte Abschnitt widmet sich der Analyse von Platons Sprachphilosophie. Anhand einer Textstelle aus dem „Kratylos“ wird Platons Vorstellung von Sprache als Handlung, die nach ihrer Natur erfolgen muss, dargestellt. Dabei wird Platons erkenntnistheoretische Grundannahme der Ideenlehre erläutert, die besagt, dass die Wahrheit über die Dinge schon immer in uns steckt und durch richtiges Nachdenken wiedergefunden werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Sprachphilosophie, insbesondere mit den Begriffen Sprache, Wirklichkeit, Erkenntnis, Wahrheit und Hermeneutik. Die Analyse fokussiert auf die Werke von Platon und Hans-Georg Gadamer, sowie auf die Bedeutung ihrer Ansichten für das Verständnis von Sprache im Kontext von Kommunikation und Welterschließung.
- Quote paper
- Martin Rafailidis (Author), 2001, Sprache als Werkzeug der Verständigung oder als Mittel der Konstruktion von Wirklichkeit? Eine Gegenüberstellung von Platon und Gadamer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16193