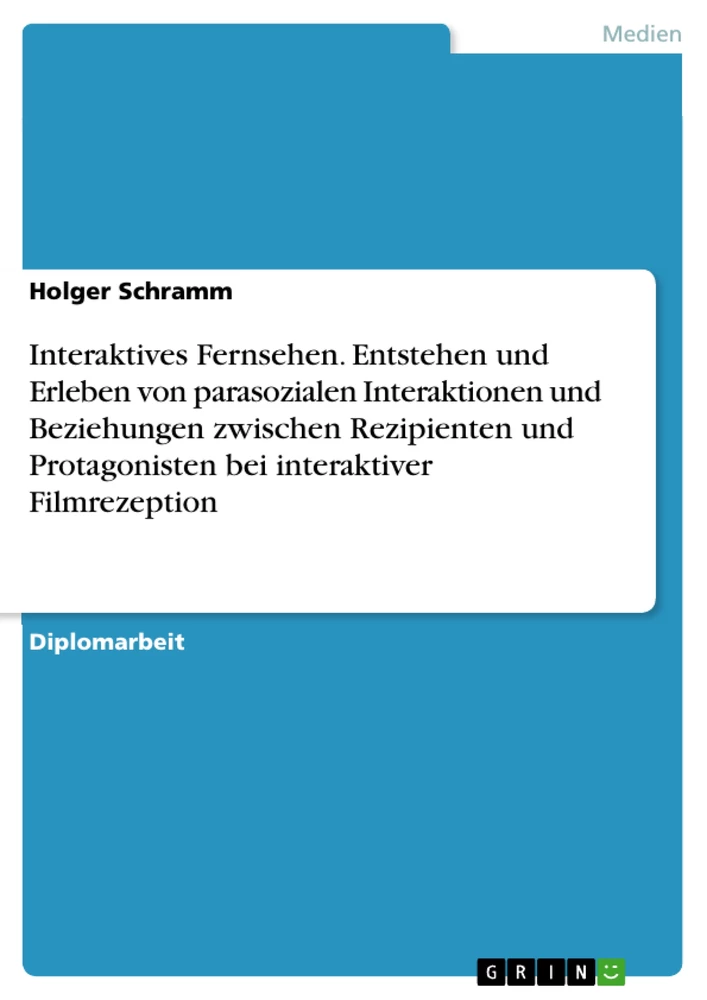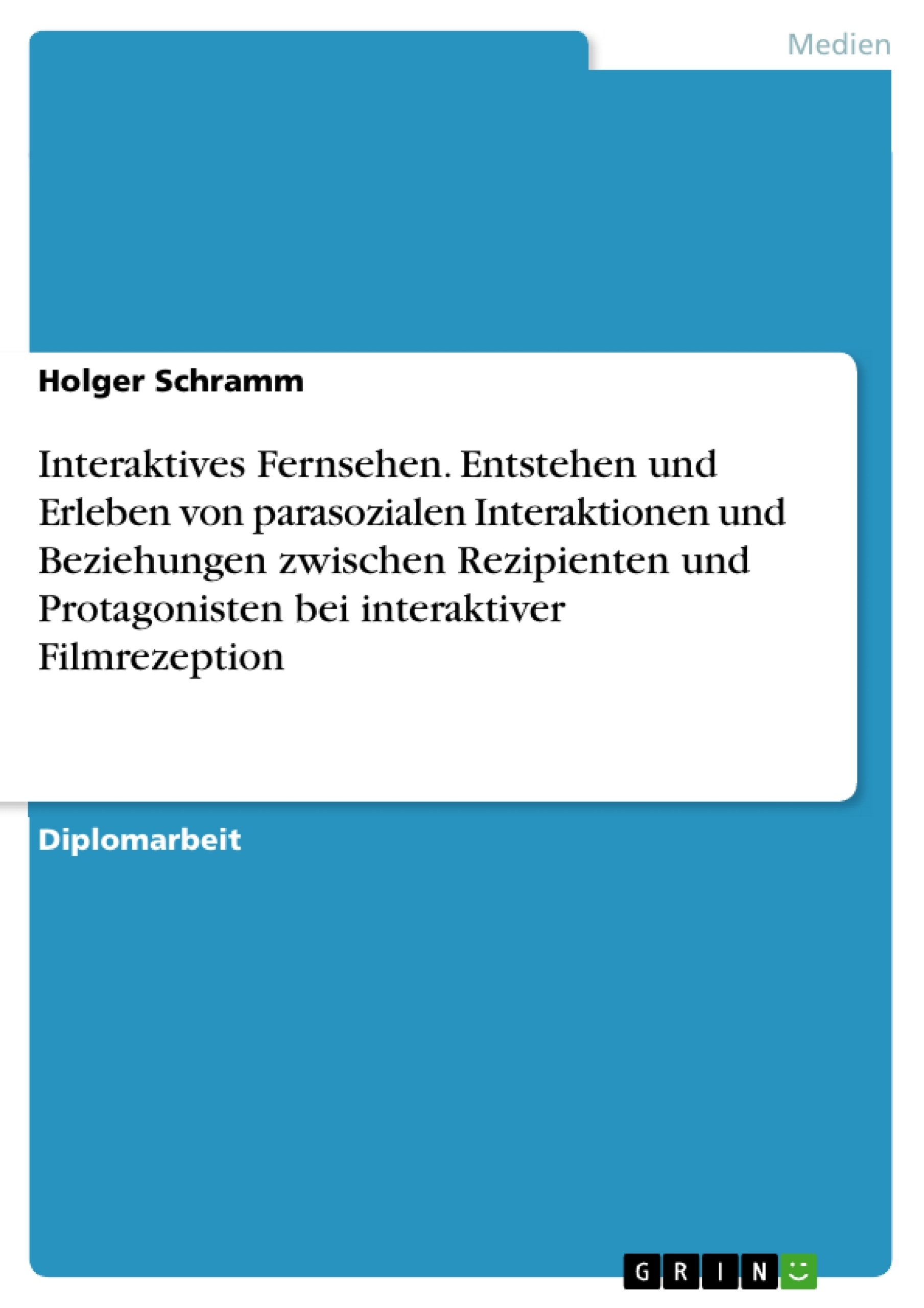Einleitung und Problemstellung
Es zeichnet sich ein Wechsel von der Massenkommunikation zu verschiedenen Formen technischer Individualkommunikation ab. Schon im Verlauf des dualen Rundfunksystems ist eine zunehmende Zersplitterung der Adressaten von Massen zu Zielgruppen erkennbar. Mit der Digitalisierung wird sich dieser Prozeß zugunsten einer Individualisierung der bisherigen Massenkommunikation fortsetzen.
Aus dem passiven Zuschauer früherer Fernsehjahre soll künftig ein aktiver User werden, der die verschiedenen Formen der Mediennutzung seinen individuellen Bedürfnissen anpaßt (Bleicher, 1995, S. 70).
Dieses Zitat birgt eine Reihe von Behauptungen und steht beispielhaft für die aktuelle Diskussion um die Zukunft der Medienlandschaft und der Massenkommunikation. Richtig ist sicherlich die Beobachtung einer zunehmenden Fragmentierung der Zuschauer seit Einführung des dualen Rundfunksystems. Ebenfalls kann der Trend zu einer verstärkten Individualkommunikation nicht geleugnet werden. Ob sich allerdings dieser Trend aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung fortsetzen wird, ob tatsächlich die Individual-kommunikation nach und nach die ‚Oberhand‘ gegenüber der Massen-kommunikation gewinnen wird (vgl. hierzu: Hoffmann-Riem & Vesting, 1994; Wehner, 1997) und ob die neuen (interaktiven) Medien die traditionellen Medien ersetzen oder vielleicht doch nur ergänzen werden (vgl. hierzu: Harms & Voermanek, 1994; Schmid & Kubicek,
1994), kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht kategorisch geklärt werden. Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang auch erforderlich, mit neuen Kategorien, Modellen und Begrifflichkeiten zu arbeiten. Berghaus (1997) stellt hierzu fest:
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Theorie und Forschungsstand
- Interaktion, Interaktivität und interaktives Fernsehen
- Zu den Begriffen der Interaktion und Interaktivität
- Definition und Formen interaktiver Medien
- Interaktives Fernsehen
- Versuch einer begrifflichen Annäherung
- Forschung und empirische Befunde
- Parasoziale Interaktionen und Beziehungen zu Fernsehakteuren
- Definition und Wesensbeschreibung
- Vergleich mit nicht-medialen (parasozialen) Interaktionen und Beziehungen
- Überblick über die wichtigsten empirischen Befunde
- Parasoziale Interaktionen als interaktionistisches Modell von Fernsehrezeption
- Alternativer Ansatz für die Erklärung von parasozialen Interaktionen: Affective Disposition Theory
- Verbindung der Theoriefelder: Parasoziale Interaktionen beim interaktiven Fernsehen unter Berücksichtigung der Affective Disposition Theory
- Affective Disposition Theory: Ergänzung oder Ersatz für die Erklärung parasozialer Interaktionen?
- Parasoziale Interaktionen bei interaktiver Rezeption
- Hypothesen und Forschungsfragen
- Interaktion, Interaktivität und interaktives Fernsehen
- Methodisches Vorgehen
- Rahmenbedingungen
- Forschungsdesign
- Operationalisierung
- Unabhängige Variablen
- Abhängige Variablen
- Weitere hypothesen-relevante Variablen
- Beschreibung des Stimulus-Materials
- Beschreibung der Stichprobe
- Erhebungssituation und Durchführung der Untersuchung
- Ergebnisse
- Überprüfung der Voraussetzungen des Forschungsdesigns
- Einbeziehen von weiteren Moderatorvariablen
- Deskriptive Ergebnisse
- Persönlichkeitsmerkmale
- Mediennutzung
- Bewertung des Protagonisten
- Sozio-emotionales Filmerleben
- Hypothesenprüfung
- Exploration und Prüfung der Forschungsfragen
- Ergebnisse im Überblick
- Interpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Entstehen und Erleben von parasozialen Interaktionen und Beziehungen zwischen Rezipienten und Protagonisten bei interaktiver Filmrezeption. Sie analysiert, wie sich das Medium Fernsehen durch die zunehmende Digitalisierung und Interaktivität verändert und welche Auswirkungen dies auf das Zuschauererlebnis hat.
- Begriffe der Interaktion und Interaktivität im Kontext interaktiven Fernsehens
- Parasoziale Interaktionen und Beziehungen zu Fernsehakteuren
- Die Rolle der Affective Disposition Theory für die Erklärung von parasozialen Interaktionen
- Empirische Untersuchung zur Überprüfung der Hypothesen und Forschungsfragen
- Interpretation der Ergebnisse und Diskussion der Relevanz für die Medienforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Problemstellung: Die Arbeit stellt den Wandel von Massenkommunikation zu Individualkommunikation im Zuge der Digitalisierung dar und problematisiert den Einfluss interaktiver Medien auf die Rolle des Zuschauers.
- Theorie und Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet zentrale Begriffe wie Interaktion, Interaktivität und interaktives Fernsehen und untersucht die Entstehung und Charakteristika von parasozialen Interaktionen. Es werden verschiedene theoretische Ansätze, wie die Affective Disposition Theory, vorgestellt und auf ihre Relevanz für das Verständnis von parasozialen Interaktionen bei interaktiver Filmrezeption eingegangen.
- Methodisches Vorgehen: Das Kapitel beschreibt das Forschungsdesign der Arbeit, die Operationalisierung der Variablen und die Auswahl des Stimulus-Materials sowie der Stichprobe. Die Erhebungssituation und die Durchführung der Untersuchung werden detailliert dargestellt.
- Ergebnisse: Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden präsentiert, darunter die Überprüfung der Hypothesen, die Exploration der Forschungsfragen und eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
- Interpretation: Die Ergebnisse der Arbeit werden im Kontext der theoretischen Grundlagen interpretiert und ihre Bedeutung für die Medienforschung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Interaktivität, parasoziale Interaktion, Affective Disposition Theory, interaktives Fernsehen, Zuschauererlebnis, Mediennutzung und empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind parasoziale Interaktionen?
Es handelt sich um einseitige Beziehungen, die Zuschauer zu Medienfiguren aufbauen, wobei sie diese wie reale Sozialpartner wahrnehmen.
Wie verändert interaktives Fernsehen die Zuschauerrolle?
Vom passiven Rezipienten wird der Zuschauer zum aktiven User, der den Handlungsverlauf beeinflussen kann, was die parasoziale Bindung verstärken kann.
Was besagt die Affective Disposition Theory?
Diese Theorie erklärt, dass Zuschauer emotionale Bindungen basierend auf der moralischen Bewertung von Charakteren aufbauen, was ihr Unterhaltungserleben steuert.
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Massenkommunikation?
Die Digitalisierung führt zu einer Fragmentierung des Publikums und einem Trend hin zur technischen Individualkommunikation.
Können interaktive Medien traditionelles Fernsehen ersetzen?
Das ist unklar; oft ergänzen neue Medien die traditionellen eher, als sie vollständig zu ersetzen, wobei neue Kategorien der Mediennutzung entstehen.
- Quote paper
- Holger Schramm (Author), 2000, Interaktives Fernsehen. Entstehen und Erleben von parasozialen Interaktionen und Beziehungen zwischen Rezipienten und Protagonisten bei interaktiver Filmrezeption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161