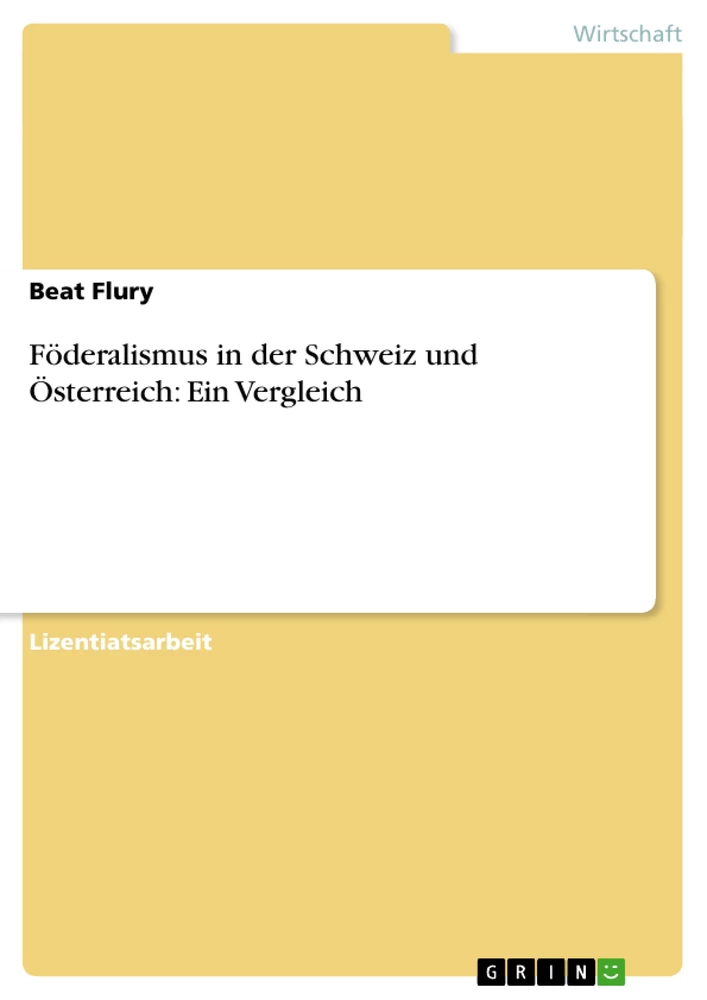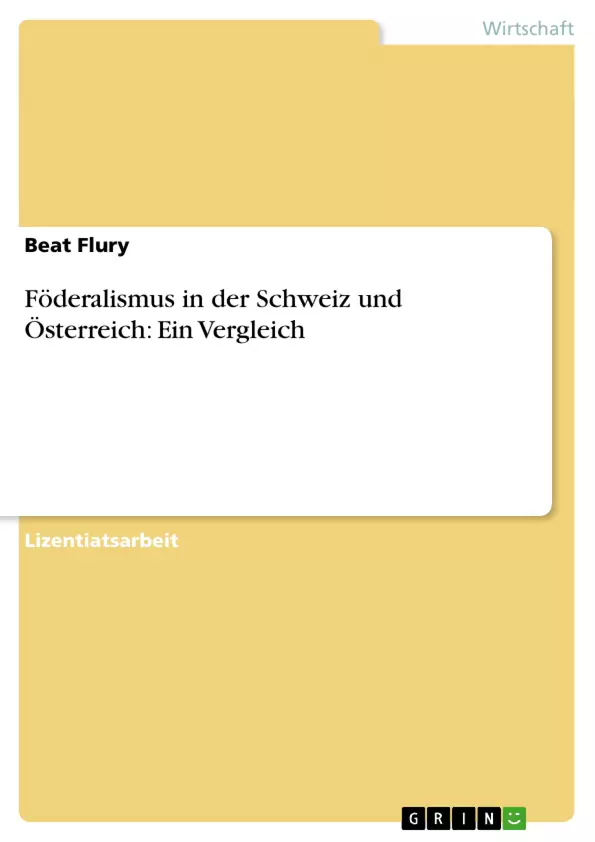Die vorliegende Arbeit soll die ökonomischen Aspekte des Föderalismus der beiden
Bundesstaaten Schweiz und Österreich vergleichen. Zuerst stellt sich die Frage, was
ist Föderalismus? Föderalismus wird folgendermassen definiert. Föderalismus ist ein
politisches Strukturprinzip, bei dem sich ein Gemeinwesen aus mehreren, ihre
Entscheidungen abstimmenden, aber ihrer Eigenständigkeit bewahrenden
Gemeinschaften zusammensetzen. Föderalistische Gestaltungsmöglichkeiten sind
der Staatenbund oder der Bundesstaat (Gabler Wirtschaftslexikon 2000).
Die Schweiz und Österreich sind beides föderale Bundesstaaten. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass durch den Zusammenschluss von Staaten ein neuer Staat
entstanden ist. Die föderalen Ebenen sind Bund, Länder/Kantone und Gemeinden.
Die neu zusammengeschlossen Staaten verlieren jedoch nicht alle ihre
Kompetenzen, sondern teilen ihre Aufgaben mit dem übergeordneten Staat. Sie
bilden eine Hierarchie von Gebietskörperschaften. Je nachdem wie der Föderalismus
ausgestaltet ist, unterscheiden sich die Zuständigkeiten und die Art der
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen. Im Föderalismus sind die
Gebietskörperschaften selbstständig. Jede Hierarchiestufe ist souverän und trifft ihre
Entscheidungen unabhängig von den Entscheidungen anderer
Gebietskörperschaften. Die übergeordnete Körperschaft kann deren Beschlüsse nur
dann aufheben, wenn sie wiederrechtlich sind, das heisst, wenn sie den zuvor
festgelegten Kompetenzabgrenzungen widersprechen.
Föderale Strukturen sind heute in folgenden Staaten anzutreffen: Argentinien,
Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Komoronen, Äthiopien,
Bundesrepublik Deutschland, Indien, Malaysia, Mexiko, Mikronesien, Nigeria,
Pakistan, Russland, St. Kitts und Nevis, Südafrika, Spanien, Schweiz, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Venezuela, und im ehemaligen
Jugoslawien (STALDER 1999, 10).
Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf den Bereich des fiskalischen
Föderalismus, das heisst vor allem auf die Einnahmen- und Ausgabenaufteilung
zwischen den Gebietskörperschaften, und versucht die Frage zu beantworten,
welches System sich stärker an der ökonomischen Theorie orientiert, welches
System besser zu einer effizienten Aufgabenerfüllung geeignet ist, und wie die Trends für die Zukunft bezüglich des Föderalismus in den beiden untersuchten
Staaten aussehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ökonomische Grundlagen, Theoriebestand
- Fiskalischer Föderalismus ökonomisch gesehen
- Theorie des Finanzausgleichs
- Zusammenfassung
- Der Schweizer Föderalismus
- Grundlegende Daten
- Das politische System
- Gebietskörperschaften
- Der Österreichische Föderalismus
- Grundlegende Daten
- Das politische System
- Gebietskörperschaften
- Vergleich des Fiskalföderalismus in Österreich und der Schweiz
- Aufgaben- und Ausgabenkompetenzen
- Besteuerungskompetenzen
- Steuerwettbewerb
- Kompetenzverteilung zwischen den drei staatlichen Ebenen in der Schweiz und in Österreich
- Finanzausgleichsysteme
- Föderalismus und Staatsquote
- Bewertung der unterschiedlichen Ausprägungen des Föderalismus
- Trends in beiden Ländern bezüglich Föderalismus
- Reformvorschläge für Österreich
- Reformvorschläge für die Schweiz
- Abschliessende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die ökonomischen Aspekte des Föderalismus in der Schweiz und Österreich. Das Hauptziel ist es, zu analysieren, welches System stärker an der ökonomischen Theorie orientiert ist und welches System besser zu einer effizienten Aufgabenerfüllung geeignet ist. Zusätzlich werden zukünftige Trends im Föderalismus beider Länder betrachtet.
- Ökonomische Theorie des Fiskalföderalismus
- Vergleich der Einnahmen- und Ausgabenverteilung in der Schweiz und Österreich
- Analyse der jeweiligen Steuer- und Finanzausgleichssysteme
- Bewertung der Effizienz der föderalen Strukturen
- Zukünftige Trends und Reformvorschläge
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit vergleicht den fiskalischen Föderalismus der Schweiz und Österreichs, untersucht die jeweiligen Systeme auf ihre ökonomische Theorieorientierung und Effizienz und analysiert zukünftige Trends. Die Schweiz und Österreich werden als gegensätzliche Pole im Föderalismus beschrieben, wobei die Schweiz stärker dezentral und Österreich stärker zentralisiert ist. Der Fokus liegt auf der Einnahmen- und Ausgabenverteilung zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen.
Ökonomische Grundlagen, Theoriebestand: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für den Vergleich. Es werden ökonomische Konzepte wie "Voting by feet", Subsidiaritätsprinzip, Konnexität, fiskalische Äquivalenz, Skalenerträge und Nutzenspillover sowie die Theorie des Finanzausgleichs erläutert. Diese Konzepte bilden das analytische Gerüst für die spätere Untersuchung der beiden föderalen Systeme.
Der Schweizer Föderalismus: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Daten, das politische System und die Gebietskörperschaften der Schweiz. Es wird detailliert auf die Einnahmen- und Aufgabenverteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden eingegangen, um ein umfassendes Bild des schweizerischen Fiskalföderalismus zu zeichnen. Der Fokus liegt auf der starken Dezentralisierung des Systems.
Der Österreichische Föderalismus: Ähnlich dem vorherigen Kapitel, beschreibt dieses den österreichischen Föderalismus anhand grundlegender Daten, des politischen Systems und der Gebietskörperschaften. Die Einnahmen- und Ausgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wird analysiert, wobei die stärkere Zentralisierung im Vergleich zur Schweiz hervorgehoben wird.
Vergleich des Fiskalföderalismus in Österreich und der Schweiz: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Systeme anhand von Aufgaben- und Ausgabenkompetenzen, Besteuerungskompetenzen, Steuerwettbewerb und den Finanzausgleichsystemen. Es werden die Unterschiede in den Steuersystemen und der Kompetenzverteilung zwischen den drei staatlichen Ebenen detailliert analysiert. Der Vergleich soll die unterschiedlichen Ausprägungen des Föderalismus in den beiden Ländern aufzeigen.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Fiskalföderalismus, Schweiz, Österreich, Einnahmenverteilung, Ausgabenverteilung, Steuerwesen, Finanzausgleich, Dezentralisierung, Zentralisierung, ökonomische Effizienz, Kompetenzverteilung, Steuersystem, Gebietskörperschaften, Trendanalyse, Reformvorschläge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich des Fiskalföderalismus in Österreich und der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die ökonomischen Aspekte des Föderalismus in der Schweiz und Österreich. Sie analysiert, welches System stärker an der ökonomischen Theorie orientiert ist und welches System besser zu einer effizienten Aufgabenerfüllung geeignet ist. Zusätzlich werden zukünftige Trends im Föderalismus beider Länder betrachtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die ökonomische Theorie des Fiskalföderalismus, den Vergleich der Einnahmen- und Ausgabenverteilung in der Schweiz und Österreich, die Analyse der jeweiligen Steuer- und Finanzausgleichssysteme, die Bewertung der Effizienz der föderalen Strukturen und zukünftige Trends und Reformvorschläge. Es werden die grundlegenden Daten, die politischen Systeme und die Gebietskörperschaften beider Länder betrachtet. Der Fokus liegt auf der Einnahmen- und Ausgabenverteilung zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen (Bund, Kantone/Länder, Gemeinden).
Welche Länder werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den Fiskalföderalismus der Schweiz und Österreichs. Die Schweiz wird als stärker dezentralisiertes und Österreich als stärker zentralisiertes System dargestellt.
Welche ökonomischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit verwendet ökonomische Konzepte wie "Voting by feet", Subsidiaritätsprinzip, Konnexität, fiskalische Äquivalenz, Skalenerträge und Nutzenspillover sowie die Theorie des Finanzausgleichs, um die beiden föderalen Systeme zu analysieren.
Wie werden die Systeme verglichen?
Der Vergleich erfolgt anhand von Aufgaben- und Ausgabenkompetenzen, Besteuerungskompetenzen, Steuerwettbewerb und den Finanzausgleichsystemen. Die Unterschiede in den Steuersystemen und der Kompetenzverteilung zwischen den drei staatlichen Ebenen (Bund, Kantone/Länder, Gemeinden) werden detailliert analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Ökonomischen Grundlagen und Theoriebestand, dem Schweizer Föderalismus, dem Österreichischen Föderalismus, einem Vergleich des Fiskalföderalismus in Österreich und der Schweiz und einer Bewertung der unterschiedlichen Ausprägungen des Föderalismus mit Trends und Reformvorschlägen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die ökonomische Theorieorientierung und Effizienz der beiden Systeme zu beurteilen und zukünftige Trends im Föderalismus beider Länder zu analysieren. Die konkreten Schlussfolgerungen bezüglich der Effizienz und der besseren Systemgestaltung werden im letzten Kapitel präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Föderalismus, Fiskalföderalismus, Schweiz, Österreich, Einnahmenverteilung, Ausgabenverteilung, Steuerwesen, Finanzausgleich, Dezentralisierung, Zentralisierung, ökonomische Effizienz, Kompetenzverteilung, Steuersystem, Gebietskörperschaften, Trendanalyse und Reformvorschläge.
- Quote paper
- Beat Flury (Author), 2003, Föderalismus in der Schweiz und Österreich: Ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16214