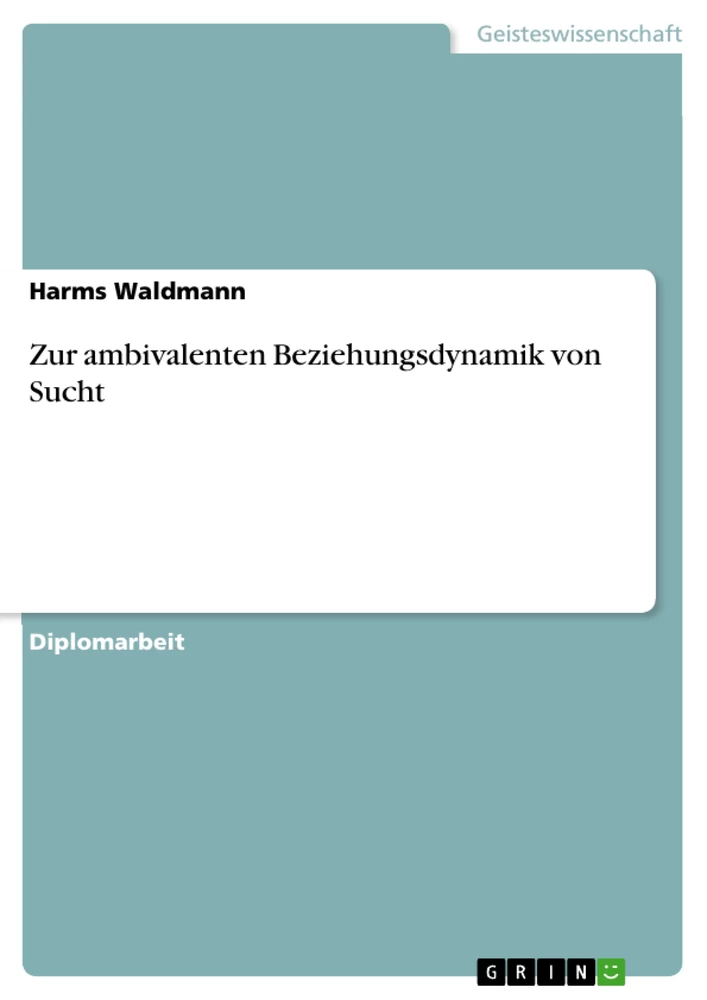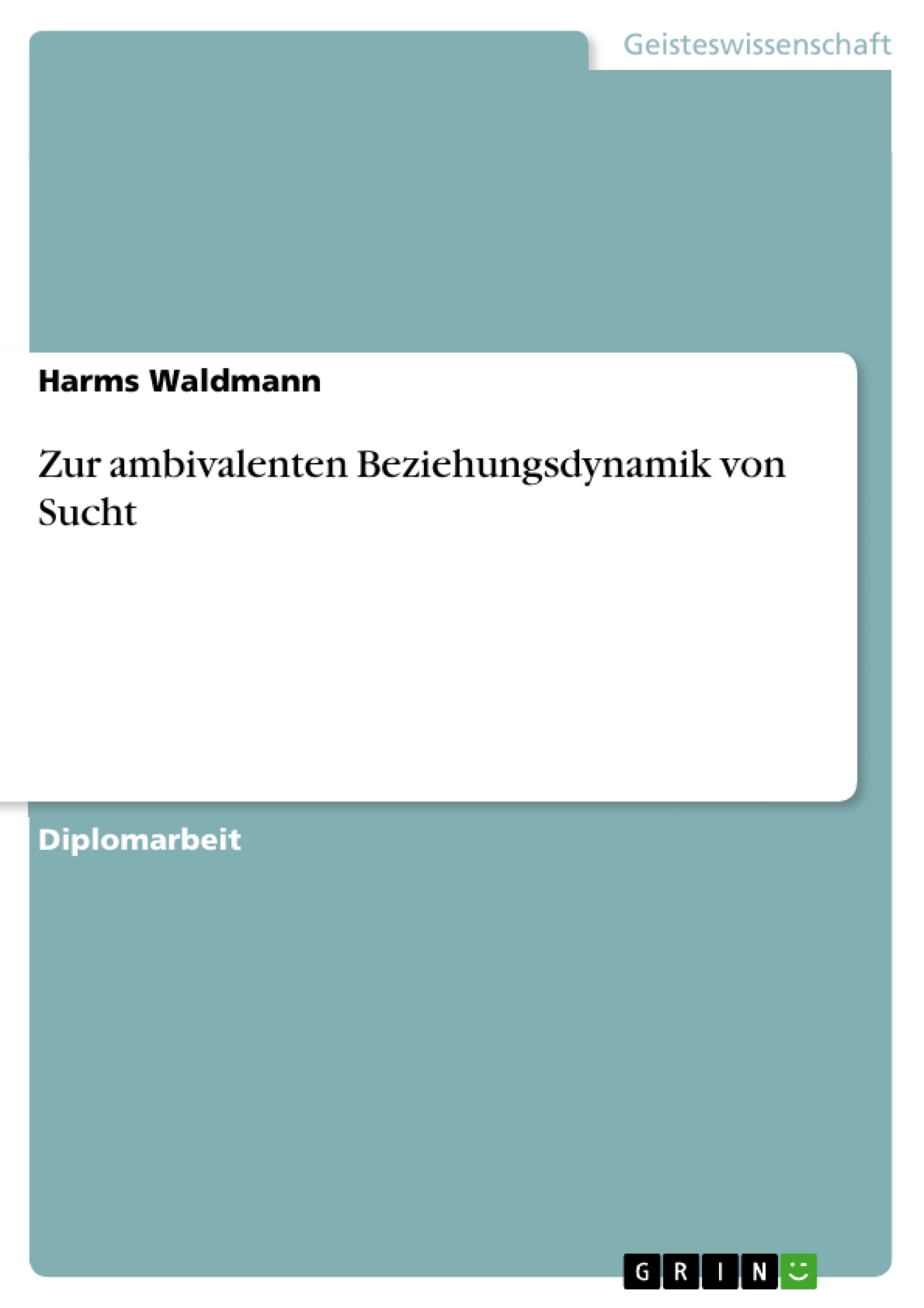Das Menschen-gesellschaftliche Leben erfordert zum einen definitiv die Beziehungsaufnahme, zum anderen bleibt die geheime Sehnsucht nach der unerfahrbaren, einer bisher nicht dagewesenen, also in diesem Sinne nicht abhängigen und ungekannten Existenz des Einzelnen.
Diese Sehnsucht drückt sich heute in vielfältigen Formen gesuchter oder erlebter Grenzerfahrungen über kulturelle, soziale und mentale Unterschiede hinaus aus. - Die Erfahrung als solche ist eine individuelle, denn sie wird jeweils allein gemacht; deshalb hat sie isolierenden Charakter und stellt keine solide Grundlage für ein über die Erlebnisgrenze des Einzelnen hinausreichendes Beziehungsangebot dar.
Im menschlichen Erleben der heutigen Zeit entsteht zunehmend eine Dynamik, die sich zwischen Individualerlebnis und Beziehungskonstrukt bewegt, wobei letzteres eben die Hinwendung zum Anderen, zum Fremden, zum Nicht-Eigenen unbedingt erfordert und damit in völligem Gegensatz zum Individualerlebnis steht. Das Individualerlebnis erfährt nun im Zuge zunehmender Isolations- und Vereinzelungserscheinungen in der Gesellschaft eine symbolische Verstärkung.
Die oben benannten Vorgänge, Beobachtungen und Erfahrungen werden in den einzelnen Kapiteln literarisch bearbeitet um dem gewählten Arbeitstitel „Zur ambivalenten Beziehungsdynamik von Sucht“ gerecht zu werden. Ziel ist es, die Sichtweise des Begriffs der Sucht abzuwandeln und vielleicht eine neue Dimension für ihr Verständnis zu eröffnen. Das von der Sucht beeinflusste menschliche Beziehungsgeschehen wird eingehend untersucht, und die Bedeutung des Themas Sucht in seiner gesamtgesellschaftlichen Dimension dargestellt.
Den Begriff der Ambivalenz wird sowohl im psychologischen Sinne für »einander entgegen gesetzte Gefühle«, als auch im Sinne von »Doppelwertigkeit« und »Zwiespältigkeit« verwendet. Ein Hauptaugenmerk soll dabei auf die im Suchtgeschehen etablierten Widersprüche gerichtet werden, die letztlich den Zwiespalt im Beziehungsgeschehen des Menschen ausmachen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Zur Konstitution von Beziehung
- Darstellung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses
- Das Eltern-Kind-Verhältnis und seine Bedeutung für die Beziehungsfähigkeit des Menschen
- Das Mensch-Welt-Verhältnis als Sozialisationsleistung
- Lust und Unlust als Antagonismus
- Zur Pathogenese von Sucht
- Zur Definition von Sucht
- Etymologischer und philosophischer Ansatz
- Psychologischer Ansatz (nach S.Scheerer)
- Der Ansatz der Objektbeziehungs-Theorie
- Ableitung und Folgerung
- Sucht und der Krankheitsbegriff
- Sucht als abweichendes Verhalten
- Zur Definition von Sucht
- Der Süchtige als Objekt
- Rauscherleben als Abtrennung der Wirklichkeit?
- Subjektivität des Rauscherlebens
- Sehn-Sucht
- Droge und Ritual
- Die süchtige Beziehungsgestaltung
- Rauscherleben als Abtrennung der Wirklichkeit?
- Objektfixierung und Isolation
- Symbiose
- Co-Abhängigkeit
- Narzissmus als Form moderner Selbst-Sucht
- Drogen, Sucht und Tabu
- Der Begriff der psychischen Krankheit
- Zur Therapierbarkeit von Sucht
- Sucht-Hilfe im Sucht-System
- Sucht-Hilfe als Form der Hilfs-Sucht
- Soziale Arbeit als Entwicklungshemmung
- Eine produktive Hilfe-Konzeption
- Abgewandeltes Klärungsmodell für Veränderungsprozesse
- Mögliche Lern- und Handlungsalternativen
- Sucht-Hilfe im Sucht-System
- Schlusswort - Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die ambivalente Beziehungsdynamik von Sucht. Ziel ist es, die Entstehung und Aufrechterhaltung von Sucht im Kontext zwischenmenschlicher Beziehungen zu analysieren. Dabei werden verschiedene theoretische Ansätze herangezogen und die Rolle der sozialen Umwelt beleuchtet.
- Die Konstitution von Beziehungen und deren Einfluss auf die Entwicklung von Sucht
- Die Pathogenese von Sucht und die Definition des Begriffs „Sucht“
- Die Beziehungsgestaltung Süchtiger und die Rolle von Objektfixierung und Isolation
- Narzissmus als eine Form moderner Selbstsucht
- Therapiemöglichkeiten und die Rolle der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der ambivalenten Beziehungsdynamik von Sucht ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie legt den Fokus auf die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten.
Zur Konstitution von Beziehung: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung von Beziehungen, beginnend mit dem Subjekt-Objekt-Verhältnis. Es analysiert die Rolle des Eltern-Kind-Verhältnisses für die spätere Beziehungsfähigkeit und betrachtet das Mensch-Welt-Verhältnis als Sozialisationsleistung. Der Antagonismus von Lust und Unlust wird als wichtiger Aspekt der Beziehungsdynamik dargestellt, der für die Entstehung von Sucht relevant sein kann.
Zur Pathogenese von Sucht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung von Sucht. Es werden verschiedene Definitionen von Sucht diskutiert, sowohl aus etymologischer und philosophischer als auch aus psychologischer Perspektive, insbesondere im Hinblick auf die Objektbeziehungs-Theorie. Der Krankheitsbegriff im Zusammenhang mit Sucht und die Betrachtung von Sucht als abweichendes Verhalten werden ebenfalls behandelt.
Der Süchtige als Objekt: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Perspektive des Süchtigen. Es wird das Rauscherlebnis als Abtrennung von der Realität analysiert, die subjektive Erfahrung des Rausches wird beleuchtet. Die Themen Suchtsehn, Droge und Ritual sowie die süchtige Beziehungsgestaltung werden umfassend diskutiert.
Objektfixierung und Isolation, Symbiose, Co-Abhängigkeit: Diese Kapitel erörtern verschiedene Aspekte der süchtigen Beziehungsgestaltung: Objektfixierung und Isolation als Folge von Suchtverhalten, die symbiotische Beziehung zwischen Süchtigem und Bezugspersonen und die Thematik der Co-Abhängigkeit. Diese Kapitel beleuchten die komplexen Beziehungen, die durch Sucht entstehen.
Narzissmus als Form moderner Selbst-Sucht: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Narzissmus und Sucht, wobei Narzissmus als eine Form von Selbstsucht interpretiert wird. Es analysiert die psychologischen Mechanismen und die Rolle des Selbstbildes in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten.
Drogen, Sucht und Tabu: Dieses Kapitel behandelt den Aspekt von Tabus im Zusammenhang mit Drogen und Sucht. Es untersucht gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung und Behandlung von Sucht.
Der Begriff der psychischen Krankheit: Dieses Kapitel diskutiert den Begriff der psychischen Krankheit im Kontext von Sucht. Es setzt sich kritisch mit der Klassifizierung von Sucht als psychische Erkrankung auseinander und analysiert die damit verbundenen gesellschaftlichen und medizinischen Implikationen.
Zur Therapierbarkeit von Sucht: Dieses Kapitel widmet sich den Möglichkeiten der Therapie von Sucht. Es betrachtet verschiedene Ansätze der Sucht-Hilfe, analysiert kritisch die Rolle der Sozialen Arbeit und entwickelt eine produktive Hilfe-Konzeption, die auf einem abgewandelten Klärungsmodell für Veränderungsprozesse basiert und mögliche Lern- und Handlungsalternativen aufzeigt.
Schlüsselwörter
Sucht, Abhängigkeit, Beziehung, Pathogenese, Objektbeziehung, Narzissmus, Co-Abhängigkeit, Therapie, Soziale Arbeit, Sozialisation, Krankheitsbegriff, Rauscherlebnis, Ritual.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Ambivalente Beziehungsdynamik von Sucht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die ambivalente Beziehungsdynamik von Sucht. Der Fokus liegt auf der Entstehung und Aufrechterhaltung von Sucht im Kontext zwischenmenschlicher Beziehungen. Verschiedene theoretische Ansätze werden herangezogen, und die Rolle der sozialen Umwelt wird beleuchtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstitution von Beziehungen und deren Einfluss auf die Entwicklung von Sucht, die Pathogenese von Sucht und Definition des Begriffs „Sucht“, die Beziehungsgestaltung Süchtiger und die Rolle von Objektfixierung und Isolation, Narzissmus als eine Form moderner Selbstsucht und Therapiemöglichkeiten sowie die Rolle der Sozialen Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Zur Konstitution von Beziehung, Zur Pathogenese von Sucht, Der Süchtige als Objekt, Objektfixierung und Isolation, Symbiose, Co-Abhängigkeit, Narzissmus als Form moderner Selbst-Sucht, Drogen, Sucht und Tabu, Der Begriff der psychischen Krankheit, Zur Therapierbarkeit von Sucht und Schlusswort - Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Wie wird die Konstitution von Beziehungen behandelt?
Das Kapitel „Zur Konstitution von Beziehung“ untersucht die Entwicklung von Beziehungen, beginnend mit dem Subjekt-Objekt-Verhältnis. Es analysiert die Rolle des Eltern-Kind-Verhältnisses für die spätere Beziehungsfähigkeit und betrachtet das Mensch-Welt-Verhältnis als Sozialisationsleistung. Der Antagonismus von Lust und Unlust wird als wichtiger Aspekt der Beziehungsdynamik dargestellt, der für die Entstehung von Sucht relevant sein kann.
Wie wird die Pathogenese von Sucht definiert und behandelt?
Das Kapitel „Zur Pathogenese von Sucht“ befasst sich mit der Entstehung von Sucht. Es werden verschiedene Definitionen von Sucht diskutiert, sowohl aus etymologischer und philosophischer als auch aus psychologischer Perspektive, insbesondere im Hinblick auf die Objektbeziehungs-Theorie. Der Krankheitsbegriff im Zusammenhang mit Sucht und die Betrachtung von Sucht als abweichendes Verhalten werden ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielt der Süchtige als Objekt?
Das Kapitel „Der Süchtige als Objekt“ konzentriert sich auf die Perspektive des Süchtigen. Es wird das Rauscherlebnis als Abtrennung von der Realität analysiert, die subjektive Erfahrung des Rausches wird beleuchtet. Die Themen Suchtsehn, Droge und Ritual sowie die süchtige Beziehungsgestaltung werden umfassend diskutiert.
Wie werden Objektfixierung, Isolation, Symbiose und Co-Abhängigkeit behandelt?
Die Kapitel zu Objektfixierung und Isolation, Symbiose und Co-Abhängigkeit erörtern verschiedene Aspekte der süchtigen Beziehungsgestaltung: Objektfixierung und Isolation als Folge von Suchtverhalten, die symbiotische Beziehung zwischen Süchtigem und Bezugspersonen und die Thematik der Co-Abhängigkeit. Diese Kapitel beleuchten die komplexen Beziehungen, die durch Sucht entstehen.
Wie wird Narzissmus im Kontext von Sucht betrachtet?
Das Kapitel „Narzissmus als Form moderner Selbst-Sucht“ untersucht den Zusammenhang zwischen Narzissmus und Sucht, wobei Narzissmus als eine Form von Selbstsucht interpretiert wird. Es analysiert die psychologischen Mechanismen und die Rolle des Selbstbildes in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten.
Welche Rolle spielen Drogen, Sucht und Tabus?
Das Kapitel „Drogen, Sucht und Tabu“ behandelt den Aspekt von Tabus im Zusammenhang mit Drogen und Sucht. Es untersucht gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung und Behandlung von Sucht.
Wie wird der Begriff der psychischen Krankheit behandelt?
Das Kapitel „Der Begriff der psychischen Krankheit“ diskutiert den Begriff der psychischen Krankheit im Kontext von Sucht. Es setzt sich kritisch mit der Klassifizierung von Sucht als psychische Erkrankung auseinander und analysiert die damit verbundenen gesellschaftlichen und medizinischen Implikationen.
Welche Therapiemöglichkeiten werden diskutiert?
Das Kapitel „Zur Therapierbarkeit von Sucht“ widmet sich den Möglichkeiten der Therapie von Sucht. Es betrachtet verschiedene Ansätze der Sucht-Hilfe, analysiert kritisch die Rolle der Sozialen Arbeit und entwickelt eine produktive Hilfe-Konzeption, die auf einem abgewandelten Klärungsmodell für Veränderungsprozesse basiert und mögliche Lern- und Handlungsalternativen aufzeigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Sucht, Abhängigkeit, Beziehung, Pathogenese, Objektbeziehung, Narzissmus, Co-Abhängigkeit, Therapie, Soziale Arbeit, Sozialisation, Krankheitsbegriff, Rauscherlebnis, Ritual.
- Quote paper
- Harms Waldmann (Author), 1997, Zur ambivalenten Beziehungsdynamik von Sucht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1622