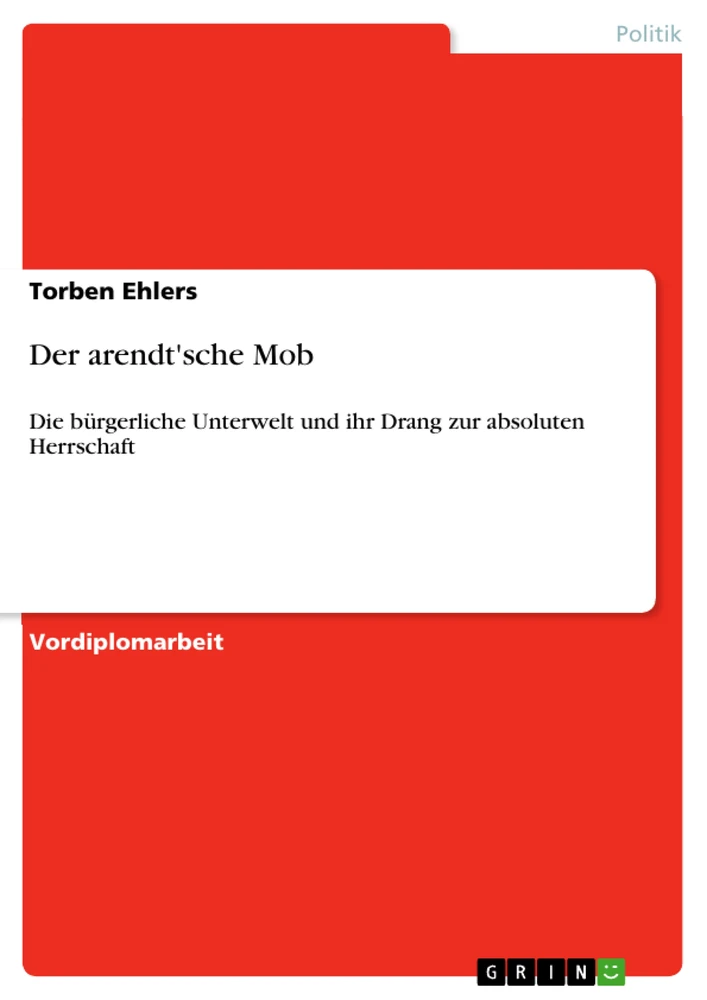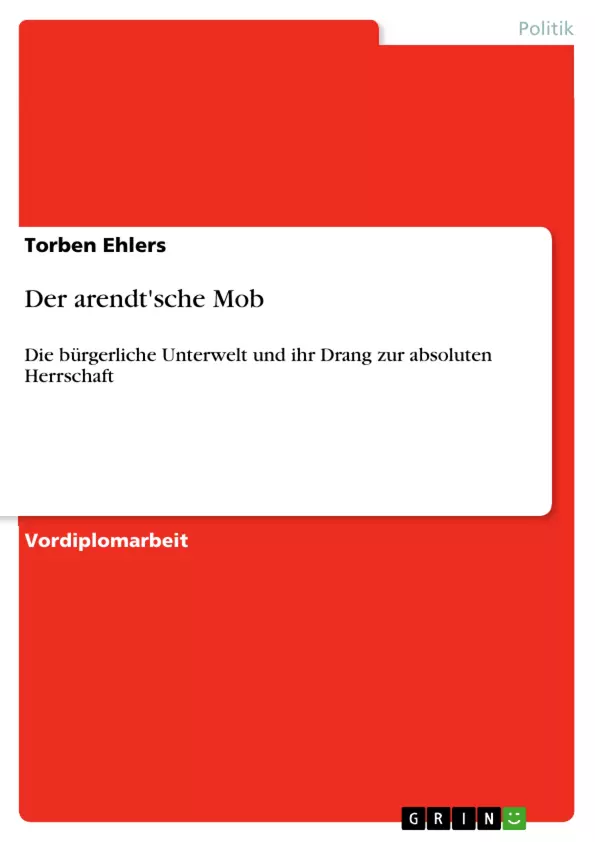Die Arbeit kristallisiert Hannah Arendts Begrifflichkeit des "Mob", die aus der Klassengesellschaft desintegrierte bürgerliche Unterwelt, aus dem Werk "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" heraus. In Deutschland war der Mob insbesondere Frontorganisation (SA), aber auch leitender Kopf auf mittlerem Niveau der nationalsozialistischen Bewegung (z.B. Ernst Röhm), katapultiert aus der Erwerbsgemeinschaft durch kapitalistische Krisen. Als Paria war der Mob ein entscheidendes Charakteristikum zur Bedingung der totalen NS-Herrschaft, der in Arendts Gesamtwerk oft übersehen wird.
Wie sich der Mob auf rassisch-völkischer Grundlage über den überseeischen zum kontinentalen Imperialismus entwickeln konnte und dass es ihn auch in England oder Frankreich gegeben hat, ist ein Schwerpunkt der Arbeit. Am Beispiel der Dreyfus-Affäre in Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts kann jedoch aufgezeigt werden, wo die Unterschiede zwischen der Herrschaft des Mob auf den französischen Strassen liegt und der Verweigerung des Bildungsbürgertums, sich diesem zu unterstellen. In der Weimarer Republik ging die politisch-ökonomische Elite einen Pakt mit dem Mob ein, was zum Ende der ersten deutschen Republik und zur Festigung des nationalsozialistischen Systems führte.
Auch für die heutige Zeit ist der Mob ein "Demokratieindikator", eine Möglichkeit aus der Geschichte zu erkennen, wie legitim ein pluralistisches Gemeinschaftswesen durch seine Träger, die Bürger, noch ist. Gemäß Hannah Arendts Ausspruch: "Was in Zeiten des Friedens als Verbrechen gilt, ist in Zeiten der Krise höchstens ein moralisches Vergehen".
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Erster Teil: Die Begrifflichkeit des Mob
- 1.1 Was ist der „Mob“
- 1.2 Hannah Arendts Begriff des Mob
- Zweiter Teil: Der Mob vom Imperialismus bis zur totalen Herrschaft
- 2.1 Der Mob in Südafrika
- 2.2 Der Mob und der Pan-Germanismus
- 2.3 Der Mob und die Masse
- Dritter Teil: Mob und Masse am Beispiel der Dreyfus-Affäre
- 3.1 Zwei Beispiele der dritten Republik
- 3.2 Der Prozess um den Hauptmann Dreyfus
- 3.3 Der Mob anhand Arendts Abschnitt, Kapitel und gesamten Werk
- Schluss: 4.1 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hannah Arendts Konzept des Mobs in ihrem Werk „Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft“, insbesondere anhand der Dreyfus-Affäre. Ziel ist es, Arendts Begriff des Mobs zu analysieren und seine historische Relevanz aufzuzeigen, indem verschiedene Erscheinungsformen des Mobs von der Zeit des Imperialismus bis zum Aufstieg totalitärer Regime untersucht werden.
- Arendts Begriff des Mobs und seine Abgrenzung von anderen Begriffen
- Der Mob als Akteur im Kontext des Imperialismus und des Pan-Germanismus
- Die Rolle des Mobs in der Dreyfus-Affäre als Beispiel für die Zersetzung demokratischer Strukturen
- Die historische Entwicklung und die unterschiedlichen Ausprägungen des Mobs
- Die Verbindung zwischen dem Mob und dem Aufstieg totalitärer Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit untersucht den „Mob“ im Sinne Hannah Arendts als bürgerliche Unterwelt und dessen Drang zur absoluten Herrschaft, exemplarisch dargestellt an der Dreyfus-Affäre. Die Einleitung betont die Relevanz der Thematik angesichts wiederkehrender antidemokratischer Tendenzen und verortet den Mob als historisches Phänomen, das sich durch verschiedene Epochen und gesellschaftliche Verhältnisse zieht. Die Dreyfus-Affäre wird als „Generalprobe“ für die totalitären Entwicklungen des 20. Jahrhunderts betrachtet.
Erster Teil: Die Begrifflichkeit des Mob: Dieser Teil befasst sich mit der Definition des Begriffs „Mob“. Es wird sowohl eine allgemeine Betrachtung des Begriffs vorgenommen als auch Arendts spezifische Definition analysiert und mit anderen Verständnisweisen kontrastiert. Das Ziel ist es, eine zeitlose Definition des Mobs zu entwickeln, die dessen unterschiedliche Ausprägungen in verschiedenen historischen und gesellschaftlichen Kontexten berücksichtigt.
Zweiter Teil: Der Mob vom Imperialismus bis zur totalen Herrschaft: Dieser Teil untersucht die Erscheinungsformen des Mobs in verschiedenen historischen Kontexten, vom Imperialismus bis zum Aufstieg totalitärer Regime. Anhand von Beispielen aus Südafrika, den Pan-Bewegungen und dem Nationalsozialismus wird gezeigt, wie der Mob versucht hat, politische Macht zu erlangen und seine Ziele durch Agitation und die Verbreitung eines unmenschlichen Weltbildes durchzusetzen. Die verschiedenen Erscheinungsformen des Mobs werden als miteinander verknüpfte Phänomene dargestellt.
Dritter Teil: Mob und Masse am Beispiel der Dreyfus-Affäre: Dieser Teil analysiert die Rolle des Mobs während der Dreyfus-Affäre. Er beschreibt die geschichtlichen Abläufe des Spionagefalls und dessen Folgen, wobei zwei Beispiele die gesellschaftspolitischen Verhältnisse der Dritten Republik Frankreichs beleuchten: die Schuldzuweisung der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg an die Juden und der Finanzskandal um den Panamakanal. Der Teil schließt mit einer Auseinandersetzung mit Hannah Arendts Analyse der Dreyfus-Affäre in ihrem Werk und deren Einbettung in ihr Gesamtkonzept der totalitären Herrschaft.
Schlüsselwörter
Mob, Hannah Arendt, Totalitäre Herrschaft, Dreyfus-Affäre, Antisemitismus, Imperialismus, Pan-Germanismus, Bürgerliche Unterwelt, Demokratie, Antidemokratische Bewegungen, Massenmord, Politische Agitation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Mobs nach Hannah Arendt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Hannah Arendts Konzept des „Mobs“ in ihrem Werk „Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft“, insbesondere anhand der Dreyfus-Affäre. Es wird untersucht, wie Arendt den Mob definiert, welche historische Relevanz er hat und wie er sich von der Masse unterscheidet. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Erscheinungsformen des Mobs vom Imperialismus bis zum Aufstieg totalitärer Regime.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Arendts Begriff des Mobs und seine Abgrenzung von anderen Begriffen; den Mob als Akteur im Kontext des Imperialismus und des Pan-Germanismus; die Rolle des Mobs in der Dreyfus-Affäre als Beispiel für die Zersetzung demokratischer Strukturen; die historische Entwicklung und die unterschiedlichen Ausprägungen des Mobs; und die Verbindung zwischen dem Mob und dem Aufstieg totalitärer Herrschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert: Eine Einführung, die die Relevanz des Themas und den Fokus auf die Dreyfus-Affäre als „Generalprobe“ für totalitäre Entwicklungen betont; einen ersten Teil, der sich mit der Definition des Begriffs „Mob“ nach Arendt und im Vergleich zu anderen Definitionen auseinandersetzt; einen zweiten Teil, der die Erscheinungsformen des Mobs in verschiedenen historischen Kontexten (Imperialismus, Pan-Germanismus, Nationalsozialismus) untersucht; und einen dritten Teil, der die Rolle des Mobs in der Dreyfus-Affäre analysiert und Arendts Analyse in ihrem Gesamtwerk einordnet. Ein Schlusswort rundet die Arbeit ab.
Welche Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die Dreyfus-Affäre als zentrales Beispiel, um die Rolle des Mobs in der Zersetzung demokratischer Strukturen zu veranschaulichen. Weitere Beispiele stammen aus Südafrika, den Pan-Bewegungen und dem Nationalsozialismus, um die verschiedenen Erscheinungsformen des Mobs im Kontext des Imperialismus und des Aufstiegs totalitärer Regime aufzuzeigen. Die Analyse der Dritten Republik Frankreichs mit ihren gesellschaftspolitischen Verhältnissen (Schuldzuweisung des Deutsch-Französischen Krieges an die Juden, Panamakanal-Skandal) wird ebenfalls herangezogen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Arendts Konzept des Mobs als bürgerliche Unterwelt mit dem Drang zur absoluten Herrschaft, auch im Hinblick auf wiederkehrende antidemokratische Tendenzen, eine hohe Relevanz besitzt. Die Analyse zeigt die historische Entwicklung und die unterschiedlichen Ausprägungen des Mobs auf und verdeutlicht dessen Verbindung zum Aufstieg totalitärer Herrschaft. Die Dreyfus-Affäre dient als eindrückliches Beispiel für die manipulative Kraft des Mobs und seine Bedrohung für demokratische Strukturen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter: Mob, Hannah Arendt, Totalitäre Herrschaft, Dreyfus-Affäre, Antisemitismus, Imperialismus, Pan-Germanismus, Bürgerliche Unterwelt, Demokratie, Antidemokratische Bewegungen, Massenmord, Politische Agitation.
- Citation du texte
- Torben Ehlers (Auteur), 2001, Der arendt'sche Mob, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162223