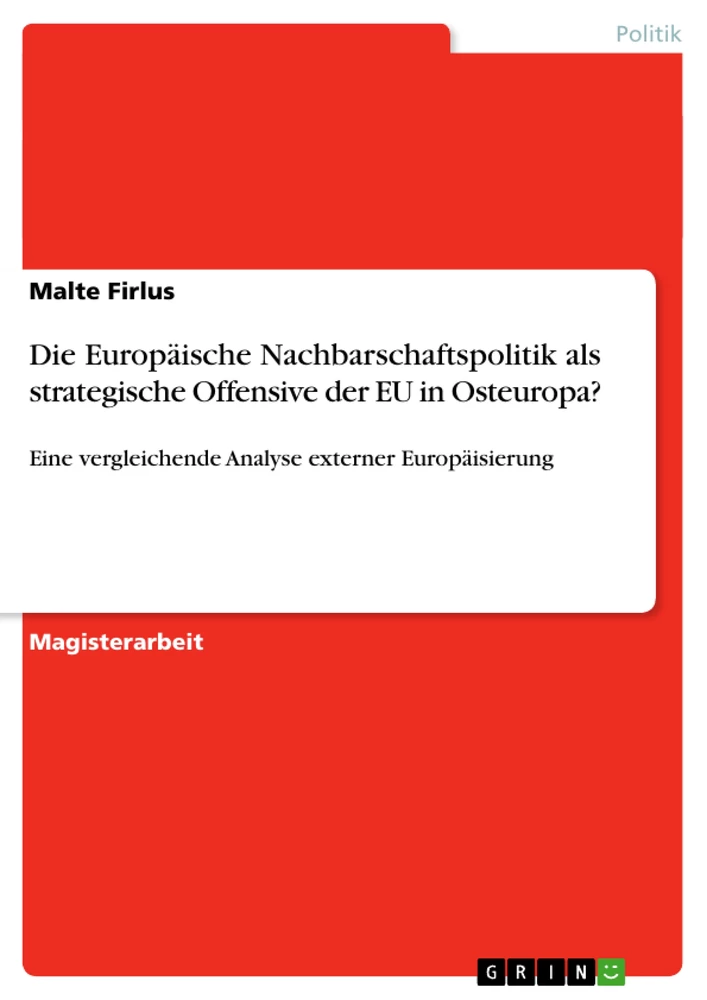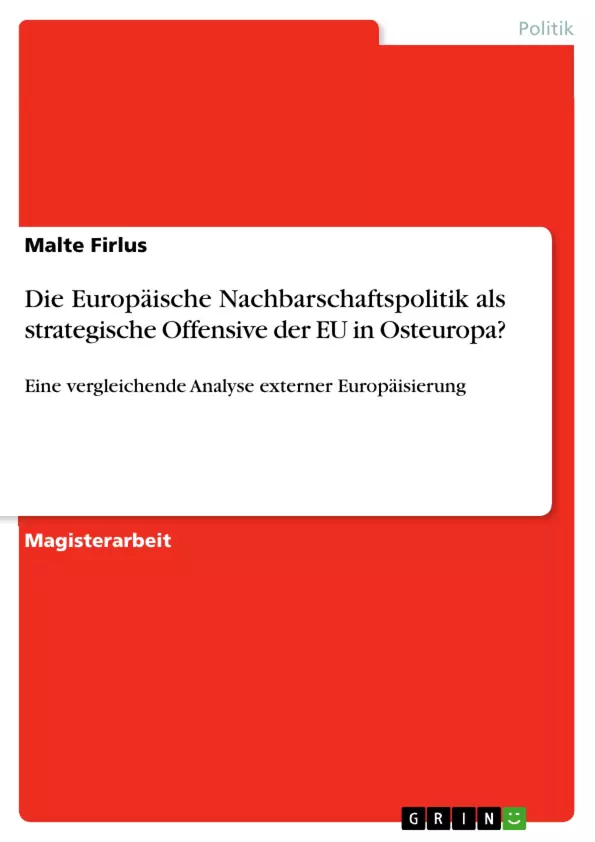Die Arbeit beantwortet die Frage, inwiefern die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) als eine strategische Neuausrichtung der EU-Außenbeziehungen zu werten ist. Als Fallbeispiel werden die geostrategisch bedeutenden Ostanrainer Ukraine und Moldova herangezogen. Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich von 1990 bis 2006. Leitet die EU gegenüber diesen beiden "in-betweens" - zwischen Russland und der EU - mit der ENP eine spezielle Erweiterungspolitik ein, die durch externe Europäisierung gekennzeichnet ist? Oder ist im zeitlichen Vergleich der EU-Außenbeziehungen vielmehr von altem Wein in neuen Schläuchen zu reden?
Forschungslücke:
Die derzeitigen wissenschaftlichen Analysen beschränkten sich beinahe ausschließlich auf den Vergleich der ENP mit der EU-Erweiterungspolitik. Eine systematische historisch ausgerichtete Analyse der EU-Beziehungen gegenüber diesen beiden strategisch wichtigen Staaten blieb dagegen bisher aus.
Forschungsvorgehen:
Für die Beantwortung der Forschungsfrage wird die ENP nicht nur mit der EU-Erweiterungspolitik, sondern auch mit der vorherigen EU-Policy gegenüber diesen beiden Staaten verglichen (die „Partnerschaftspolitik“ der 90er Jahre). Als theoretische Grundlage dient der historische Institutionalismus und dessen Grundannahme, dass sich institutionalisierte Außenbeziehungen der EU pfadabhängig entwickeln und ein hohes Maß an Veränderungsresistenz zeigen. Die Forschungsperspektive hinterfragt somit kritisch die häufige intuitive Einschätzung, die ENP stelle einen „Ableger“ der EU-Erweiterungspolitik dar.
Methodik:
Methodisch wird das Modell externer Europäisierung herangezogen - als Governance-Form der EU gegenüber ihren Nachbarn. Die EU-internen Entscheidungs- und Aushandlungsprozesse (Politics) werden in der Analyse ausgespart. Externe Europäisierung als Governance-Modell ist maßgeblich gekennzeichnet durch:
(a) Ziel des Normtransfers
(b) Transfer von „EU-typischen“ Inhalten (i.S. der Kopenhagener Kriterien)
(c) Mittel der Konditionalität und Sozialisierung.
Forschungsergebnis:
Nach einer vergleichenden Analyse der ENP und Partnerschaftspolitik wird gezeigt, ob die ENP in Kontinuität der älteren Partnerschaftspolitik steht oder eher einem (abrupten) Policy-Transfer entsprechend der EU-Erweiterungspolitik ähnelt. Hieraus lässt sich ableiten, ob die EU in ihrer östlichen Nachbarschaft eine neue geostrategische Ausrichtung anstrebt.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINFÜHRUNG
- 1. HISTORISCHER UND POLITISCHER KONTEXT
- 2. ERKENNTNISINTERESSE
- 2.1. Erkenntnisstand: Die ENP und die EU-Erweiterungspolitik
- 2.2. Erkenntnislücke: Die ENP und die Partnerschaftspolitik
- 2.3. Forschungsfrage
- 3. FORSCHUNGSDESIGN
- 4. EINSCHRÄNKUNG DES FORSCHUNGSVORGABENS
- 4.1. Output-Fokus
- 4.2. Die EU als Akteur in den internationalen Beziehungen
- II. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 1. NEOINSTITUTIONALISMUS
- 2. HISTORISCHER INSTITUTIONALISMUS
- 2.1. Grundannahmen
- 2.2. Zentrale relevante Kritikpunkte
- 2.3. Externe EU-Governance als Institution
- 2.4. Operationalisierung des Historischen Institutionalismus
- 3. EXTERNE EUROPÄISIERUNG
- 3.1. Abgrenzung: Externe und interne Europäisierung
- 3.2. Externe Europäisierung als Strategie gegenüber Drittstaaten
- 3.3. Ziel externer Europäisierung
- 3.4. Normen externer Europäisierung: „Was wird transferiert?“
- 3.4.1. Systematische Zuordnung der Normen externer Governance
- 3.5. Prozesse externer Europäisierung: „Wie wird transferiert?“
- 3.5.1. Top-down-Europäisierung als externe Europäisierung
- 3.5.2. Mittel zur Beeinflussung unterstützender Faktoren
- 3.5.3. Rationaler Wirkungsmechanismus
- 3.5.4. Soziologischer Wirkungsmechanismus
- 3.5.5. Systematische Zuordnung prozessualer externen Governance
- 3.5.6. Erklärungskonkurrenz der Verhaltensmaxime
- 3.6. Abgrenzung: „externe Demokratieförderung“
- 3.7. Tabellarische Übersicht: Parameter und Kategorien externer Europäisierung
- III. DIE PARTNERSCHAFTSPOLITIK DER EU
- 1. GRUNDLAGEN
- 1.1. Definition „Partnerschaftspolitik“
- 1.2. Die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen
- 1.2.1. Bilaterale Politikgestaltung
- 1.2.2. Inhaltliche Übersicht: Eingeschränkte Differenzierung
- 1.2.3. Organisatorische Struktur der PKA
- 1.3. Das komplementäre Finanzinstrument TACIS
- 1.3.1. Funktion
- 1.3.2. Finanzmittel
- 1.3.3. Organisatorische Struktur von TACIS
- 1.3.4. TACIS und die PKA
- 2. REFORMEN: DYNAMISCHE ENTWICKLUNGEN
- 2.1. „Fahrplan“ zur Errichtung einer Freihandelszone mit der Ukraine
- 2.2. Das Prinzip „Gemeinsame Verantwortung“
- 2.3. Aktionsplan für Justiz und Inneres mit der Ukraine
- 2.4. Die Gemeinsame Strategie gegenüber der Ukraine
- 2.5. Reform des TACIS-Programms
- 3. DIE PARTNERSCHAFTSPOLITIK ALS MODELL EXTERNER EUROPÄISIERUNG
- 3.1. STRATEGISCHE ZIELSETZUNG
- 3.1.1. Die Partnerschaftspolitik als Erweiterungspolitik
- 3.1.2. Symmetrische Bestimmungen: kontra asymmetrischen Normtransfer
- 3.1.3. Asymmetrische Bestimmungen: pro asymmetrischen Normtransfer
- 3.1.4. Zwischenbewertung: Konvergenz durch Kooperation
- 3.2. NORMEN FÜR ANGESTREBTEN TRANSFER
- 3.2.1. Deskriptiv: Die PKA als normativer Rahmen
- 3.2.2. Das Normspektrum: Zentrale Normgruppen
- 3.2.3. Normative Prioritäten
- 3.2.4. Spezifizierung durch Reformanleitung und Richtgrößen
- 3.2.5. Reformauswirkungen
- 3.2.6. Modelltheoretische Zuordnung: Kopenhagener Kriterien
- 3.2.7. Zwischenbewertung: Modernisierungspartnerschaft
- 3.3. PROZESSUALE GOVERNANCE FÜR NORMTRANSFER
- 3.3.1. Konditionale Governance
- 3.3.2. Sozialisierende Governance
- 3.3.3. Zwischenbewertung der prozessualen EU-Governance
- 4. ÜBERSICHT MODELLTHEORETISCHER ZUORDNUNG: DIE PARTNERSCHAFTS-POLITIK ALS MODELL EXTERNER EUROPÄISIERUNG
- IV. DIE EUROPÄISCHE NACHBARSCHAFTSPOLITIK
- 1. GRUNDLAGEN
- 1.1. Definition „Nachbarschaftspolitik“
- 1.2. Strategiepapier, Länderberichte und Aktionspläne der ENP
- 1.2.1. Politikgestaltung
- 1.2.2. Makro und Mikro-Ebene der EU-Strategie
- 1.2.3. Inhaltliche Übersicht: Differenzierung in einheitlichem Rahmen
- 1.3. Sicherheitspolitischer Kontext: Europäische Sicherheitsstrategie
- 2. FORMALES VERHÄLTNIS VON PARTNERSCHAFTS- UND NACHBARSCHAFTSPOLITIK
- 2.1. Die PKA in der Nachbarschaftspolitik
- 2.2. TACIS in der Nachbarschaftspolitik
- 3. DIE ENP ALS MODELL EXTERNER EUROPÄISIERUNG
- 3.1. STRATEGISCHE ZIELSETZUNG
- 3.1.1. Die ENP als Erweiterungspolitik
- 3.1.2. Asymmetrische Bestimmungen: pro asymmetrischen Normtransfer
- 3.1.3. Symmetrische Bestimmungen: kontra asymmetrischen Normtransfer
- 3.1.4. Auswertender Vergleich der Zielsetzung: Kontinuität, sukzessive Adaptierung oder Critical Juncture?
- 3.1. NORMEN FÜR ANGESTREBTEN TRANSFER
- 3.1.5. Deskriptiv: Die Aktionspunkte der AP
- 3.1.6. Normativer Vergleich von Partnerschaftspolitik und ENP
- 3.1.7. Modelltheoretische Zuordnung: Kopenhagener Kriterien
- 3.1.8. Auswertender Vergleich der Normen: Kontinuität, sukzessive Adaptierung oder Critical Juncture?
- 3.2. PROZESSUALE GOVERNANCE FÜR NORMTRANSFER
- 3.2.1. Konditionale Governance
- 3.2.2. Sozialisierende Governance
- 3.2.3. Auswertender Vergleich der prozessualen Governance: Kontinuität, sukzessive Adaptierung oder Critical Juncture?
- 4. ÜBERSICHT MODELLTHEORETISCHER ZUORDNUNG: DIE ENP ALS MODELL EXTERNER EUROPÄISIERUNG IM VERGLEICH
- Die EU als Akteur in den internationalen Beziehungen
- Externe Europäisierung als Strategie gegenüber Drittstaaten
- Die ENP und die Partnerschaftspolitik im Kontext der EU-Erweiterungspolitik
- Vergleich der Normen und Governance-Mechanismen von ENP und Partnerschaftspolitik
- Die Rolle des Historischen Institutionalismus bei der Erklärung von Veränderungen in der EU-Außenpolitik
- I. Einführung: Die Einleitung stellt den historischen und politischen Kontext der Arbeit dar, definiert das Erkenntnisinteresse und die Forschungsfrage. Sie beschreibt das Forschungsdesign und die Einschränkungen des Forschungsprozesses.
- II. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es analysiert den Neoinstitutionalismus und den Historischen Institutionalismus als theoretische Ansätze zur Erklärung von EU-Außenpolitik. Es definiert den Begriff der externen Europäisierung und grenzt ihn von der internen Europäisierung ab. Außerdem werden die Normen und Prozesse der externen Europäisierung untersucht, sowie die verschiedenen Wirkungsmechanismen, die bei der Beeinflussung von Drittstaaten auftreten.
- III. Die Partnerschaftspolitik der EU: Dieses Kapitel befasst sich mit der Partnerschaftspolitik der EU. Es definiert den Begriff „Partnerschaftspolitik“ und beschreibt die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen sowie das Finanzinstrument TACIS. Weiterhin werden Reformen der Partnerschaftspolitik untersucht und diese als Modell externer Europäisierung analysiert.
- IV. Die Europäische Nachbarschaftspolitik: Dieses Kapitel analysiert die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP). Es definiert den Begriff „Nachbarschaftspolitik“ und untersucht die Strategiepapiere, Länderberichte und Aktionspläne der ENP. Außerdem wird das formale Verhältnis von Partnerschafts- und Nachbarschaftspolitik betrachtet und die ENP als Modell externer Europäisierung analysiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) der Europäischen Union (EU) im Vergleich zur Partnerschaftspolitik als Modelle externer Europäisierung. Ziel ist es, die strategischen Zielsetzungen, Normen und prozessualen Governance-Mechanismen der beiden Politikbereiche zu analysieren und zu vergleichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen der Europäischen Nachbarschaftspolitik, der Partnerschaftspolitik, der externen Europäisierung, der EU-Erweiterungspolitik, des Neoinstitutionalismus, des Historischen Institutionalismus, der Governance, der Normen und des Normtransfers.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP)?
Die ENP zielt darauf ab, die Beziehungen der EU zu ihren Nachbarstaaten strategisch neu auszurichten, ohne direkt eine Mitgliedschaft anzubieten, wobei oft ein Normtransfer durch externe Europäisierung angestrebt wird.
Was versteht man unter externer Europäisierung?
Externe Europäisierung beschreibt den Prozess, bei dem die EU ihre Normen, Regeln und Politiken auf Drittstaaten überträgt, oft durch Mechanismen wie Konditionalität und Sozialisierung.
Wie unterscheidet sich die ENP von der früheren Partnerschaftspolitik?
Die Arbeit untersucht, ob die ENP eine Fortführung der Partnerschaftspolitik der 90er Jahre (PKA) ist oder ob sie eher der Erweiterungspolitik ähnelt, was auf eine neue geostrategische Ausrichtung hindeuten würde.
Welche Rolle spielt der Historische Institutionalismus in dieser Analyse?
Der Historische Institutionalismus dient als Theorie, um zu erklären, wie pfadabhängig sich die Außenbeziehungen der EU entwickeln und wie resistent Institutionen gegenüber abrupten Veränderungen sind.
Was war das TACIS-Programm?
TACIS war ein komplementäres Finanzinstrument der EU, das in den 90er Jahren dazu diente, den Übergang zur Marktwirtschaft und Demokratie in Osteuropa und Zentralasien finanziell zu unterstützen.
Welche Staaten dienen als Fallbeispiele für die Untersuchung?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Ukraine und Moldau, die als geostrategisch bedeutende „In-betweens“ zwischen der EU und Russland liegen.
- Quote paper
- Malte Firlus (Author), 2008, Die Europäische Nachbarschaftspolitik als strategische Offensive der EU in Osteuropa?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162246