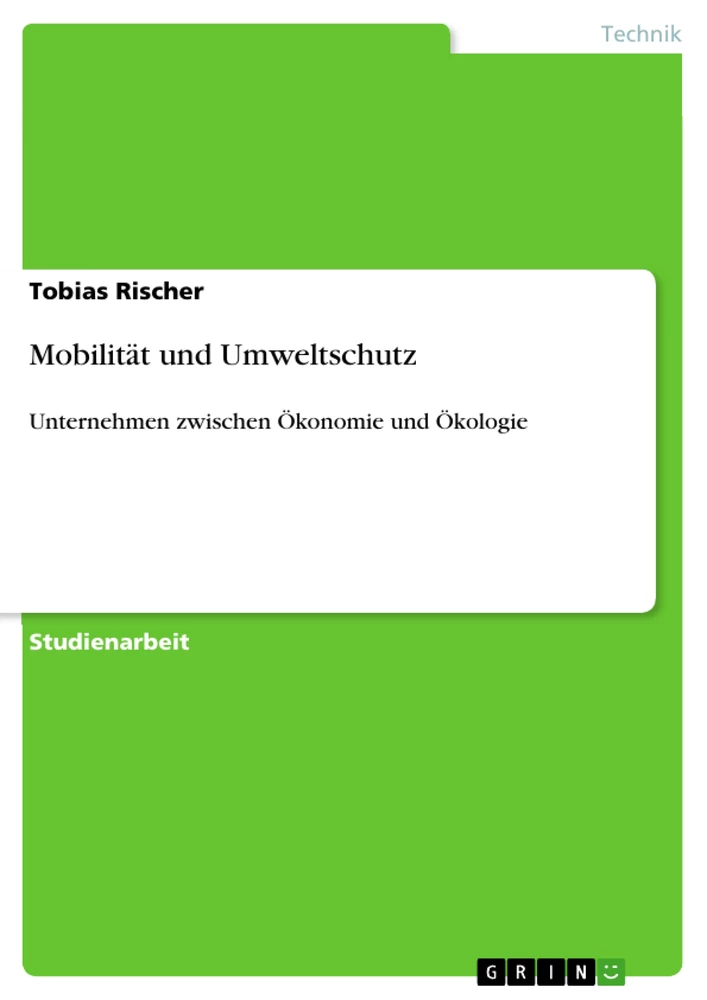Mobilität und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, ist das überhaupt möglich? Diese Frage soll in dieser Seminararbeit beantwortet werden.
Für viele Menschen in der heutigen Gesellschaft ist es selbstverständlich mobil zu sein, sich zu jeder Zeit von einem zum anderen Ort bewegen zu können. Mobilität ist Voraussetzung für soziale Aktivitäten, da sich im Normalfall Arbeitsplatz, Wohnung, Freizeitaktivitäten oder Freunde nicht am gleichen Ort befinden, also räumlich getrennt sind. Aber auch für die Wirtschaft ist Mobilität von größter Bedeutung, denn wie sonst sollten Warenbewegungen funktionieren?
Sobald nun aber eine Bewegung stattfindet, sei es mit dem Auto, der Bahn, dem Flugzeug, dem Schiff oder mit dem Fahrrad, wird Energie verbraucht, die bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger Schadstoffemissionen verursacht, wobei negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt entstehen.
Geeignete Maßnahmen und Instrumente sollen denen gegenwirken, um auch langfristig ein Leben auf der Erde zu ermöglichen, denn „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Le-bensgrundlagen …“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Mobilität und Umweltschutz
- 2.1 Mobilität. Was steckt hinter diesem Begriff?
- 2.2 Warum Mobilität für Unternehmen wichtig ist
- 2.3 Die Auswirkungen der Mobilität auf die Umwelt
- 2.3.1 Ökologische Folgen
- 2.3.2 Soziale Folgen
- 2.3.3 Externe Kosten bzw. ökonomische Folgen
- 3. Maßnahmen zum Umweltschutz
- 3.1 „Weiche“ Instrumente sowie Maßnahmen zur indirekten Verhaltenssteuerung und Planung
- 3.2 Direkte Verhaltenssteuerung
- 3.2.1 Luftreinhaltung
- 3.2.2 Lärmschutz
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den scheinbaren Widerspruch zwischen Mobilität und Umweltschutz. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen beiden Themenfeldern aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Mobilität für die Gesellschaft und die Wirtschaft, untersucht die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und präsentiert verschiedene Maßnahmen zum Umweltschutz im Kontext der Mobilität.
- Der Begriff Mobilität und seine Bedeutung für Gesellschaft und Wirtschaft
- Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen der Mobilität
- Instrumente und Maßnahmen zur indirekten Verhaltenssteuerung im Umweltschutz
- Direkte Maßnahmen zur Verhaltenssteuerung im Bereich Luftreinhaltung und Lärmschutz
- Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Mobilität und Umweltschutz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vereinbarkeit von Mobilität und Umweltschutz. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit von Mobilität für soziale und wirtschaftliche Aktivitäten und hebt gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hervor. Der Bezug auf das Grundgesetz unterstreicht die Verantwortung zukünftiger Generationen für den Umweltschutz und leitet zur Notwendigkeit von umweltverträglichen Mobilitätslösungen über.
2. Mobilität und Umweltschutz: Dieses Kapitel definiert den Begriff Mobilität und untersucht seine Bedeutung für Unternehmen. Es analysiert umfassend die Auswirkungen der Mobilität auf die Umwelt, wobei ökologische, soziale und ökonomische Folgen detailliert dargestellt werden. Die Beschreibung der verschiedenen Transportmittel und ihrer unterschiedlichen Schadstoffemissionen verdeutlicht die Komplexität des Problems. Die Diskussion der externen Kosten macht die ökonomischen Aspekte der Umweltbelastung deutlich.
3. Maßnahmen zum Umweltschutz: Das Kapitel befasst sich mit verschiedenen Maßnahmen zum Umweltschutz im Kontext der Mobilität. Es differenziert zwischen „weichen“ Instrumenten der indirekten Verhaltenssteuerung und direkten Maßnahmen. Die detaillierte Betrachtung von Luftreinhaltung und Lärmschutz verdeutlicht den praktischen Ansatz zur Reduktion von Umweltbelastungen. Die Ausführungen geben einen Überblick über verschiedene Strategien und deren jeweilige Zielsetzung.
Schlüsselwörter
Mobilität, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Verkehrsträger, Schadstoffemissionen, Verhaltenssteuerung, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Ökonomie, Ökologie, externe Kosten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Mobilität und Umweltschutz
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht den scheinbaren Widerspruch zwischen Mobilität und Umweltschutz. Sie analysiert die Bedeutung von Mobilität für Gesellschaft und Wirtschaft, die negativen Umweltauswirkungen und präsentiert Lösungsansätze. Die Arbeit beinhaltet eine Einführung, eine detaillierte Betrachtung von Mobilität und ihren Folgen (ökologisch, sozial, ökonomisch), eine Erörterung von Maßnahmen zum Umweltschutz (indirekte und direkte Verhaltenssteuerung) und ein Fazit.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition des Begriffs Mobilität und seine Bedeutung, Auswirkungen der Mobilität auf die Umwelt (einschließlich ökologischer, sozialer und ökonomischer Folgen), „weiche“ und direkte Instrumente zur Verhaltenssteuerung im Umweltschutz (mit Fokus auf Luftreinhaltung und Lärmschutz), und die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Mobilität und Umweltschutz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einführung) stellt die Problemstellung vor und erläutert die Vorgehensweise. Kapitel 2 (Mobilität und Umweltschutz) definiert Mobilität und analysiert deren Auswirkungen auf die Umwelt. Kapitel 3 (Maßnahmen zum Umweltschutz) beschreibt verschiedene Strategien zur Reduzierung von Umweltbelastungen, unterscheidet zwischen indirekten und direkten Maßnahmen und beleuchtet Luftreinhaltung und Lärmschutz. Kapitel 4 (Fazit und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen Mobilität und Umweltschutz aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu beleuchten. Sie analysiert die Bedeutung der Mobilität und deren negative Auswirkungen auf die Umwelt, um verschiedene Maßnahmen zum Umweltschutz im Kontext der Mobilität zu präsentieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Mobilität, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Verkehrsträger, Schadstoffemissionen, Verhaltenssteuerung, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Ökonomie, Ökologie, externe Kosten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Aufbau ist klar strukturiert und ermöglicht ein leichtes Verständnis der komplexen Thematik.
- Citar trabajo
- Tobias Rischer (Autor), 2010, Mobilität und Umweltschutz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162286