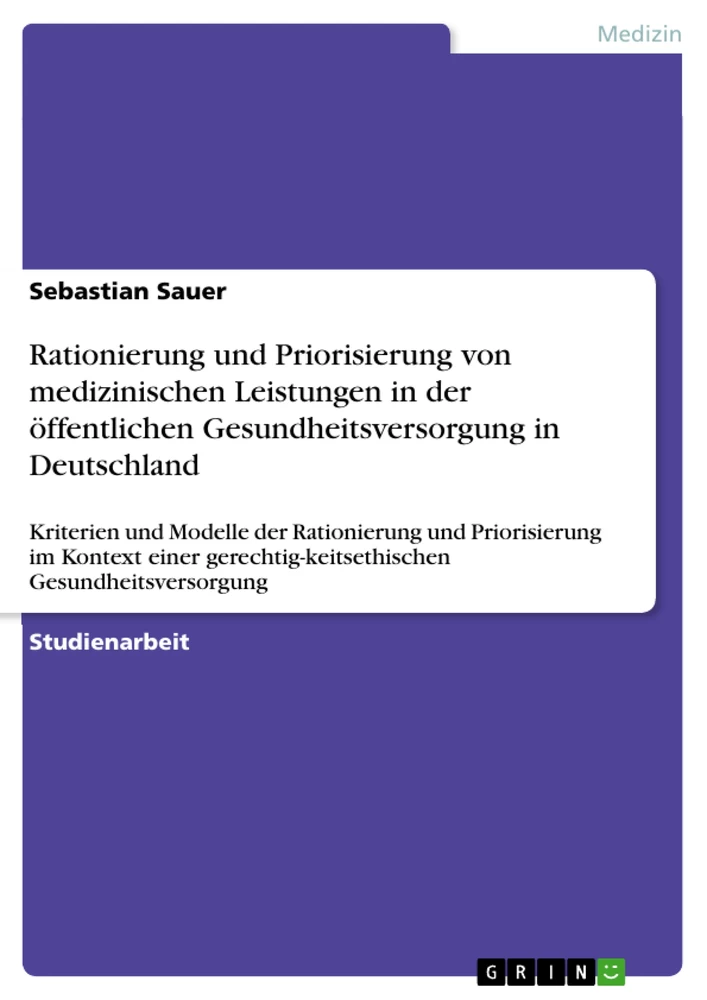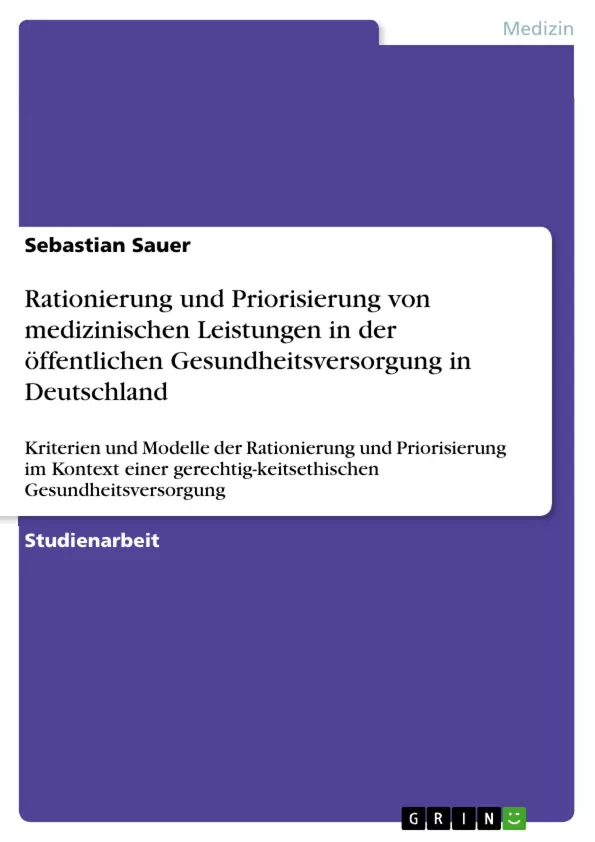Die Finanzierungsproblematik der öffentlichen Gesundheitsversorgung in Deutschland wird sich aufgrund externer Umweltbedingungen und interner Bedingungen im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren weiter intensivieren (vgl. Schirmer & Fuchs 2009). Zu den kontrovers diskutierten externen und internen Bedingungen werden insbesondere die Faktoren der demographischen Entwicklung, eine abnehmende Qualität der sozialen Netze, die veränderten Ansprüche der Patienten und deren Angehörigen, die fehlenden ökonomischen Anreizsysteme für Patienten und Anbieter, eine zunehmende Spezialisierung der Medizin, ein allgemein medizin-technischer Fortschritt, die epidemiologische Transition, nicht vorhandene sektorenübergreifende Versorgungskonzepte, erhebliche Managementdefizite und eine zunehmende Diskrepanz zwischen steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen diskutiert (vgl. Marckmann 2008; Offermanns 2007; Schirmer & Fuchs 2009).
Die aufgeführten Faktoren werden zu einer erhöhten Nachfrage nach Gesundheitsleistungen und einem verminderten Angebot von Ressourcen beitragen, die die Ressourcenknappheit in der öffentlichen Gesundheitsversorgung verstärken wird (vgl. Marckmann 2008). Als Strategien zum Umgang mit der Mittelknappheit werden drei grundlegende Lösungen, die der Erhöhung der Mittel im Gesundheitswesen, die der Effizienzsteigerung (Rationalisierung) und die der Leistungsbegrenzung (Rationierung), vorgeschlagen. Ein vierter potentieller Lö-sungsansatz, die der medizinischen Prioritätensetzung (Priorisierung), wird überdies vermehrt in der deutschsprachigen Literatur angeführt (vgl. Buyx et al. 2009; Marckmann 2008; Wohlgemuth et al. 2009).
Im Zusammenhang mit den vier Lösungsansätzen stellt sich die erste Frage: Nach welchen Grundprinzipien eine gerechte Gesundheitsversorgung zu organisieren ist? Nach Kersting (2007) und Marckmann (2008) sollte aus ökonomischer und ethischer Perspektive die Allokation von medizinischen Versorgungsleistungen nicht alleine dem Markt überlassen werden. Die Argumente des Marktversagens, der transzendentale Charakter des Gutes Gesundheit und das Vertragsargument unterstützen eine einkommensneutrale und solidargemeinschaftlich finanzierte, öffentlich organisierte Gesundheitsversorgung. Die Entscheidung für eine zumindest teilweise staatlich regulierte Gesundheitsversorgung beantwortet jedoch nicht die zweite Frage: Nach welchen Verfahren und Kriterien die verfügbaren Ressourcen alloziiert werden sollten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitorische Grundlagen
- Rationalisierung
- Rationierung
- Allokationsebenen nach Engelhardt
- Rationierungsformen
- Priorisierung
- Zusammenhänge von Rationalisierung, Rationierung und Priorisierung
- Sollte aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive rationiert werden?
- Positiv
- Normativ
- Prinzipien, Kriterien und Modelle der Rationierung und Priorisierung
- Kriterienmodelle zur Rationierung medizinischer Leistungen
- Kriterienmodelle zur Priorisierung medizinischer Leistungen
- Grundlagen des Sozialstaates und gerechtigkeitsethische Theorien
- Sozialstaatsprinzipien
- Gerechtigkeitsethische Theorien
- Allokationsethik in der öffentlichen Gesundheitsversorgung - Normative Kriterien- und Modellbewertung
- Präferierende Rationierungsformen
- Vor- und Nachteile einer Altersrationierung
- Inhaltliche Kriterien einer Vier-Stufen-Priorisierung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kriterien und Modelle der Rationierung und Priorisierung von medizinischen Leistungen im deutschen Gesundheitssystem. Sie fokussiert auf die Frage, wie eine gerechtigkeitsethische Gesundheitsversorgung in Zeiten knapper Ressourcen gestaltet werden kann.
- Definitorische Grundlagen von Rationalisierung, Rationierung und Priorisierung
- Die ethischen und ökonomischen Argumente für und gegen Rationierung
- Kriterien und Modelle für die Rationierung und Priorisierung von medizinischen Leistungen
- Die Rolle von Sozialstaatsprinzipien und gerechtigkeitsethischen Theorien in der Allokation von Gesundheitsgütern
- Normative Bewertung verschiedener Rationierungs- und Priorisierungsmodelle im Kontext einer gerechten Gesundheitsversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert die Begriffe Rationalisierung, Rationierung und Priorisierung und stellt verschiedene Modelle und Ebenen der Rationierung vor. Das zweite Kapitel argumentiert, dass aus sowohl positiver als auch normativer Perspektive eine Rationierung von medizinischen Leistungen erforderlich ist. Das dritte Kapitel analysiert Kriterien und Modelle für die Rationierung und Priorisierung von medizinischen Leistungen. Das vierte Kapitel untersucht die Grundlagen des Sozialstaates und relevanten gerechtigkeitsethischen Theorien und bewertet diese im Kontext der zuvor präsentierten Rationierungs- und Priorisierungskriterien.
Schlüsselwörter
Rationierung, Priorisierung, Gesundheitsversorgung, Gerechtigkeitsethik, Sozialstaat, Allokation, Kriterienmodelle, Ressourcenknappheit
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Rationalisierung, Rationierung und Priorisierung?
Rationalisierung steigert die Effizienz, Rationierung begrenzt Leistungen bei Knappheit und Priorisierung legt die Rangfolge der medizinischen Versorgung fest.
Warum wird Rationierung im deutschen Gesundheitswesen diskutiert?
Gründe sind der demographische Wandel, medizinischer Fortschritt und steigende Kosten bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen der Sozialkassen.
Ist eine Altersrationierung ethisch vertretbar?
Die Arbeit analysiert Vor- und Nachteile der Altersrationierung aus ethischer Sicht und bewertet sie im Kontext von Gerechtigkeitstheorien.
Nach welchen Kriterien sollten medizinische Leistungen priorisiert werden?
Mögliche Kriterien sind die Dringlichkeit der Behandlung, der erwartete Nutzen, die Schwere der Erkrankung und die Kosten-Effektivität.
Was bedeutet Allokationsethik in der Gesundheitsversorgung?
Sie befasst sich mit der gerechten Verteilung knapper Ressourcen unter Berücksichtigung solidarischer und wohlfahrtsökonomischer Prinzipien.
Warum kann der Markt die Gesundheitsversorgung nicht allein regeln?
Argumente wie Marktversagen und der transzendentale Wert der Gesundheit sprechen für eine staatlich regulierte, einkommensneutrale Versorgung.
- Quote paper
- Sebastian Sauer (Author), 2010, Rationierung und Priorisierung von medizinischen Leistungen in der öffentlichen Gesundheitsversorgung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162322