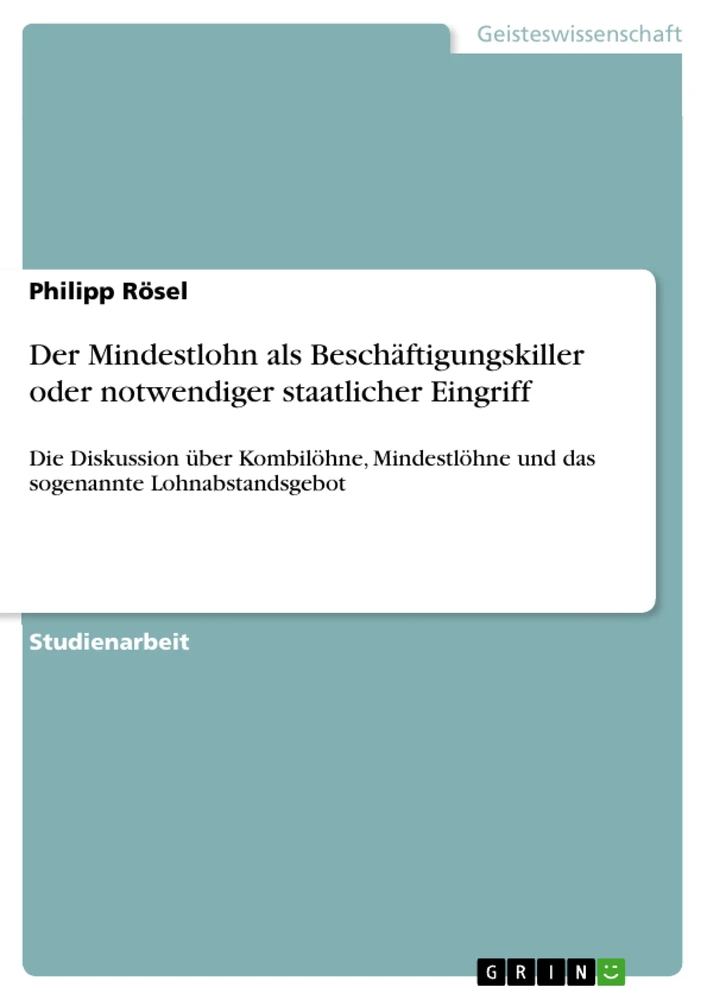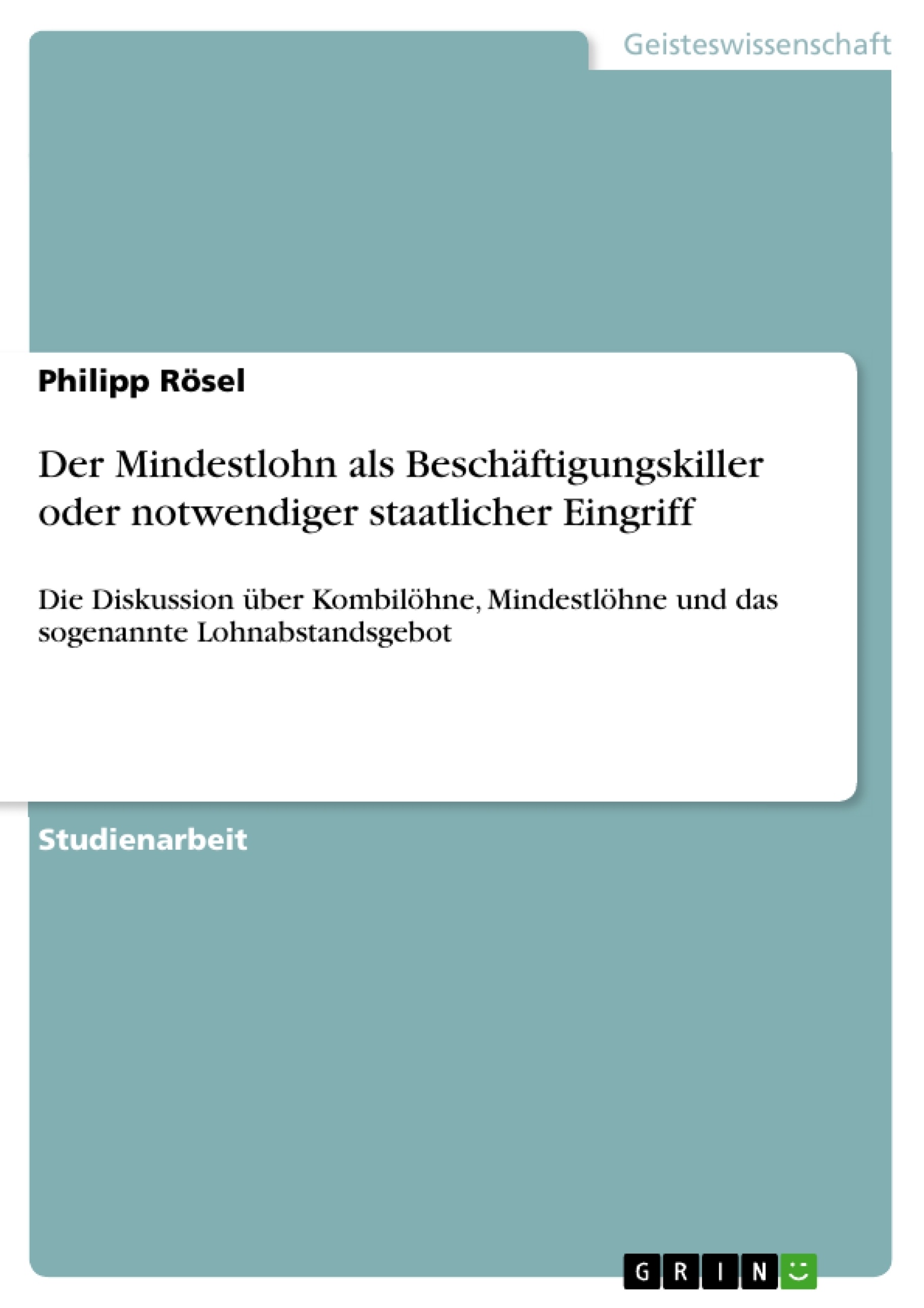Für die hier bearbeitete Thematik stellt sich in diesem Zusammenhang aber weniger die Frage einer möglichen Gesetzesgrundlage für das Lohnabstandsgebot, sondern die der Teildiskussionen des hier dargestellten Diskurses. So ist festzuhalten, dass Diskussionen um das Lohnabstandsgebot meist mit anstehenden Kürzungen im Bereich des Sozialstaates und Debatten um Mindest- oder Kombilöhne in Zusammenhang stehen. Grund ist die Idee hinter all diesen miteinander verwandten Teilbereichen der Debatte, die sich insgesamt mit dem Thema Erwerbsarbeit und ihrer gesellschaftlichen Stellung befasst. Lohnabstandsgebot, Mindestlohn und Kombilohn verfolgen zunächst - von ihren Befürwortern ideologisch diversifiziert - allesamt dieselben Zwecke: Menschen sollen durch Erwerbsarbeit befähigt werden, ihren Lebensunterhalt mehr oder minder selbstständig und sozialverträglich zu verdienen. Im Detail sind selbstverständlich viele Unterschiede, Widersprüche und Gegensätze zu finden, vor allem was wirtschaftsliberale Kombilohnmodelle vs. Mindestlöhne betrifft. Grundsätzlich sind beide Konzepte auf den Niedriglohnsektor gerichtet, nähern sich ihm jedoch aus unterschiedlichen Richtungen (Satilmis, 2006, S.87-88). Somit ergibt sich für die gesamte Thematik vor allem eine zentrale Fragestellung: Wie sind die beiden Ansätze im Hinblick auf das Phänomen der Massenarbeitslosigkeit und der Probleme der sozialen Sicherungsnetze hin zu beurteilen? Wie können mehr Menschen in Erwerbsarbeit vermittelt werden, bzw. ihren Lebensunterhalt weitestgehend frei von staatlichen Hilfen bestreiten? Grundlegend gehen einige Vertreter von Kombilohnmodellen davon aus, dass es einen starken Ausbau des Niedriglohnsektors geben muss. Hiervon versprechen sie sich die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Der Mindestlohn hingegen setzt an anderer Stelle an, nämlich bei bestehenden Arbeitsverhältnissen. Er verpflichtet die Arbeitgeber, ihren Beschäftigten einen sozialverträglichen und ausreichenden Lohn zu zahlen. Man will z.B. das Phänomen der Vollzeit Berufstätigen, ostdeutschen Arbeitnehmerinnen, die trotz 40 Stunden-Woche noch mittels Hartz 4 aufstocken müssen, dadurch bekämpfen. Dies soll an späterer Stelle im Detail noch genau erläutert werden. Zunächst sollen jedoch die im Folgenden verwendeten Begrifflichkeiten Mindestlohn und Kombilohn genau definiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Das Lohnabstandsgebot und die öffentliche Diskussion
- Definitionen relevanter Begriffe
- Kombilohn
- Mindestlohn
- Kombilöhne am Beispiel: Das Ifo-Modells
- Einkommensarmut in Deutschland
- Die drei Kernelemente des Ifo-Modells
- Wirkungen
- Niedriglöhne: Wünsche und Realitäten
- Mindestlöhne
- Argumente für den gesetzlichen Mindestlohn
- Argumente gegen Mindestlöhne und kritische Reflexion dieser
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Debatte um das Lohnabstandsgebot, Mindestlöhne und Kombilöhne in Deutschland. Sie analysiert die unterschiedlichen Konzepte und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die soziale Sicherung. Die Arbeit beleuchtet die Argumente für und gegen gesetzliche Mindestlöhne sowie die Funktionsweise von Kombilohnmodellen, insbesondere des Ifo-Modells.
- Das Lohnabstandsgebot und seine Rolle im politischen Diskurs
- Vergleich von Kombilohnmodellen und gesetzlichen Mindestlöhnen
- Auswirkungen von Niedriglöhnen auf Einkommensarmut
- Analyse des Ifo-Modells zur Bekämpfung von Einkommensarmut
- Bewertung der Argumente für und gegen Mindestlöhne
Zusammenfassung der Kapitel
Das Lohnabstandsgebot und die öffentliche Diskussion: Die Arbeit beginnt mit einer Diskussion des Lohnabstandsgebots, einem Begriff, der im politischen Diskurs um sozialstaatliche Transfers und deren Verhältnis zur Erwerbsarbeit zentral ist. Sie klärt, dass es keine explizite gesetzliche Definition gibt, sondern sich der Begriff auf politische Diskussionen und die im SGB XII verankerte Regelsatzbemessung bezieht, die jedoch nur für Ehepaare mit Kindern gilt. Der Fokus liegt auf der Verbindung des Lohnabstandsgebots mit Diskussionen um Kürzungen im Sozialstaat und Debatten um Mindest- und Kombilöhne, die alle das Ziel verfolgen, Erwerbsarbeit zur Sicherung des Lebensunterhalts zu ermöglichen. Die Arbeit hebt die unterschiedlichen Ansätze von Kombilohnmodellen und Mindestlöhnen hervor und stellt die zentrale Frage nach deren Bewertung im Hinblick auf Massenarbeitslosigkeit und soziale Sicherungssysteme.
Definitionen relevanter Begriffe: Dieses Kapitel definiert die Schlüsselbegriffe "Kombilohn" und "Mindestlohn". Ein Kombilohn beschreibt die Kombination aus Einkommen und staatlichem Transfer, also eine Aufstockung von Einkommen durch Sozialleistungen für Geringverdiener. Es werden verschiedene Kombilohnmodelle erwähnt, inklusive Mini- und Midijobs, und die kontroverse Diskussion um diese Modelle wird angesprochen, wobei die unterschiedlichen Positionen von CDU und SPD hervorgehoben werden. Der Mindestlohn wird als Verpflichtung des Arbeitgebers definiert, einen sozialverträglichen Lohn zu zahlen, um z.B. die Situation von Vollzeitbeschäftigten zu verbessern, die trotz Arbeit aufstockende Leistungen benötigen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Lohnabstandsgebot, Mindestlöhne und Kombilöhne in Deutschland
Was ist der Gegenstand der Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die Debatte um das Lohnabstandsgebot, Mindestlöhne und Kombilöhne in Deutschland. Sie analysiert die verschiedenen Konzepte, ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die soziale Sicherung, und bewertet die Argumente für und gegen gesetzliche Mindestlöhne.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Lohnabstandsgebot und seine Rolle im politischen Diskurs, den Vergleich von Kombilohnmodellen und gesetzlichen Mindestlöhnen, die Auswirkungen von Niedriglöhnen auf Einkommensarmut, die Analyse des Ifo-Modells zur Bekämpfung von Einkommensarmut und die Bewertung der Argumente für und gegen Mindestlöhne.
Was wird unter dem Lohnabstandsgebot verstanden?
Das Lohnabstandsgebot ist kein explizit gesetzlich definierter Begriff, sondern bezieht sich auf politische Diskussionen und die im SGB XII verankerte Regelsatzbemessung (jedoch nur für Ehepaare mit Kindern). Es beschreibt das Verhältnis von sozialstaatlichen Transfers zur Erwerbsarbeit und wird im Kontext von Diskussionen um Kürzungen im Sozialstaat und Debatten um Mindest- und Kombilöhne behandelt.
Wie werden Kombilöhne definiert?
Kombilöhne beschreiben die Kombination aus Einkommen und staatlichem Transfer, also eine Aufstockung von Einkommen durch Sozialleistungen für Geringverdiener. Die Arbeit erwähnt verschiedene Kombilohnmodelle (Mini- und Midijobs) und die kontroverse Diskussion um diese.
Wie wird der Mindestlohn definiert?
Der Mindestlohn wird als Verpflichtung des Arbeitgebers definiert, einen sozialverträglichen Lohn zu zahlen, um beispielsweise die Situation von Vollzeitbeschäftigten zu verbessern, die trotz Arbeit aufstockende Leistungen benötigen.
Welche Rolle spielt das Ifo-Modell in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Ifo-Modell als ein Beispiel für ein Kombilohnmodell. Es werden die drei Kernelemente des Modells und dessen Auswirkungen auf Einkommensarmut in Deutschland untersucht.
Welche Argumente für und gegen Mindestlöhne werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet ausführlich die Argumente für und gegen gesetzliche Mindestlöhne und bietet eine kritische Reflexion dieser Argumente.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: dem Lohnabstandsgebot und der öffentlichen Diskussion, Definitionen relevanter Begriffe (Kombilohn und Mindestlohn), Kombilöhnen am Beispiel des Ifo-Modells (inkl. Einkommensarmut in Deutschland und dessen Wirkungen), Niedriglöhnen: Wünsche und Realitäten, Mindestlöhnen (inkl. Argumenten dafür und dagegen) und einem Fazit.
- Citation du texte
- B.A. Philipp Rösel (Auteur), 2010, Der Mindestlohn als Beschäftigungskiller oder notwendiger staatlicher Eingriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162335